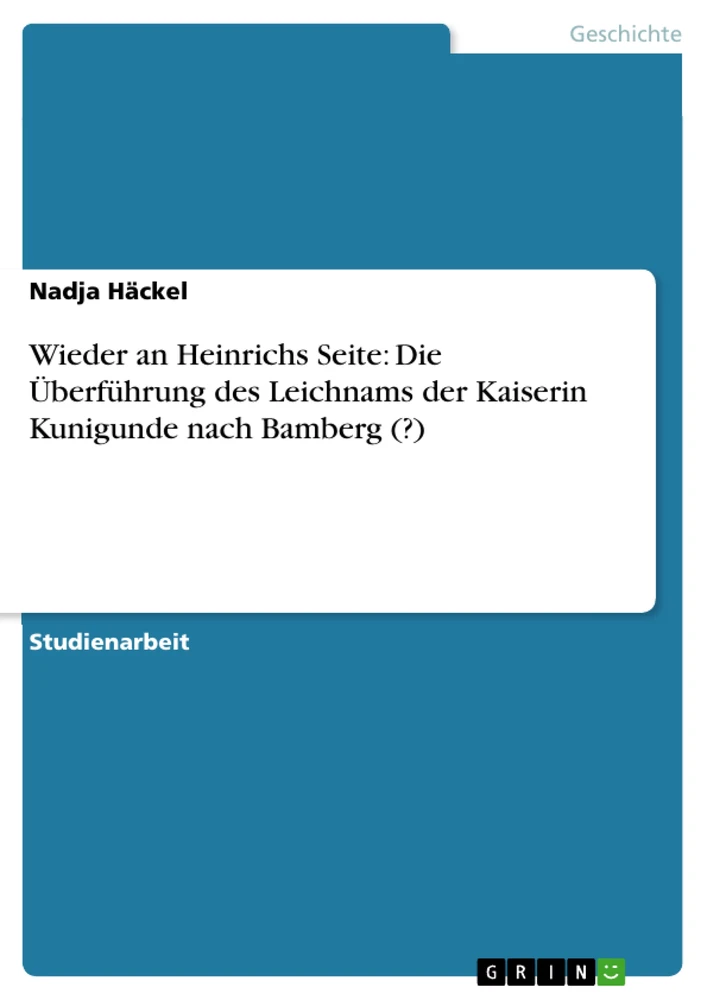Das Grab der heiligen Kaiserin Kunigunde
Bis heute erfährt die heilige Kaiserin Kunigunde (ca. 975-1033) besonders in Bamberg große Verehrung. Jährlich werden Prozessionen mit ihren Reliquien veranstaltet, im Diözesanmuseum ist ein auf sie ausgeschriebener Sarkophag ausgestellt und im Bamberger Dom steht ein von Tilman Riemenschneider gefertigtes Doppelgrab des mittelalterlichen Kaiserpaares Heinrich II. und Kunigunde. Die Überreste der Kaiserin sind heute bis nach Lissabon, Andechs, Wien, Köln, Eichstätt und Würzburg verstreut und werden dort verehrt.
Nach ihrem Tod im Kloster Kaufungen am 3. März 1033 blieb Kunigunde – Witwe des Ottonen Heinrich II. – fast 100 Jahre in Vergessenheit, bevor sie erneut Erwähnung fand. Plötzlich wurde von einer Überführung ihres Körpers nach Bamberg berichtet. Auch heute nimmt man vielerorts an, Kunigundes Grab befinde sich neben dem ihres Gemahls im Bamberger Dom und das heilige Kaiserpaar ruhe im Hochgrab Riemenschneiders. Doch wurde ihr Leichnam tatsächlich von Kaufungen nach Bamberg transferiert? Sind die angeblichen Reliquien die echten Überreste der Kaiserin? Welche Hinweise gibt es auf eine Überführung ihrer Gebeine?
Die Forschung hat sich lange Zeit entsprechend wenig mit dieser Frage beschäftigt, noch heute gehen manche Historiker nach wie vor von der Selbstverständlichkeit des Grabes in Bamberg aus. Allerdings haben einige besonders in den letzten Jahren ihre Zweifel an der Existenz eines solchen geäußert, so z.B. Bernd Schneidmüller oder Carla Meyer. Die vorliegende Arbeit orientiert sich an diesen Werken und möchte Vermutungen und Anzweiflungen zusammentragen um ein möglichst umfangreiches Bild des Problems um den tatsächlichen Aufenthaltsort des Leichnams der Kaiserin darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Das Grab der heiligen Kaiserin Kunigunde
- Quellenanalyse
- Der Codex Udalrici
- Die Vita sanctae Cunegundis
- Ebernand von Erfurt: Keisir vnde Keisirin
- Überlieferungszusammenhang der Quellen
- Hintergründe und Motive: Bamberger Kanonisationsbemühungen
- Zweifel an Kunigundes Überführung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die heilige Kaiserin Kunigunde nach ihrem Tod im Jahr 1033 tatsächlich von Kaufungen nach Bamberg überführt wurde. Sie analysiert die vorhandenen Quellen, hinterfragt ihren Wahrheitsgehalt und untersucht die Überlieferungsgeschichte, um die Entstehung der Überzeugung von Kunigundes Grab in Bamberg zu rekonstruieren.
- Überlieferungsgeschichte der Überführung von Kunigundes Leichnam nach Bamberg
- Analyse der Quellen und ihrer Aussagekraft
- Mögliche Hintergründe und Motive für die Überführung
- Darstellung der Zweifel an Kunigundes Überführung
- Erörterung der Wahrscheinlichkeit von Kunigundes Begräbnis in Bamberg
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die historische Bedeutung des Grabes der heiligen Kaiserin Kunigunde in Bamberg dar und führt die zentralen Fragen der Arbeit ein. Im zweiten Kapitel wird die Quellenlage analysiert, beginnend mit dem Codex Udalrici als erster Quelle, die von Kunigundes Grab in Bamberg berichtet. Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit weiteren Quellen, ihren Entstehungshintergründen und ihren Aussagen über die Überführung. Die Arbeit untersucht schließlich die Hintergründe und Motive für die Bamberger Kanonisationsbemühungen und beleuchtet die Zweifel an der Überführung von Kunigundes Leichnam.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Heilige Kaiserin Kunigunde, Überführung von Leichnamen, Grabmal, Quellenkritik, Überlieferungsgeschichte, Bamberger Dom, Kanonisation, historische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Wo befindet sich das Grab der Kaiserin Kunigunde?
Traditionell wird angenommen, dass Kunigunde im Bamberger Dom neben ihrem Gemahl Heinrich II. im berühmten Riemenschneider-Hochgrab ruht. Die historische Forschung äußert jedoch Zweifel an der tatsächlichen Überführung ihres Leichnams von Kaufungen nach Bamberg.
Welche Rolle spielt das Kloster Kaufungen im Kontext von Kunigundes Tod?
Kaiserin Kunigunde verstarb am 3. März 1033 im Kloster Kaufungen. Dort blieb ihr Andenken fast 100 Jahre lang weitgehend unbeachtet, bevor Berichte über eine angebliche Überführung nach Bamberg auftauchten.
Was ist der Codex Udalrici?
Der Codex Udalrici ist eine der ersten schriftlichen Quellen, die von einem Grab der Kunigunde in Bamberg berichten. Er dient als zentrale Grundlage für die Untersuchung der Überlieferungsgeschichte ihrer Gebeine.
Warum gibt es Zweifel an der Überführung des Leichnams?
Historiker wie Bernd Schneidmüller oder Carla Meyer bezweifeln die Überführung, da zeitgenössische Belege fehlen und die Berichte erst viel später im Zuge von Kanonisationsbemühungen (Heiligsprechung) entstanden sein könnten.
Wo werden Reliquien der Kaiserin Kunigunde heute verehrt?
Reliquien, die Kunigunde zugeschrieben werden, sind heute über viele Orte verstreut, darunter Bamberg, Lissabon, Andechs, Wien, Köln, Eichstätt und Würzburg.
- Quote paper
- Nadja Häckel (Author), 2007, Wieder an Heinrichs Seite: Die Überführung des Leichnams der Kaiserin Kunigunde nach Bamberg (?), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164961