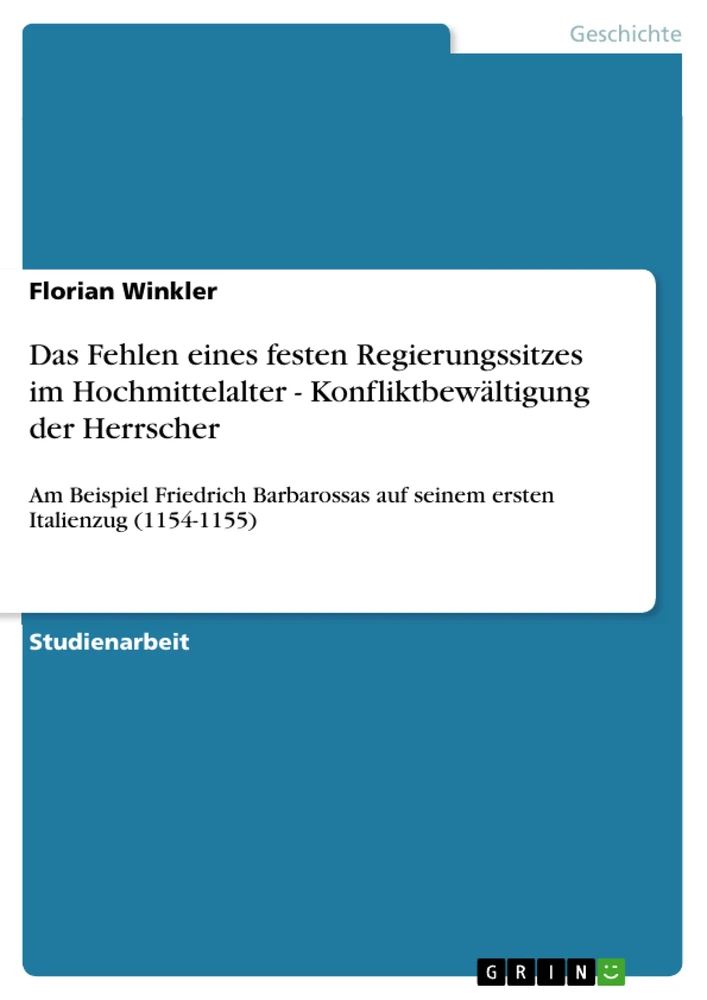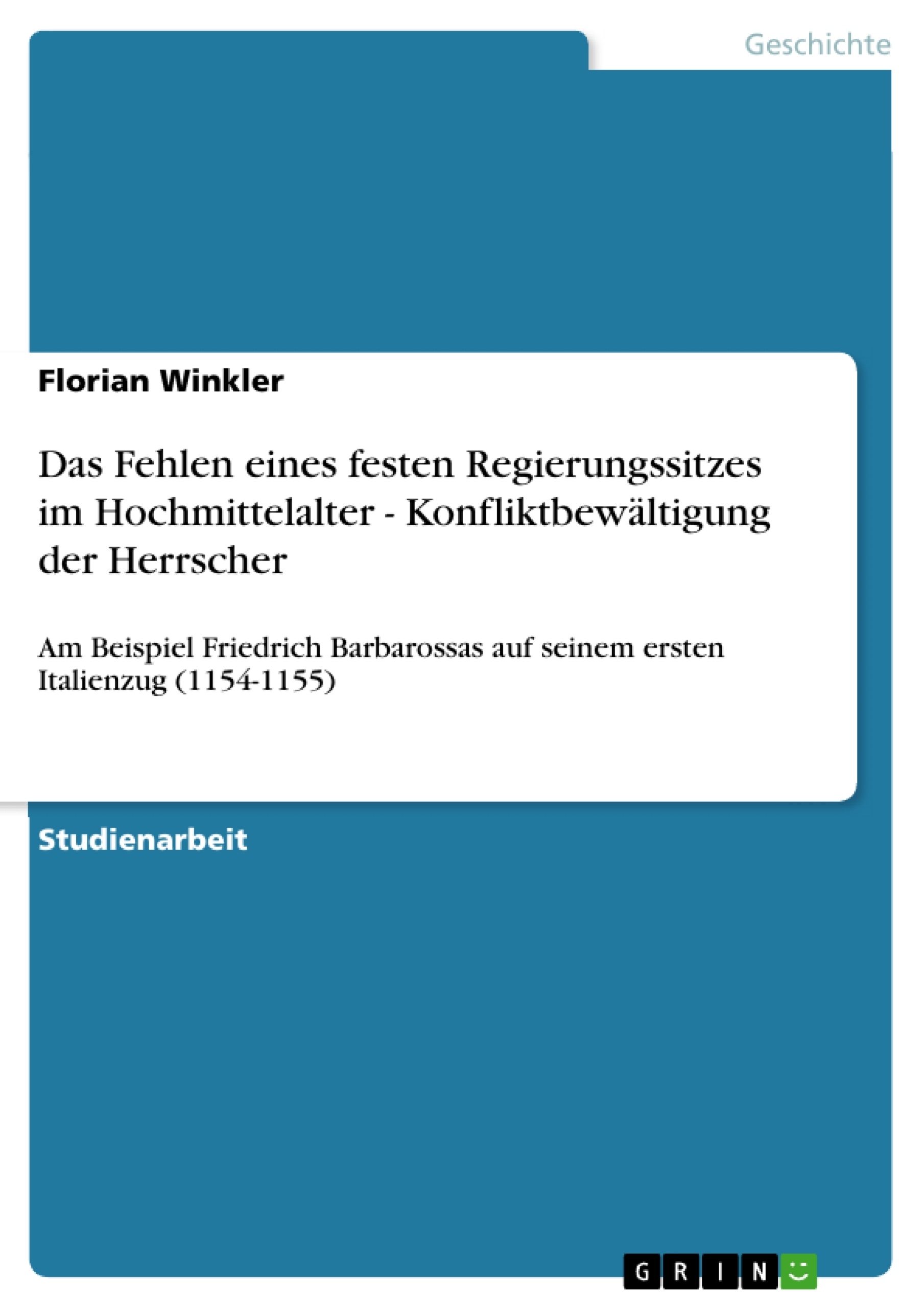Ein Phänomen des Mittelalters zeigt sich darin, dass die Herrscher ihrer Zeit keinen festen Regierungssitz innehatten. Keineswegs war es selbstverständlich – so wie es heute der Fall ist – von einer zentralen Stelle aus die Anweisungen und Forderungen nach außen hin weiterzugeben. Nicht nur, dass es damals keine – und schon gar nicht im heutigen Sinne – Hauptstadt gab, die als Verwaltungsmittelpunkt galt. Vielmehr kam noch hinzu, dass der Herrscher eines Reichs selbst derjenige war, der eigenhändig zu Konfliktbesprechungen und Feldzügen mit antrat. Auch dies stellt einen gewaltigen Unterschied zur aktuellen Zeit dar, wenn sogar zu Krisengipfeln nicht der „Herrscher“ selbst, nach aktuellem Stand die Bundeskanzlerin, sondern Minister mit den verschiedensten Ämtern beauftragt werden. Sicherlich gab es auch zur damaligen Zeit Gesandtschaften, die vom König beauftragt in die Lande zogen. Doch vor allem die Präsenz eines Herrschers an vorderster Stelle, insbesondere bei kriegerischen Auseinandersetzungen, zeigt die besondere Rolle des Königs. Sicherlich ist dieser Vergleich von Mittelalter und der heutigen Zeit gewagt und doch zugleich spannend, da man in einem solchen Vergleich eben auch die Entwicklungen sehen kann, die sich über Jahrhunderte hinweg vollzogen haben.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Kommentierte Bibliografie
- Quellenbeschreibung und Forschungsstand
- Einführung
- Der Italienzug 1154/ 1155
- Die Ausgangslage
- Inhalt des Konstanzer Vertrags und weitere Beweggründe
- Der Verlauf des 1. Italienzuges 1154 – 1155
- Ausblick und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Fehlen eines festen Regierungssitzes im Hochmittelalter am Beispiel Friedrich Barbarossas auf seinem ersten Italienzug (1154-1155). Im Fokus steht die Analyse der Konfliktbewältigung des Herrschers in dieser Zeit und die Darstellung seiner Route, seiner Motivation und der Entscheidungen, die er auf seiner Reise traf.
- Die Rolle des Herrschers im Hochmittelalter und der Vergleich mit der heutigen Zeit
- Die Gründe für Barbarossas Italienzug und die politische Situation in Italien
- Die Strategie der Konfliktbewältigung durch Barbarossa
- Die Bedeutung des Itinerars und der Route des Italienzugs
- Die Rezeption Barbarossas in der Geschichtswissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Vorwort stellt das Thema der Seminararbeit vor und erläutert die Relevanz der Untersuchung des umherziehenden Hofes Friedrich Barbarossas im Kontext seines ersten Italienzugs.
- Die kommentierte Bibliografie bietet einen Überblick über die Literatur, die für die Arbeit relevant ist.
- Das Kapitel "Quellenbeschreibung und Forschungsstand" beleuchtet die zentralen Quellen zur Stauferzeit, insbesondere Kaiserurkunden, Diplome, Briefsammlungen und die „Gesta Friderici“ des Bischofs Otto von Freising.
- Die Einführung bietet eine kurze Darstellung des Italienzugs und der politischen Situation der Zeit.
- Das Kapitel „Der Italienzug 1154/ 1155“ analysiert die Ausgangslage, den Inhalt des Konstanzer Vertrags und den Verlauf des ersten Italienzugs.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit Themen wie dem Hochmittelalter, dem Fehlen eines festen Regierungssitzes, der Herrscherrolle, Friedrich Barbarossa, Konfliktbewältigung, Italienzug, politischer Kontext, Route, Quellenanalyse, Urkunden, Diplome und die Rezeption des Staufer-Königs in der Geschichtswissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Warum hatten Herrscher im Hochmittelalter keinen festen Regierungssitz?
Im Mittelalter gab es keine zentralen Hauptstädte im modernen Sinne. Die Präsenz des Herrschers vor Ort war entscheidend für die Ausübung von Macht, die Rechtsprechung und die Konfliktbewältigung.
Was war der Anlass für den ersten Italienzug Friedrich Barbarossas?
Der Italienzug (1154–1155) diente der Festigung der kaiserlichen Macht, der Krönung zum Kaiser in Rom und der Regelung politischer Konflikte, basierend auf dem Konstanzer Vertrag.
Wie unterscheidet sich die mittelalterliche Herrschaft von heutiger Politik?
Während heute Verwaltungen und Minister Aufgaben zentral delegieren, musste der mittelalterliche König persönlich zu Feldzügen und Krisenbesprechungen reisen.
Welche Quellen geben Aufschluss über die Zeit Friedrich Barbarossas?
Zentrale Quellen sind Kaiserurkunden, Diplome, Briefsammlungen sowie die Chronik „Gesta Friderici“ von Bischof Otto von Freising.
Was versteht man unter einem „Itinerar“?
Ein Itinerar ist das Verzeichnis der Reisestationen und Aufenthaltsorte eines Herrschers, das seine Route und die Orte seiner Machtausübung dokumentiert.
Was war der Inhalt des Konstanzer Vertrags?
Der Vertrag von 1153 regelte die Bedingungen für den Italienzug und die Zusammenarbeit zwischen dem Papst und dem König gegen gemeinsame Feinde.
- Quote paper
- Florian Winkler (Author), 2010, Das Fehlen eines festen Regierungssitzes im Hochmittelalter - Konfliktbewältigung der Herrscher , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165031