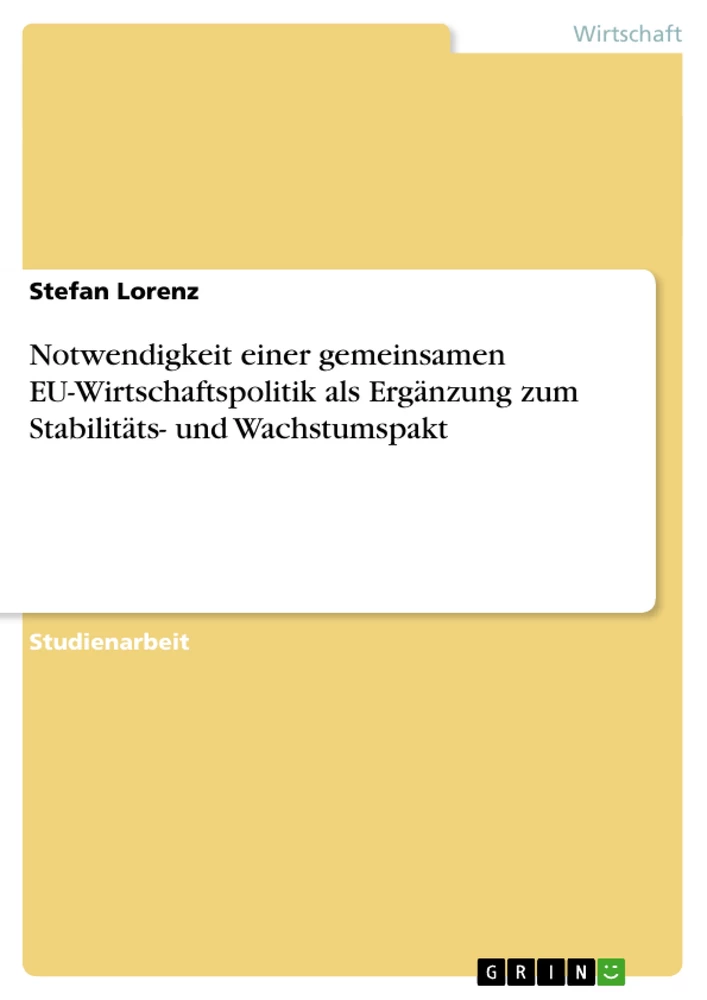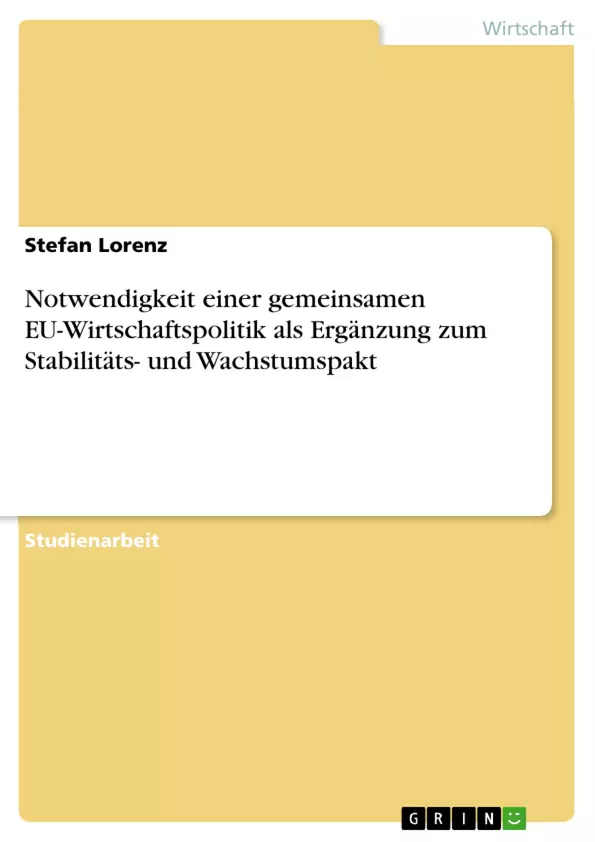Im Frühjahr 2010 waren zahlreiche Staaten der Europäischen Währungsunion (EWU) von einer Schuldenkrise betroffen, die in ihrem vorläufigen Höhepunkt die Schaffung eines 750 Milliarden Euro umfassenden Rettungsfonds erzwang. Ihr zugrunde lagen schwerwiegende Ungleichgewichte innerhalb der Union, die sich in den elf Jahren seit Einführung der Gemeinschaftswährung kontinuierlich verstärkt haben. Während einige Länder ihre Wirtschaft auf Wettbewerbsfähigkeit trimmten und enorme Außenhandelsüberschüsse erzielten, importierten die übrigen Länder das dort angefallene Kapital und häuften so enorme Auslandsschulden auf. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP), dessen Richtlinien allein die öffentliche Verschuldung der Mitgliedsländer betreffen, hat als Korrekturmechanismus für diese Fehlentwicklung versagt und bedarf daher der Reform.
In dieser Arbeit sollen die zur Diskussion stehenden Reformvorschläge des SWP vorgestellt und analysiert werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage nach der Notwendigkeit einer gemeinsamen EU-Wirtschaftspolitik. Im ersten Kapitel sollen Struktur und Funktion des SWP ebenso erläutert werden wie die Aspekte einer koordinierten Fiskalpolitik. Das mittlere Kapitel fasst im ersten Teil die Effekte einer Währungsunion auf die Wirtschaft der Teilnehmerländer aus theoretischer Sicht zusammen und ergänzt im zweiten Teil die empirischen Erkenntnisse nach elf Jahren europäischer Gemeinschaftswährung. Im letzten Kapitel wird die Vielzahl an Reformvorschlägen für den SWP diskutiert und gegeneinander abgewogen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Stabilitäts- und Wachstumspakt
3 Makroökonomische Effekte der Europäischen Währungsunion
3.1 Wechselkurseffekt
3.2 Zinseffekt
3.3 Makroökonomische Ungleichgewichte
4 Reformvorschläge für den Stabilitäts- und Wachstumspakt
5 Zusammenfassung
6 Thesenpapier
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Im Frühjahr 2010 waren zahlreiche Staaten der Europäischen Währungsunion (EWU) von einer Schuldenkrise betroffen, die in ihrem vorläufigen Höhepunkt die Schaffung eines 750 Milliarden Euro umfassenden Rettungsfonds erzwang. Ihr zugrunde lagen schwerwie- gende Ungleichgewichte innerhalb der Union, die sich in den elf Jahren seit Einführung der Gemeinschaftswährung kontinuierlich verstärkt haben. Während einige Länder ihre Wirtschaft auf Wettbewerbsfähigkeit trimmten und enorme Außenhandelsüberschüsse erzielten, importierten die übrigen Länder das dort angefallene Kapital und häuften so enorme Auslandsschulden auf. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP), dessen Richtlinien allein die öffentliche Verschuldung der Mitgliedsländer betreffen, hat als Kor- rekturmechanismus für diese Fehlentwicklung versagt und bedarf daher der Reform.
In dieser Arbeit sollen die zur Diskussion stehenden Reformvorschläge des SWP vor- gestellt und analysiert werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage nach der Notwendigkeit einer gemeinsamen EU-Wirtschaftspolitik. Im ersten Kapitel sollen Struktur und Funktion des SWP ebenso erläutert werden wie die Aspekte ei- ner koordinierten Fiskalpolitik. Das mittlere Kapitel fasst im ersten Teil die Effekte einer Währungsunion auf die Wirtschaft der Teilnehmerländer aus theoretischer Sicht zusammen und ergänzt im zweiten Teil die empirischen Erkenntnisse nach elf Jahren europäischer Gemeinschaftswährung. Im letzten Kapitel wird die Vielzahl an Reform- vorschlägen für den SWP diskutiert und gegeneinander abgewogen.
2 Stabilitäts- und Wachstumspakt
Der EWU liegt eine asymmetrische wirtschaftspolitische Architektur zugrunde. Während die Geldpolitik zentral von der Europäischen Zentralbank (EZB) gesteuert wird, obliegt die Fiskalpolitik dezentral den Regierungen der momentan 16 Mitgliedsländer. Letztere sind dabei dem Vertrag von Maastricht sowie dem SWP unterworfen,1 sind in ihrem Handlungsspielraum also durch eine Reihe von fiskalpolitischen Regeln beschränkt. Laut der wichtigsten dieser Regeln verpflichten sich die Euroländer mittelfristig einen aus- geglichenen Haushalt oder einen Überschuss zu erzielen. Kurzfristige Haushaltsdefizite sind den Mitgliedsländern erlaubt, bei einerÜberschreitung der 3%-Grenze droht jedoch ein Defizitverfahren.2
Obwohl derartige Regeln für die Mitglieder einer Währungsunion eher die Ausnahme darstellen,3 akzeptierten die Teilnehmer der EWU den auf deutschen Vorschlag zurück- gehenden SWP. Damit sollte verhindert werden, dass insbesondere die südeuropäischen Staaten ihre laxe Haushaltdisziplin als Mitglieder der EWU fortführten, und dabei die Kosten dieser Politik auf die übrigen Teilnehmerländer abwälzte. Denn die Fiskalpolitik einzelner Länder zieht in einer Währungsunion Implikationen für die gemeinsame Geld- politik nach sich. Zum einen erhöht fiskalische Expansion den Inflationsdruck, da sie die gesamtwirtschaftliche Nachfrage anheizt. Zum anderen - und dies ist von größerer Bedeu- tung - hat unsolide Fiskalpolitik das Potential, das Vertrauen in stabilitäts-orientierte Geldpolitik zu unterminieren. Permante Budgetdefizite wecken im Markt die Erwar- tung, dass die Staatschuld letztendlich durch Geldschöpfung finanziert wird, wodurch die Inflationserwartung steigt. Artis & Winkler (1998) beschreiben den SWP deshalb als Schutzmechanismus für die Glaubwürdigkeit der EZB, welcher im Vertrag von Maas- tricht weitreichende Unabhängigkeit zugestanden wurde.
Eine Währungsunion intensiviert zudem die als Defizitneigung (“deficit bias”) be- kannte Tendenz zu kurzsichtiger Haushaltspolitik.4 Wie Corsetti & Roubini (1997) zei- gen konnten, erhöht bereits die Fähigkeit einer Regierung, sich zur Schuldenaufnahme ausländischer Kapitalmärkte zu bedienen, deren Defizitneigung. Da in einer Währungs- union zudem noch das Wechselkursrisiko für ausländische Käufer von Staatsanleihen entfällt, sinken tendentiell die vom Markt geforderten Zinsen, was das “deficit bias” weiter erhöhen sollte (Thygesen 1996). Der SWP sollte mit seiner 3%-Grenze daher übermäßige Defizite (“excessive deficits”) unterbinden.
Keynesianische Ökonomen standen dem SWP von Beginn an kritisch gegenüber, da dieser den Spielraum der Fiskalpolitik einschränkt, obwohl sie bei zentralisierter Geldpo- litik das einzige verbliebene Instrument einer Regierung zur Bewältigung asymmetrischer Schocks darstellt (Artis & Winkler 1998). Zudem wiesen sie darauf hin, dass nationale Fiskalpolitik in einer multinationalen Währungsunion einen “beggar-my-neighbour” Ef- fekt zur Folge hat. Anhand eines drei Länder umfassenden Mundell-Fleming Modells5 lässt sich zeigen, dass eine fiskalische Expansion eines Landes der Währungsunion das Einkommen des anderen Landes reduziert (Levin 1983). Die zusätzliche Kapitalnachfra- ge des ersten Landes lässt den gemeinsamen Zinssatz ansteigen, was im anderen Land (bzw. dem Rest der Währungsunion) eine Kontraktion von Investionen und privatem Konsum bewirkt.6 Faini (2006) konnte diesen Effekt für die EWU empirisch nachweisen.
Der von Levin (1983) beschriebene Effekt impliziert die Notwendigkeit einer koordinierten Fiskalpolitik in der EWU. Zahlreiche weitere Studien, etwa Andersen & Sørensen (1995) oder Dixon & Santoni (1997), kommen ebenfalls zu dem Schluss, dass es in einer Währungsunion fiskalpolitischer Koordination bedarf. Eine gemeinsame Wirtschaftspolitik sieht der SWP zwar bislang nicht vor, jedoch steht dies im Zuge der jüngsten Reformbemühungen wieder zur Diskussion.7
Eine Reform bedarf der SWP nicht zuletzt deshalb, weil er nicht verhinderte, dass 2010 einige Euroländer an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gerieten, obwohl die Mehr- zahl derer die Defizitkriterien zuvor nie verletzt hatten. Wie im folgenden Kapitel gezeigt wird, war der SWP unvollständig konzipiert um seine Aufgabe - die Stabilität der Eu rozone zu gewährleisten - zu erfüllen.
3 Makroökonomische Effekte der Europäischen Währungsunion
3.1 Wechselkurseffekt
Neben dem bereits in Kapitel 2 erwähnten Effekt einer Währungsunion auf die Fiskalpo- litik eines einzelnen Mitgliedsstaates hat das System fester Wechselkurse auch Auswir- kungen auf die Gesamtwirtschaft der Länder. Da wären zunächst die mikroökonomischen Effekte für die einzelnen Marktteilnehmer in Form von wegfallenden Unsicherheits-, Konfusions-, Kalkulations- und Transaktionskosten (Krugman & Obstfeld 2009, 750).
Diese werden unter dem Begriff ”monetärerEffizienzgewinn“zusammengefasstundsol len hier nicht weiter erläutert werden. Daneben gibt es einen makroökonomischen Effekt auf den aggregierten Export bzw. Import eines Landes, sowohl in Bezug auf die Länder innerhalb wie auch außerhalb der Währungsunion. Hierfür muss man sich das Zustandekommen von Wechselkursen (in der kurzen Frist) vergegenwärtigen.
In der Theorie steigt (fällt) der Wechselkurs einer Währung, wenn deren angebotene Geldmenge fällt (steigt) oder die Nachfrage nach dieser Währung steigt (fällt). Neh- men wir beispielsweise an, die Nachfrage nach Euro in den USA stiege (aus welchem Grund auch immer) an, so müsste am Devisenmarkt der Dollar-Euro-Wechselkurs E $ / e fallen. Neben anderen Gründen können Importüberschüsse (mehr Importe aus Europa in die USA, als Exporte aus den USA nach Europa) ein Grund für eine zunehmende Euro-Nachfrage in den USA sein. Durch den daraus resultierenden fallenden E $ / e wer- den die Importe (in den USA) jedoch real teurer, bzw. die Exporte real billiger. Freie Wechselkurse wirken demnach unweigerlich einem Ungleichgewicht der Außenhandelsbi- lanz entgegen, wenngleich sie sie auch nicht verhindern, da zahlreiche andere Faktoren die Geldnachfrage und damit die Wechselkurse beeinflussen (siehe Krugman & Obstfeld 2009, 437ff.).
Zwischen den Ländern innerhalb einer Währungsunion tritt dieser Effekt nicht auf, da alle beteiligten Staaten ihre Importe und Exporte mit der gleichen Währung zahlen. Zu den Ländern außerhalb der Währungsunion zeigt der Effekt weiterhin seine Wirkung, wenn auch in abgewandelter Form. Entscheidend sind nun nämlich nicht mehr die Au
Tabelle 1: Intra-EU-Handelssaldo der Euro-Länder (in Mio. e)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eurostat
ßenhandelsbilanzen der einzelnen Ländern, sondern die aggregierte Bilanz der gesamten Union. Ohne weiteres können einzelne Länder der Währungsunion starke Außenhan- delsdefizite aufweisen, ohne dass sich ein Abwertungsdruck auf ihre Währung entfaltet, sofern es innerhalb der Union andere Länder gibt, deren Außenhandelsüberschüsse diese Defizite ausgleichen, so dass sie sich zu einer ausgeglichenen Gesamtaußenhandelsbilanz der Union summieren.
In der Tat bestätigt die bisherige Bilanz der EWU diese Annahme sehr deutlich. Während die Gesamtbilanz des Euro-Raums seit seiner Gründung im Jahr 1999 im Durchschnitt nahezu ausgeglichen war (Gräf & Schneider 2010), zeigen sich mit Blick auf einzelne Mitgliedsländer enorme Ungleichgewichte. Zudem verstärkten sich diese Fehlentwicklungen über die Jahre, in beide Richtungen (wie aus Tabelle 1 ersichtlich). Im Jahr 2008 etwa reichte die Spanne von einem Defizit von fast 15% in Griechenland und fast 10% in Spanien bis zu einem Überschuss von knapp über 6% in Deutschland.
3.2 Zinseffekt
Während der oben beschriebene Wechselkurseffekt keine Triebfeder für bestimmte Ent- wicklungen ist, sondern allenfalls bestehende Tendenzen verstärkt, existiert innerhalb
[...]
1 Da der ursprünglich von Deutschland stammende Vorschlag, den SWP als eigenen europäischen Vertrag zu verabschieden, verworfen wurde, besteht der SWP aus drei Teilen: der European Council Resolution 97/C 236/01, die die Konvergenzkriterien beinhaltet, sowie den beiden European Council Regulations No. 1466/97 und 1467/97, die das Defizitverfahren definiert (Artis & Winkler 1998).
2 Die genauen Regeln dieses Verfahrens, das 2005 auf Betreiben Deutschlands und Frankreichs geändert wurde, sollen hier nicht weiter erläutert werden (dazu siehe Artis & Winkler 1998, sowie Europäische Zentralbank 2005).
3 Wie Von Hagen & Eichengreen (1996) ausführen, gibt es in kaum einer Währungsunion vergleichbare Ober grenzen für staatliche Verschuldung. Sie resümieren “fiscal restraints are the exception rather than the rule in monetary unions.”
4 Aufgrund der vergleichsweise kurzen Legislaturperioden neigen Politiker und die ihnen unterstellten Bürokraten dazu, mehr auszugeben als sie an Steuern einnehmen. Modelltheoretisch bedeutet dies schlicht, dass die Regierung ihren heute schuldenfinanzierten Mehrausgaben eine zukünftige Rendite beimisst, die über dem Kapitalmarktzins liegt (Milesi-Ferretti 2003).
5 Das Modell von Levin (1983) beinhaltet eine zwei Länder umfassende Währungsunion, deren Gemeinschaftswährung zu einem dritten Land (welches symbolisch für die restliche Welt steht) in flexiblem Wechselkurs steht. Für ein erweitertes Modell siehe Huart (2002).
6 Genau genommen gibt es sowohl positive wie auch negative “spill-over”-Effekte in diesem Modell: zum einen wirkt sich die Zinssteigerung negativ, zum anderen aber die erhöhte Nachfrage im expandierenden Land positiv auf die Wirtschaft des anderen Landes aus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text befasst sich mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) der Europäischen Währungsunion (EWU), seinen Mängeln und Reformvorschlägen, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit einer gemeinsamen EU-Wirtschaftspolitik.
Was sind die Hauptpunkte der Einleitung?
Die Einleitung beschreibt die Schuldenkrise in der EWU im Jahr 2010, die durch Ungleichgewichte innerhalb der Union verursacht wurde. Der SWP hat als Korrekturmechanismus versagt, was eine Reform erforderlich macht. Die Arbeit wird Reformvorschläge des SWP vorstellen und analysieren, wobei der Schwerpunkt auf der Notwendigkeit einer gemeinsamen EU-Wirtschaftspolitik liegt.
Welche Regeln und Verpflichtungen beinhaltet der Stabilitäts- und Wachstumspakt?
Der SWP verpflichtet die Euroländer mittelfristig, einen ausgeglichenen Haushalt oder einen Überschuss zu erzielen. Kurzfristige Haushaltsdefizite sind erlaubt, aber bei Überschreitung der 3%-Grenze droht ein Defizitverfahren.
Warum wurde der SWP eingeführt?
Der SWP sollte verhindern, dass südeuropäische Staaten ihre laxe Haushaltsdisziplin fortsetzen und die Kosten auf die übrigen Teilnehmerländer abwälzen. Er dient auch als Schutzmechanismus für die Glaubwürdigkeit der EZB.
Welche Kritikpunkte gibt es am SWP?
Keynesianische Ökonomen kritisieren, dass der SWP den Spielraum der Fiskalpolitik einschränkt und "beggar-my-neighbour"-Effekte verursacht. Nationale Fiskalpolitik kann negative Auswirkungen auf andere Länder der Währungsunion haben.
Warum bedarf der SWP einer Reform?
Der SWP hat nicht verhindert, dass einige Euroländer 2010 an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gerieten, obwohl die Mehrzahl derer die Defizitkriterien zuvor nie verletzt hatten.
Welche makroökonomischen Effekte hat die Europäische Währungsunion?
Die EWU hat einen Wechselkurseffekt, bei dem Ungleichgewichte in den Außenhandelsbilanzen einzelner Länder nicht automatisch durch Wechselkursanpassungen ausgeglichen werden. Zudem gibt es einen Zinseffekt, der innerhalb der Währungsunion anders wirkt.
Was ist der Wechselkurseffekt in der EWU?
Innerhalb der EWU entfällt der automatische Ausgleich von Außenhandelsungleichgewichten durch Wechselkursanpassungen. Einzelne Länder können Defizite aufweisen, solange andere Länder Überschüsse generieren, die die Gesamtbilanz der Union ausgleichen.
Welche Rolle spielt die Fiskalpolitik in der Europäischen Währungsunion?
Die Fiskalpolitik wird dezentral von den Regierungen der Mitgliedsländer gesteuert, ist aber durch den Vertrag von Maastricht und den SWP eingeschränkt. Eine koordinierte Fiskalpolitik könnte notwendig sein, um negative "spill-over"-Effekte zu vermeiden.
- Quote paper
- Stefan Lorenz (Author), 2010, Notwendigkeit einer gemeinsamen EU-Wirtschaftspolitik als Ergänzung zum Stabilitäts- und Wachstumspakt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165083