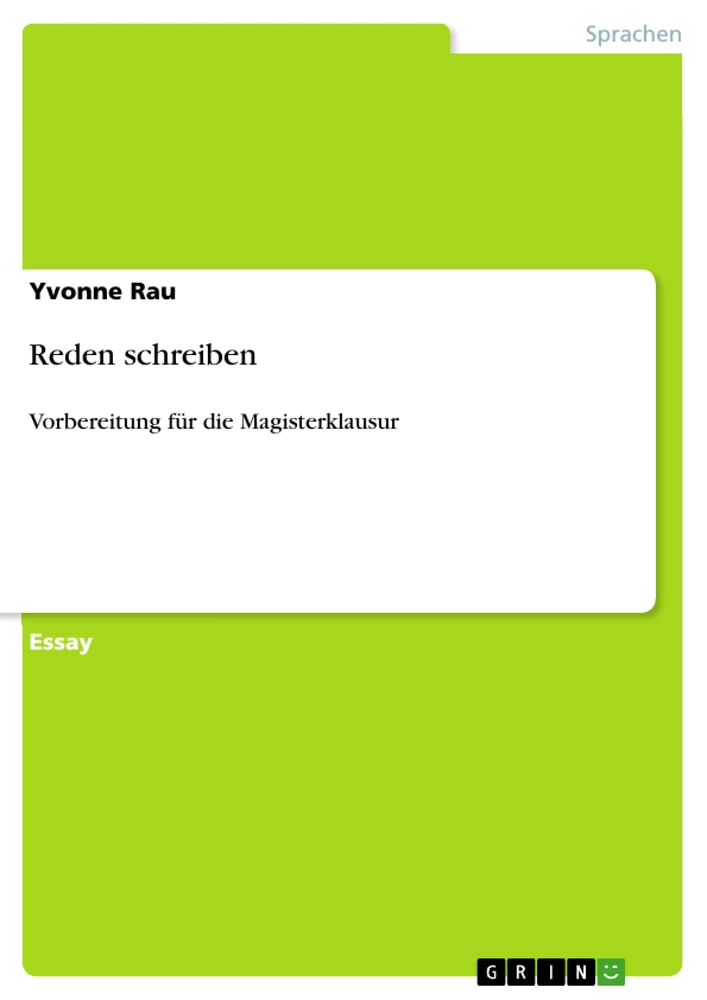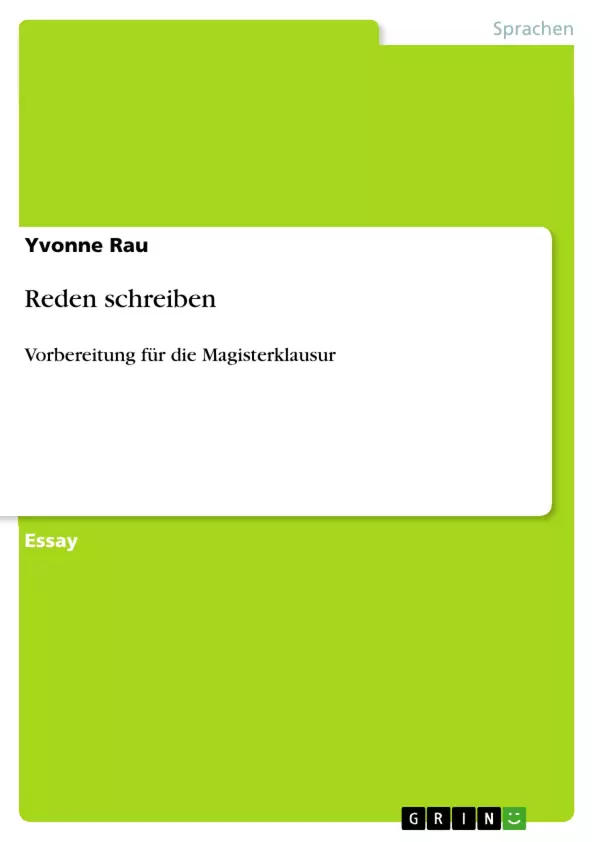Redenschreiben und Redenhalten ist für viele Menschen erst einmal ein eng miteinander zusammenhängendes Konstrukt. Hört ein ganz normaler Bürger zu Zeiten des Wahlkampfs zu Hause am Bildschirm die Rede eines Politikers, dann versteht er diese Rede als Werk dieses einen Politikers. Stillschweigend wird unterstellt ohne es auch nur einmal in Frage zu stellen, dass der Politiker seine Rede selbst verfasst und im Wahlkampf vorgetragen hat.
Wäre das so, stünden die Produktion und die Performanz wirklich eng miteinander in Verbindung, weil sie von ein und derselben Person für einen bestimmten Zweck eingesetzt werden würden.
[...]
Das Verhältnis zwischen Redenschreiber, den ich im Folgenden auch mit dem Ausdruck Sekundärorator bezeichnen möchte, und dem Redner und Auftraggeber in der Rolle als Primärorator scheint also auf den ersten Blick klar differenziert. Aber die Problematiken, Widerstände und Arbeitsschritte bei der fremdorientierten Produktion einer Rede sind komplexer als man denkt.
Ein Redenschreiber muss vieles leisten. Wie sieht also die Zusammenarbeit von Primär- und Sekundärorator in Theorie und Praxis aus? Im Folgenden will ich Überlegungen zu dieser Zusammenarbeit in Hinblick auf Probleme und Wechselwirkungen anbringen.
Hierbei möchte ich mich an den einzelnen Produktionsstadien, angefangen beim Briefing über den Schreibprozess bis hin zum Vortrag, orientieren und dabei beachten, welche Rolle jeweils der Primär- und der Sekundärorator hierbei spielen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Primär- und Sekundärorator
- Produktionsablauf und Widerstände
- Setting-Analyse
- „Inventio“
- „Dispositio“
- „Elocutio“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text analysiert die Zusammenarbeit zwischen Redner und Redenschreiber im Kontext der Redeproduktion. Der Fokus liegt dabei auf den Herausforderungen und Wechselwirkungen, die im Prozess der fremdorientierten Redegestaltung auftreten.
- Die Rolle des Redenschreibers als Stratege und Denker
- Die Berücksichtigung von Kalkülen wie Adressaten-, Situations- und Medienkalkül
- Die Herausforderungen der „intellectio“, „inventio“, „dispositio“ und „elocutio“
- Die Bedeutung der Angemessenheit der Sprache für Redner und Publikum
- Die Notwendigkeit, mediale Widerstände und Präsenzentfremdung zu berücksichtigen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text stellt die enge Verbindung zwischen Redenschreiben und Redenhalten in Frage, indem er auf die Existenz von professionellen Redenschreibern hinweist. Er beleuchtet die historische Entwicklung des Berufsbildes und zeigt die Herausforderungen auf, die aus der Entfremdung zwischen dem Redenschreiber und dem Redner entstehen.
Primär- und Sekundärorator
Der Text definiert die Rollen von Primär- und Sekundärorator und beschreibt, wie die Zusammenarbeit zwischen Redner und Redenschreiber in der Theorie und Praxis abläuft. Er betont die strategische Rolle des Redenschreibers und die Notwendigkeit, verschiedene Kalküle bei der Redeproduktion anzuwenden.
Produktionsablauf und Widerstände
Setting-Analyse
Der Text erläutert die Bedeutung der Setting-Analyse, die wichtige Informationen über den Ort, die Dauer und den Anlass der Rede liefert. Er hebt die Bedeutung von situativen Widerständen und deren Auswirkungen auf die Gestaltung der Rede hervor.
„Inventio“
Der Text analysiert die „inventio“ und die Notwendigkeit, das innere und äußere Aptum des Redners zu berücksichtigen. Er betont die medialen Widerstände, insbesondere den Redner selbst, dessen Rolle, Individualität und Sprache.
„Dispositio“
Der Text beleuchtet die „dispositio“ und die Schwierigkeiten, einen Text so zu konstruieren, dass alle gegenseitigen Abhängigkeiten innerhalb des Konstrukts „Text“ berücksichtigt werden. Er betont die Notwendigkeit, sich so klar und deutlich wie möglich auszudrücken, um einen sprachlichen und geistigen Konsens mit dem Publikum zu erreichen.
„Elocutio“
Der Text behandelt die „elocutio“ und die Bedeutung der verbalen Enkodierung. Er betont die Notwendigkeit, die Sprache sowohl für das Publikum als auch für den Redner angemessen zu gestalten und den Unterschied zwischen Sprech- und Schriftsprache zu berücksichtigen.
Schlüsselwörter
Redenschreiben, Rhetorik, Primärorator, Sekundärorator, Kalkül, Adressatenkalkül, Situationskalkül, Medienkalkül, Setting-Analyse, „intellectio“, „inventio“, „dispositio“, „elocutio“, mediale Widerstände, Präsenzentfremdung, Sprechsprache, Schriftsprache, Gattung, Gattungsbruch, Aptum.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem Primär- und einem Sekundärorator?
Der Primärorator ist der Redner selbst (z. B. ein Politiker), während der Sekundärorator der professionelle Redenschreiber ist, der den Text verfasst.
Was bedeutet „Aptum“ in der Rhetorik?
Aptum bezeichnet die Angemessenheit einer Rede in Bezug auf den Redner, das Publikum und die Situation.
Welche Phasen durchläuft die Produktion einer Rede?
Die klassischen Stadien sind Intellectio (Analyse), Inventio (Stoffsammlung), Dispositio (Gliederung) und Elocutio (sprachliche Ausgestaltung).
Warum ist die Setting-Analyse so wichtig?
Sie liefert Informationen über Ort, Dauer und Anlass der Rede, um situative Widerstände frühzeitig zu berücksichtigen.
Was ist der Unterschied zwischen Sprech- und Schriftsprache?
Eine Rede muss für den mündlichen Vortrag konzipiert sein (Sprechsprache), was sich in Satzbau und Wortwahl deutlich von geschriebenen Texten unterscheidet.
- Arbeit zitieren
- Yvonne Rau (Autor:in), 2009, Reden schreiben, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165095