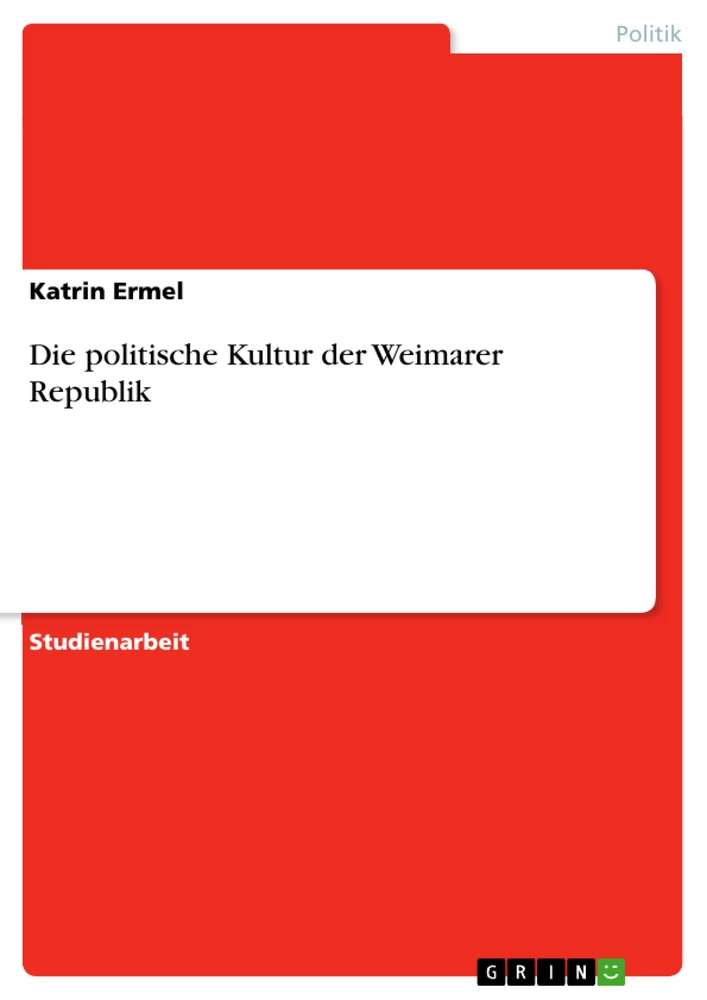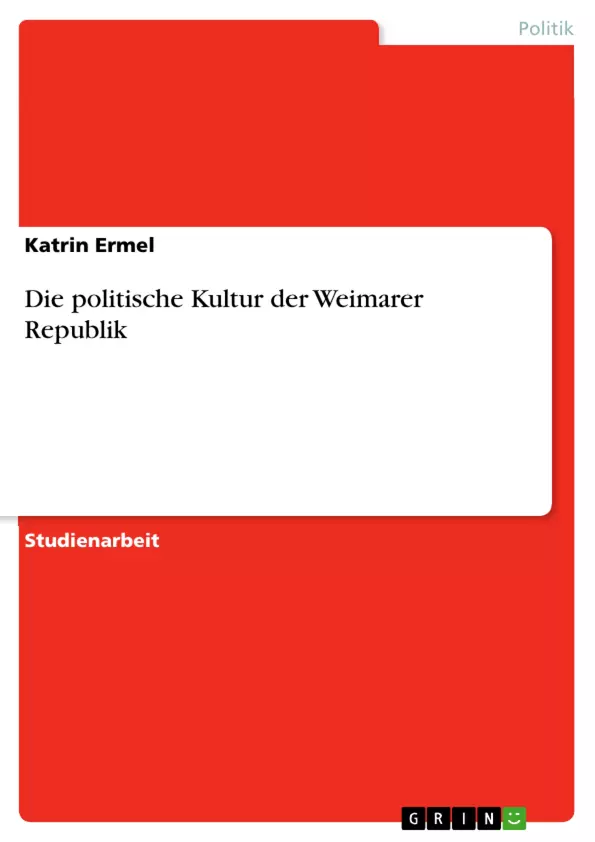"Aber man kann und will sich sein Vaterland nicht aussuchen.
Es gehört zum Schicksal, zur Aufgabe!"
Ernst Jünger(1895-1998)
1918 – die Wirren des ersten Weltkriegs sind vorbei. Nach vier Jahren Kampf lautet die Bilanz für das Deutsche Reich: Besiegt, geschmäht, geschändet – Fassungslosigkeit im Volk, Verrat an der Front, auf ewig gedemütigt in Versailles. Eine Nation geprägt vom Stolz auf ihr Vaterland, repräsentiert durch den glanzvollen Kaiser Wilhelm II. mit seinem an Führungsstärke und Verkörperung deutscher Tugenden kaum zu überbietenden Reichskanzler Otto von Bismarck, versinkt in ihrem Schicksal.
Es gibt zwei Arten von Veränderungen. Jene, welche wir einfach hinnehmen und uns anpassen, flexibel, stillschweigend und es gibt richtungsweisende Meilensteine. Erlebnisse, Erfahrungen, Erkenntnisse, welche prägend für unser gesamtes Leben sein können. Bei denen wir sogar um Adaption ringen müssen, um nicht an innerer Zerrissenheit zugrunde zu gehen. Veränderungen, die uns vor die Aufgabe stellen, die Wandlungen anzunehmen und Neues zu erschaffen. Voranzuschreiten und nicht vergangenheitsverliebt zu stagnieren. So wie auch jeder Mensch seine Flexibilität stets neu beweisen muss, unterliegt auch die politische Kultur dieser Dynamik. Der Begriff selbst versucht all jene bewusst und latent vorhandenen Einstellungen und Verhaltensmuster zu bündeln, die im Raum des politischen Systems existieren. Ist also die politische Kultur der Stoff, welcher die nationale Welt im Innersten zusammenhält? Unter diesem Gesichtspunkt soll die vorliegende Arbeit einen Überblick über die politische Kultur der Weimarer Republik darstellen, wobei stets der Gedanke im Hinterkopf behalten werden muss: Wie „arbeiten“ die einzelnen Denk- und Verhaltensweisen, wie steuern sie das Kollektiv und wie wirkt dieses auf das System Weimars.
Inhaltsverzeichnis
- Die Weimarer Republik im Kontext analytischer Betrachtungen
- Forschungsstand
- Historische Hintergrundinformationen
- Politische Kultur – eine Definition
- Milieus in der Weimarer Republik
- Die Kommunisten
- Die Sozialdemokraten
- Die Linksintellektuellen
- Gesinnungsliberalismus
- Politischer Katholizismus
- Das national-rechte Lager
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der politischen Kultur der Weimarer Republik. Sie will die zentralen Einstellungen und Verhaltensmuster, die im politischen System Weimars existierten, untersuchen und erörtern, wie diese die nationale Welt im Innersten zusammenhielten. Dabei wird besonders auf die Rolle der einzelnen Denk- und Verhaltensweisen sowie ihre Steuerung des Kollektivs und ihre Wirkung auf das System Weimars eingegangen.
- Der Einfluss des Ersten Weltkriegs auf die politische Kultur der Weimarer Republik
- Der Gegensatz zwischen Tradition und Moderne in der Weimarer Zeit
- Die Fragmentierung der politischen Kultur Deutschlands seit dem 19. Jahrhundert
- Das „Dreilagersystem“ der politischen Kultur der Weimarer Republik (Sozialdemokratie, Katholizismus, nationales Lager)
- Die gesellschaftliche und politische Dimension der Krise der Weimarer Republik
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel befasst sich mit dem Forschungsstand zur politischen Kultur der Weimarer Republik und analysiert verschiedene Interpretationsmuster und Denkschulen. Es untersucht den Einfluss des Ersten Weltkriegs auf die Weimarer Kultur und den Gegensatz zwischen „westlichen“ Werten und dem „Deutschen Sonderweg“, der von national-völkischem Gedankengut geprägt war.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die historischen Hintergründe der Weimarer Republik, beginnend mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Novemberrevolution. Es beschreibt den Übergang von der konstitutionellen Monarchie zur parlamentarischen Republik und die Herausforderungen, die die junge Demokratie im Angesicht von Kriegsermüdung, Versorgungsschwierigkeiten und politischer Instabilität zu bewältigen hatte.
- Das dritte Kapitel geht auf die verschiedenen Milieus der Weimarer Republik ein, darunter die Kommunisten, die Sozialdemokraten, die Linksintellektuellen, der Gesinnungsliberalismus, der politische Katholizismus und das national-rechte Lager. Es analysiert die Denkweisen und Ziele dieser Milieus und deren Einfluss auf die politische Kultur der Weimarer Republik.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind: politische Kultur, Weimarer Republik, Erster Weltkrieg, Tradition und Moderne, Fragmentierung, „Dreilagersystem“, sozialmoralisches Milieu, nationale Welt, Denk- und Verhaltensweisen, Kollektiv, System Weimars. Die Arbeit untersucht die politischen und gesellschaftlichen Prozesse und Entwicklungen der Weimarer Republik, wobei sie besonders auf die Rolle der politischen Kultur und ihre Einflussfaktoren eingeht.
- Quote paper
- Katrin Ermel (Author), 2010, Die politische Kultur der Weimarer Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165144