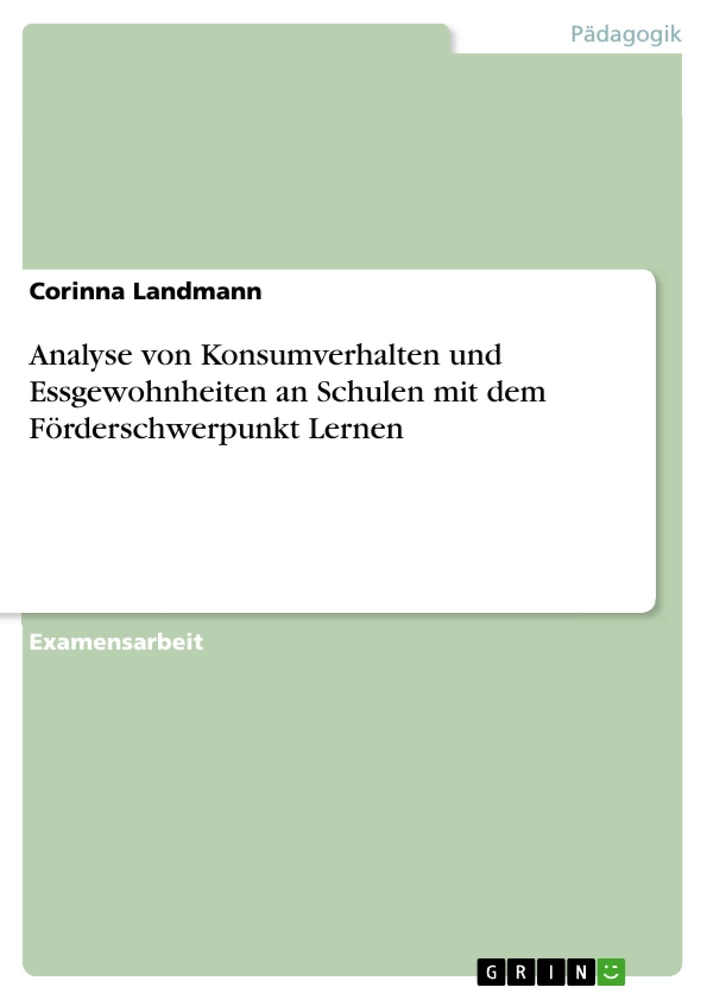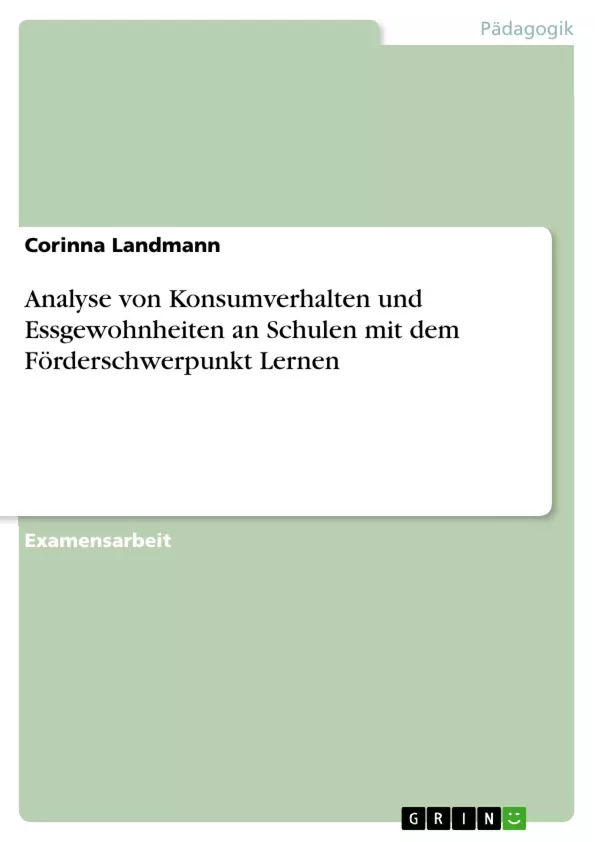Dem Thema Ernährung kommt ein immer größerer Stellenwert zu, der
zusätzlich durch den Wandel gesellschaftlicher Umstände beeinflusst wird.
Wie bei den Erwachsenen ist das Ernährungsverhalten von Kindern auch
durch einen zu hohen Fett-, Zucker- und Proteinanteil geprägt. Dafür
mangelt es an der Aufnahme von Ballaststoffen und der empfohlenen
Flüssigkeitsmenge (vgl. GROOT-BÖHLHOFF; FARHADI, 2007: 19). Laut
KIGGS STUDIE (2006) sind 15% der 3-17 Jährigen übergewichtig1, davon
leiden 6,3% an Adipositas2. Vor allem bei sozial benachteiligten Familien
besteht eine hohe Prävalenz für Übergewicht und eine ungesündere
Ernährung. Daraus ist zu schließen, dass auch im Gesundheits- und
Ernährungsbereich die unterschiedlichen sozioökonomischen
Bedingungen die Sozialisation der Kinder, d.h. ihre Erziehung und ihren
Umgang mit der sozialen sowie Warenumwelt, beeinflussen.
Der Supermarkt ist ein Schlaraffenland. Kinder wachsen in eine
Gesellschaft, die ihnen suggeriert, dass Konsumgüter das „schnelle
Glück“ bringen und dass Liebe und Anerkennung „zu kaufen und zu
schmecken“ sind. Sie lernen, dass ihre Grundbedürfnisse durch Konsum
befriedigt werden können. Die durchgängige Verfügbarkeit kann aber auch
zu einer allgegenwärtigen Verführung werden, mit der wir lernen müssen
umzugehen (vgl. METHFESSEL, 2007: 378f.). Daher rangiert auch sofortige
Bedürfnisbefriedigung vor zeitaufwendiger traditioneller Speisenzubereitung.
Wir wollen minimalen Zeitaufwand bei der Zubereitung und
einen geringen Preis für gute Qualität (vgl. MARTELL, 2010). Der
Stellenwert der Discounter und Convenience-Produkte steigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Theoretische Grundlagen
- Soziale Aspekte der Ernährung
- Schichtzugehörigkeit und Förderschulbesuch
- Definition soziale Schicht
- Merkmale von Unterschichtzugehörigkeit
- Schichtzugehörigkeit und Besuch der Förderschule mit Schwerpunkt Lernen
- Einfluss des sozioökonomischen Status auf Gesundheit und Ernährung
- Schichtspezifische Ernährung
- Schichtspezifisches Gesundheitsverhalten
- Ursachen schichtspezifischer Ernährung
- Gutes Essen eine Frage des Geldes?
- Relevanz des Themas Ernährung für die Förderschule
- Essverhalten, -gewohnheiten und -präferenzen
- Entstehung von Essverhalten und -präferenzen bei Säuglingen und Kleinkindern
- Primär- und Sekundärbedürfnisse
- Gewöhnungseffekt
- Geschmackspräferenzen
- Grenzen rationaler Ernährungserziehung
- Essverhalten und -gewohnheiten
- Drei-Komponenten-Modell
- Verhaltenskontinuität
- Einflüsse der Familie auf das Ernährungsverhalten
- Nahrungspräferenzen
- Allgemeine Prinzipien
- Motive der Lebensmittelwahl
- Essalltag in Familien
- Mahlzeiten
- Die soziale Institution Mahlzeit
- Stellenwert des Essens
- Gemeinsame Mahlzeiten vs. entstrukturierte Tagesabläufe
- Frühstück
- Mittagessen
- Abendessen
- Zwischenmahlzeiten
- Außerhäuslicher Verzehr
- Ernährungsarbeit
- Vor- und Zubereitung
- Vorratshaltung
- Einkaufen
- Ernährungskompetenzen und -wissen
- Ernährungskompetenzen
- Ernährungswissen
- Vermittlung von Ernährungskompetenzen und -wissen
- Konsum
- Käuferverhalten allgemein
- Kaufprozesse
- Externe Einflussfaktoren auf das Konsumverhalten
- Das Kind als Konsument
- Einfluss von Fernsehen und Werbung
- Trends beim Konsum
- Der Billligtrend
- Der Preis ist nicht alles
- Markenprodukte vs. Eigenmarken
- Die Probleme des Überflusses
- Trends hinsichtlich Lebensmittelgruppen
- Regionale Produkte
- Bio-Lebensmittel
- Functional Food
- Convenience Produkte
- Fleisch
- Auswirkungen des soziodemographischen Wandels auf Essgewohnheiten und Konsumverhalten
- Alterung der Gesellschaft
- Steigende Frauenerwerbstätigkeit
- Pluralismus der Haushalts- und Familienformen
- Zunehmende Polarisierung zwischen Arm und Reich
- II. Empirische Untersuchung
- Fragestellung
- Ziel
- Hypothesen
- Methodisches Vorgehen
- Verwendete Tests
- Interview
- Tagesprotokoll über meine Essgewohnheiten
- Beobachtungsbogen
- Stichprobenbeschreibung
- Schulen
- Klassenstufe
- Befragte Familien
- Mögliche Probleme
- Untersuchungsdurchführung
- Ergebnisse
- Aufgetretene Probleme
- Tagesprotokoll über meine Essgewohnheiten
- Frühstück vor der Schule
- Frühstück in der Schule
- Mittagessen
- Zwischenmahlzeit
- Abendessen
- Nach dem Abendessen
- Warme Mahlzeiten
- Zusammenhang zwischen den Speisen und den dabei anwesenden Personen
- Frühstück vor der Schule und in der Schule
- Mahlzeitenrhythmus
- Vergleich zwischen Lauterecken und Landau
- Beobachtungsbogen
- Überprüfung der Hypothesen
- Interpretation
- Mahlzeiten
- Beköstigungspraktiken und familiäre Prägung
- Einkauf und Konsum
- III. Schlussfolgerung
- Fördermöglichkeiten
- in der Schule allgemein
- Frühstück
- Verpflegungsangebot in der Schule
- Das Fach Arbeitslehre
- Verbraucherbildung
- in der Ganztagsschule
- durch Elternarbeit
- Grenzen der schulischen Ernährungsbildung
- Zusammenfassung
- Soziale Schicht und ihre Auswirkungen auf Konsumverhalten und Essgewohnheiten
- Der Einfluss des sozioökonomischen Status auf Gesundheit und Ernährung
- Die Relevanz des Themas Ernährung für die Förderschule
- Die Entstehung und Prägung von Essverhalten und -präferenzen in frühen Lebensjahren
- Die Rolle von Familie und Schule bei der Gestaltung von Ernährungsgewohnheiten
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Konsumverhalten und Essgewohnheiten an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen ein und stellt die Relevanz des Themas dar.
- Kapitel 2: Soziale Aspekte der Ernährung: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der sozialen Schicht und ihrer Einflussfaktoren auf Konsumverhalten und Ernährungsgewohnheiten. Es betrachtet die Beziehung zwischen Schichtzugehörigkeit und Förderschulbesuch sowie die Auswirkungen des sozioökonomischen Status auf Gesundheit und Ernährung. Darüber hinaus wird die Relevanz des Themas Ernährung für die Förderschule diskutiert.
- Kapitel 3: Essverhalten, -gewohnheiten und -präferenzen: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung von Essverhalten und -präferenzen bei Säuglingen und Kleinkindern sowie die verschiedenen Einflussfaktoren, die sich auf diese Entwicklung auswirken. Es beleuchtet das Drei-Komponenten-Modell des Essverhaltens und die Rolle von Familie und Umwelt in der Prägung von Essgewohnheiten.
- Kapitel 4: Essalltag in Familien: In diesem Kapitel wird der Fokus auf die Mahlzeiten in Familien gelegt. Es analysiert die soziale Institution Mahlzeit, ihren Stellenwert und die Bedeutung von gemeinsamen Mahlzeiten im Vergleich zu entstrukturierten Tagesabläufen. Außerdem werden die Bereiche Ernährungsarbeit und Ernährungskompetenzen in Familien untersucht.
- Kapitel 5: Konsum: Dieses Kapitel widmet sich dem Käuferverhalten allgemein und betrachtet die verschiedenen Einflussfaktoren, die das Konsumverhalten prägen. Es untersucht Trends beim Konsum, wie den Billligtrend, Markenprodukte vs. Eigenmarken und die Probleme des Überflusses. Darüber hinaus werden Trends hinsichtlich verschiedener Lebensmittelgruppen beleuchtet.
- Kapitel 6: Auswirkungen des soziodemographischen Wandels auf Essgewohnheiten und Konsumverhalten: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des soziodemographischen Wandels auf die Ernährungsgewohnheiten und das Konsumverhalten. Es betrachtet die Alterung der Gesellschaft, die steigende Frauenerwerbstätigkeit, den Pluralismus der Haushalts- und Familienformen sowie die zunehmende Polarisierung zwischen Arm und Reich.
- Kapitel 7: Fragestellung: In diesem Kapitel wird die Fragestellung der empirischen Untersuchung vorgestellt, die sich mit dem Konsumverhalten und den Essgewohnheiten von Schülerinnen und Schülern an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen beschäftigt.
- Kapitel 8: Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Vorgehensweisen der empirischen Untersuchung. Es stellt die verwendeten Tests, die Stichprobenbeschreibung und die Untersuchungsdurchführung vor.
- Kapitel 9: Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es beinhaltet die Analyse der Daten, die durch die verwendeten Tests gewonnen wurden.
- Kapitel 10: Interpretation: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung interpretiert und in den Kontext der theoretischen Grundlagen eingeordnet.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Analyse von Konsumverhalten und Essgewohnheiten an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Das Hauptziel ist es, die Ernährungsgewohnheiten und Konsummuster von Schülerinnen und Schülern an diesen Schulen zu untersuchen und die Einflüsse von sozialen und sozioökonomischen Faktoren auf diese Aspekte zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser wissenschaftlichen Arbeit sind: Konsumverhalten, Essgewohnheiten, Förderschule, Lernbehinderung, sozioökonomischer Status, soziale Schicht, Ernährung, Gesundheit, Familie, Schule, Mahlzeit, Kaufprozesse, Trends, Lebensmittelgruppen, soziodemographischer Wandel.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es einen Zusammenhang zwischen sozialer Schicht und Ernährung?
Ja, Studien zeigen, dass in sozial benachteiligten Familien eine höhere Prävalenz für Übergewicht und eine ungesündere Ernährung (viel Fett und Zucker) besteht.
Warum ist das Thema Ernährung an Förderschulen besonders relevant?
Viele Schüler an Förderschulen mit Schwerpunkt Lernen kommen aus sozioökonomisch schwächeren Verhältnissen, was oft mit einem Mangel an Ernährungswissen einhergeht.
Wie beeinflussen Familien das Essverhalten ihrer Kinder?
Die Familie prägt durch Vorbildfunktion, gemeinsame Mahlzeiten oder deren Fehlen sowie durch die Verfügbarkeit bestimmter Lebensmittel die lebenslangen Essgewohnheiten.
Welche Rolle spielen Convenience-Produkte im Alltag?
Aufgrund von Zeitmangel und geringen Kosten steigt der Stellenwert von Fertigprodukten, was oft zu Lasten der Qualität und der Nährstoffzusammensetzung geht.
Wie kann die Schule die Ernährungskompetenz fördern?
Durch praktischen Unterricht in Arbeitslehre, gesundes Schulfrühstück und gezielte Elternarbeit kann die Schule Defizite in der Ernährungsbildung ausgleichen.
- Quote paper
- Corinna Landmann (Author), 2010, Analyse von Konsumverhalten und Essgewohnheiten an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165150