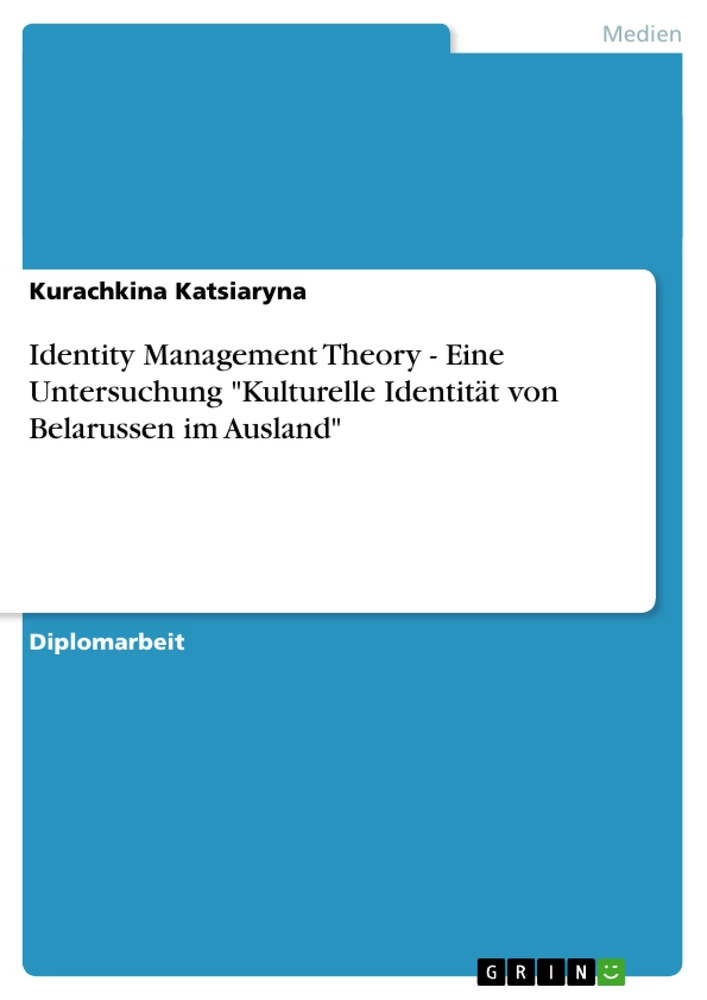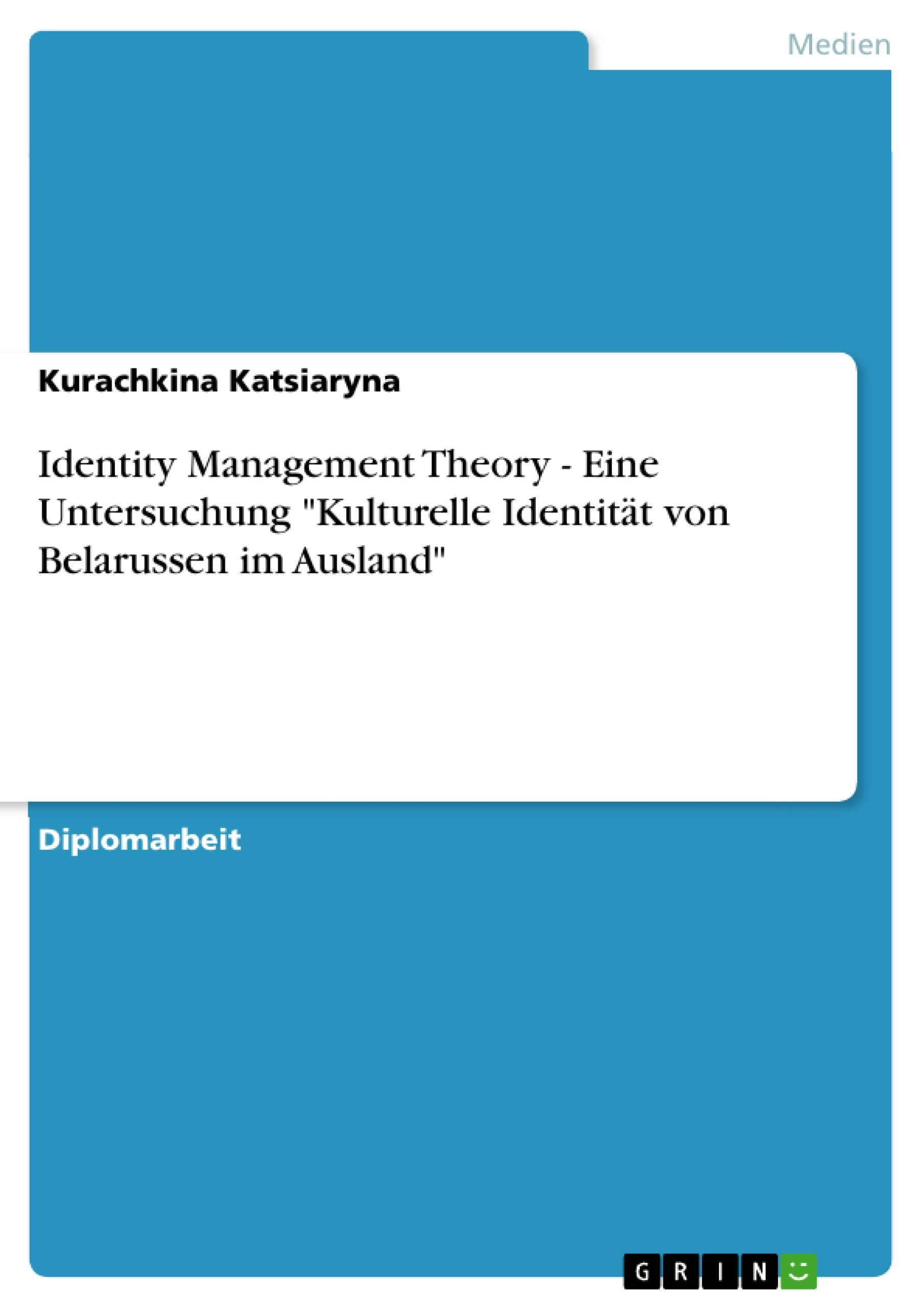Der erste – der theoretische – Teil stellt zentrale Begriffe der Interkulturellen Kommunikation sowie identitätsbezogene Theorien aus der Soziologie und der Interkulturellen Kommunikation vor (Kapitel 1). Diesen folgt die Beschreibung der Theorien aus der Kommunikationswissenschaft und der Mikrosoziologie, nämlich der Griceschen Theorie der so genannten konversationalen Implikaturen und seinen Konversationsmaximen, des von Goffman entworfene Konzepts „Gesicht“ (face) und des Höflichkeitsmodells von Brown und Levinson (Kapitel 2). Diese Theorien sind die Vorläufer und die Bausteine der Identity Management Theory (IMT) von Cupach und Imahori (Kapitel 3), die die theoretische Grundlage für den zweiten – den praktischen – Teil der Arbeit darstellt. In diesem Teil werden die Methodologie und die Hypothese der eigenen Untersuchung präsentiert sowie speziell die Studie Imahoris aus dem Jahr 2002, in Anlehnung an welche die eigene Untersuchung konzipiert wurde (Kapitel 4). Weiterhin folgen die Beschreibung des Ablaufs der Untersuchung und die Ergebnisanalyse (Kapitel 5). Im Schlusswort werden die Grundgedanken zusammengefasst und die Ergebnisse der Untersuchung sowie deren persönliche Einschätzung dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- TEIL I: THEORETISCHER TEIL
- 0 Einleitung
- 1 Zentrale Begriffe
- 1.1 Interkulturelle Kommunikation, Kultur, Interkulturalität
- 1.2 Kommunikation und Interaktion
- 1.3 Identität in der Interkulturellen Kommunikation
- 2 Die Bausteine der Identity Management Theory (IMT)
- 2.1 Konversationale Implikaturen, Kooperationsprinzip und Konversationsmaximen von Grice
- 2.2 Das Gesichtskonzept von Goffman
- 2.3 Höflichkeitsmodell von Brown und Levinson
- 2.3.1 Theoretische Einbettung Gricescher Theorie
- 2.3.2 Theoretische Einbettung Goffmanscher Theorie
- 2.3.3 Strategien zur Wahrung des Gesichts (Gesichtsarbeit)
- 2.3.4 Mögliche Kritikpunkte in Bezug auf Interkulturalität
- 3 Identity Management Theory (IMT)
- 3.1 Identität und Gesicht
- 3.2 Theoretische Annahmen der IMT
- TEIL II: PRAKTISCHER TEIL
- 4 Methodologische Grundlagen
- 4.1 Problemstellung
- 4.2 Untersuchungsmethode
- 4.3 Imahoris Studie „Facework Strategies for Intercultural Identity Management“ (2002)
- 5 Untersuchung „Kulturelle Identität von Belarussen im Ausland“
- 5.1 Hypothese
- 5.2 Auswahl der Teilnehmer
- 5.3 Gestaltung des Fragebogens
- 5.4 Ergebnisanalyse
- 6 Schlusswort
- 6.1 Zusammenfassung
- 6.2 Persönliche Einschätzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Frage der kulturellen Identität von Belarussen im Ausland, insbesondere im Kontext der Interkulturellen Kommunikation. Die Arbeit untersucht, wie Belarussen, die in einem neuen Kulturkreis leben, ihre Identität bewahren und gleichzeitig mit der neuen Kultur umgehen. Dazu werden zentrale Begriffe der Interkulturellen Kommunikation sowie identitätsbezogene Theorien aus der Soziologie und der Interkulturellen Kommunikation vorgestellt.
- Identitätsmanagement in interkulturellen Kontexten
- Die Rolle der Interkulturellen Kommunikation bei der Gestaltung der Identität
- Die Bedeutung von Kultur und Interkulturalität für das Selbstverständnis von Belarussen im Ausland
- Die Anwendung der Identity Management Theory (IMT) auf die Untersuchung der kulturellen Identität von Belarussen
- Empirische Untersuchung der Facework-Strategien von Belarussen im Ausland
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel legt die Grundlage für die Arbeit, indem es zentrale Begriffe der Interkulturellen Kommunikation wie Kultur, Interkulturalität und Kommunikation definiert. Außerdem wird die Bedeutung der Identität im Kontext der Interkulturellen Kommunikation beleuchtet.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel werden die Bausteine der Identity Management Theory (IMT) vorgestellt, darunter Grices Theorie der konversationalen Implikaturen, Goffmans Konzept des Gesichts (face) und das Höflichkeitsmodell von Brown und Levinson.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel stellt die Identity Management Theory (IMT) von Cupach und Imahori vor. Die IMT bildet die theoretische Grundlage für den praktischen Teil der Arbeit.
- Kapitel 4: Hier wird die Methodik der eigenen Untersuchung vorgestellt, die in Anlehnung an Imahoris Studie aus dem Jahr 2002 konzipiert wurde.
- Kapitel 5: In diesem Kapitel werden die Durchführung und die Ergebnisse der eigenen Untersuchung beschrieben, die die kulturelle Identität von Belarussen im Ausland untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Interkulturelle Kommunikation, kulturelle Identität, Identity Management Theory (IMT), Facework-Strategien, Belarussen im Ausland, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Identity Management Theory (IMT)?
Die IMT nach Cupach und Imahori untersucht, wie Individuen ihre Identität in interkulturellen Kommunikationssituationen verhandeln und schützen.
Wer ist die Zielgruppe der empirischen Untersuchung in dieser Arbeit?
Die Untersuchung befasst sich spezifisch mit der kulturellen Identität von Belarussen, die im Ausland leben.
Welche soziologischen Bausteine bilden die Grundlage der IMT?
Wichtige Grundlagen sind Grices Konversationsmaximen, Goffmans "Gesicht"-Konzept (Face) und das Höflichkeitsmodell von Brown und Levinson.
Was sind "Facework-Strategien"?
Das sind kommunikative Strategien zur Wahrung oder Wiederherstellung des eigenen oder fremden "Gesichts" (Ansehens) in Interaktionen.
Wie wurde die Studie methodisch durchgeführt?
Die Untersuchung basiert auf einem Fragebogen-Design, das in Anlehnung an eine Studie von Imahori aus dem Jahr 2002 konzipiert wurde.
Was ist das Ziel der Arbeit in Bezug auf Interkulturalität?
Es soll analysiert werden, wie Menschen in einem neuen Kulturkreis ihr Selbstverständnis bewahren und gleichzeitig mit der fremden Kultur interagieren.
- Quote paper
- Kurachkina Katsiaryna (Author), 2009, Identity Management Theory - Eine Untersuchung "Kulturelle Identität von Belarussen im Ausland", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165215