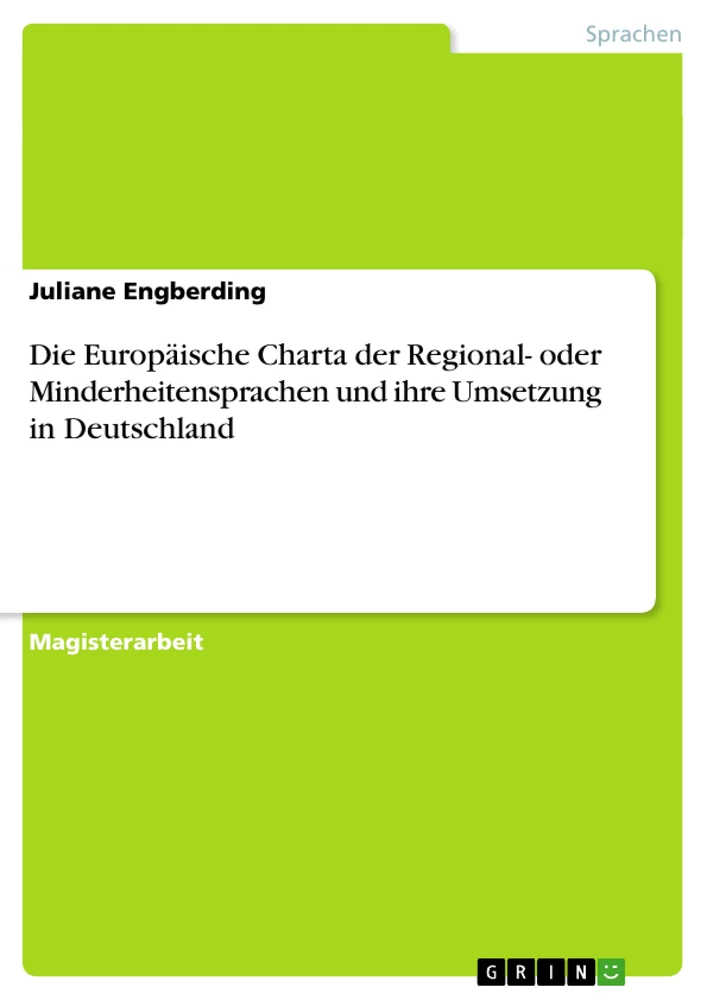Die Europäische Kommission hat als Motto für das Jahr 2008 das „Jahr des
Interkulturellen Dialogs“ angenommen. In diesem Zusammenhang wurde
auf Wunsch von Kommissionspräsident José Manuel Barroso und Leonard
Orban, Kommissar für Mehrsprachigkeit, ein Gremium gebildet, dass sie
hinsichtlich des Beitrages, den Mehrsprachigkeit zum interkulturellen
Dialog leisten kann, beraten soll. Ausgangsgedanke der Arbeit dieser
Arbeitsgruppe war folgende Annahme:
„Für jede Gesellschaft bringt die sprachliche, kulturelle, ethnische oder
religiöse Vielfalt zugleich Vorteile und Nachteile mit sich, sie ist eine
Quelle von Reichtum, aber auch von Spannungen. Es zeugt von Klugheit,
die Komplexität dieses Phänomens zu Kenntnis zu nehmen und sich
gleichzeitig darum zu bemühen, seine positiven Auswirkungen zu
verstärken und seine negativen so gering wie möglich zu halten. […] Wenn
auch die Mehrzahl der europäischen Nationen auf der Basis ihrer
identitätsstifenden Sprache begründet wurde, so kann sich die Europäische
Union nur auf ihre Sprachenvielfalt gründen. […] Geboren aus dem Willen
ihrer verschiedenen Völker, die aus freien Stücken die Wahl getroffen
haben, sich zu vereinen, ist die Europäische Union weder berufen, noch
imstande, ihre Vielfalt auszulöschen.“ (Maalouf 2008: 4-6).
Die sprachliche Vielgestaltigkeit in Europa manifestiert sich nicht nur in
den vielen Nationalsprachen, die auf europäischem Boden gesprochen
werden. In nahezu jedem Land existieren darüber hinaus auch Minderheiten,
die eigene, von der jeweiligen Nationalsprache klar abgrenzbare Sprachen
sprechen. Viele dieser Minderheitensprachen sind vom Aussterben bedroht,
da die Bedrohung von Sprachen bis hin zum Sprachtod zumeist in bi- oder
multilingualen Kontexten auftritt, in denen eine „Mehrheitssprache“ den
Nutzungsbereich und die Funktionalität einer Minderheitensprache ersetzt
und letztere damit verdrängt (vgl. May 2000: 366). Fest steht, dass mit jeder
verschwindenden Sprache Quellen spezifischer Sichtweisen und Ideen
unwiederbringlich verloren gehen (vgl. Bußmann 2002: 630).
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Sprachpolitik
- 2.1 Sprache als Menschenrecht
- 2.2 Sprachplanung
- 2.3 Möglichkeiten und Grenzen von Sprachplanung
- 3.0 Sprachplanung auf Europäischer Ebene
- 3.1 Definitionsproblematik „Minderheit“
- 3.2 Das „Sprachenproblem“ der EU
- 4.0 Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
- 4.1 Die Struktur der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
- 4.2 Vor- und Nachteile der Struktur
- 4.3 Die Sonderrolle von Dialekten und Migrantensprachen
- 5.0 Die geschützten Sprachen in Deutschland
- 5.1 Dänisch
- 5.2 Friesisch
- 5.3 Sorbisch
- 5.4 Romanes
- 5.5 Niederdeutsch
- 6.0 Die Umsetzung der Charta in Deutschland
- 6.1 Sprachplanerischer Wert der Maßnahmen in den einzelnen Gebrauchsdomänen
- 6.2 Konkrete Maßnahmen
- 6.2.1 Umsetzung in den Sprachen Dänisch, Friesisch, Sorbisch und Niederdeutsch
- 6.2.2 Der Sonderfall Romanes
- 6.3 Stellungnahmen der Minderheitenvertreter
- 7.0 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen und ihrer Umsetzung in Deutschland. Sie analysiert die Rahmenbedingungen und Maßnahmen zum Schutz von Minderheitensprachen auf europäischer und nationaler Ebene. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Sprachschutzes als Bestandteil einer inklusiven Gesellschaft und geht auf die Herausforderungen und Möglichkeiten der Sprachplanung ein.
- Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen als politisches Instrument zum Schutz von Minderheitensprachen
- Die Umsetzung der Charta in Deutschland und die Herausforderungen für die verschiedenen Minderheitensprachen
- Die Bedeutung des Sprachschutzes für die kulturelle Vielfalt und die Integration von Minderheiten
- Die Rolle von Sprachplanung in der Bewahrung und Förderung von Minderheitensprachen
- Die Berücksichtigung von Dialekten und Migrantensprachen im Kontext der Charta
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die aktuelle Debatte um die Bedeutung von Mehrsprachigkeit im Kontext des interkulturellen Dialogs beleuchtet. Im zweiten Kapitel werden grundlegende Konzepte der Sprachpolitik erläutert, insbesondere die Rolle der Sprache als Menschenrecht und die Möglichkeiten und Grenzen von Sprachplanung. Das dritte Kapitel widmet sich der Sprachplanung auf europäischer Ebene und thematisiert die Definition von „Minderheit“ und das „Sprachenproblem“ der EU. Kapitel 4 stellt die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen vor, analysiert ihre Struktur und diskutiert ihre Vor- und Nachteile. In Kapitel 5 werden die in Deutschland geschützten Sprachen Dänisch, Friesisch, Sorbisch, Romanes und Niederdeutsch vorgestellt. Kapitel 6 beschäftigt sich mit der Umsetzung der Charta in Deutschland, untersucht den sprachplanerischen Wert der Maßnahmen in den verschiedenen Gebrauchsdomänen und analysiert konkrete Maßnahmen zur Förderung der geschützten Sprachen. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselwörter: Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, Sprachpolitik, Sprachplanung, Minderheitensprachen, Sprachenschutz, kulturelle Vielfalt, Integration, interkultureller Dialog, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen?
Es ist ein völkerrechtlicher Vertrag zum Schutz und zur Förderung von Sprachen, die von traditionellen Minderheiten gesprochen werden.
Welche Sprachen sind in Deutschland durch die Charta geschützt?
In Deutschland sind Dänisch, Friesisch, Sorbisch, Romanes und Niederdeutsch als geschützte Sprachen anerkannt.
Warum ist der Schutz dieser Sprachen so wichtig?
Mit jeder verschwindenden Sprache gehen spezifische Sichtweisen, kulturelle Ideen und ein Teil der europäischen Vielfalt unwiederbringlich verloren.
Fallen Dialekte und Migrantensprachen auch unter die Charta?
Die Arbeit thematisiert die Sonderrolle von Dialekten und stellt fest, dass Migrantensprachen in der Regel nicht durch diese spezifische Charta geschützt sind.
Wie wird die Charta in Deutschland konkret umgesetzt?
Die Arbeit analysiert Maßnahmen in verschiedenen Gebrauchsdomänen (z.B. Bildung, Verwaltung) und enthält Stellungnahmen von Minderheitenvertretern.
- Arbeit zitieren
- Juliane Engberding (Autor:in), 2008, Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen und ihre Umsetzung in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165240