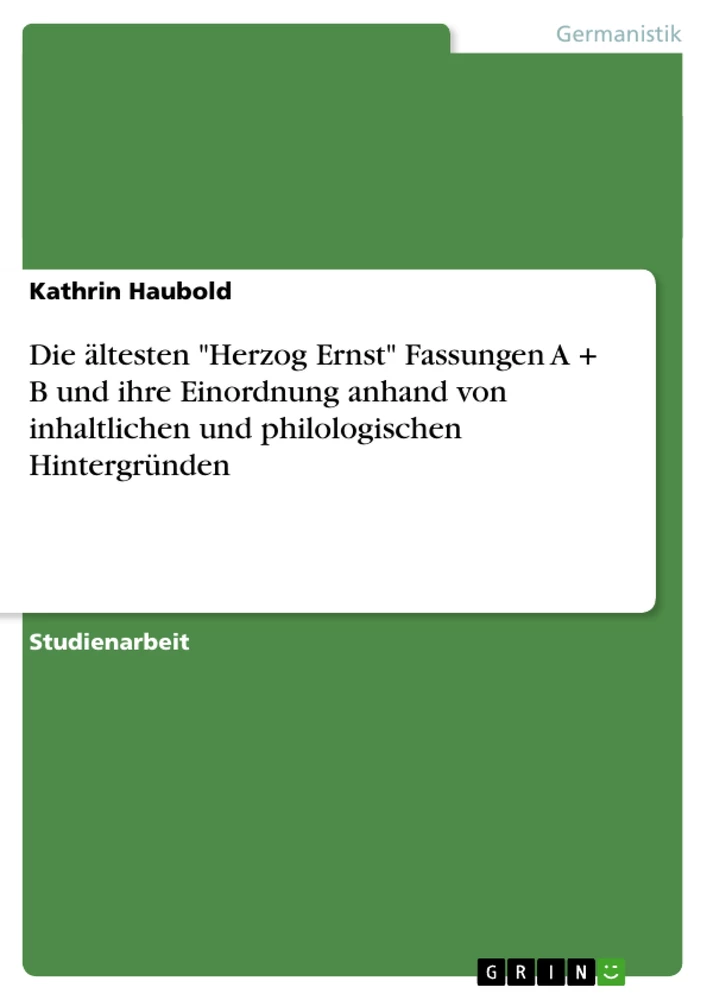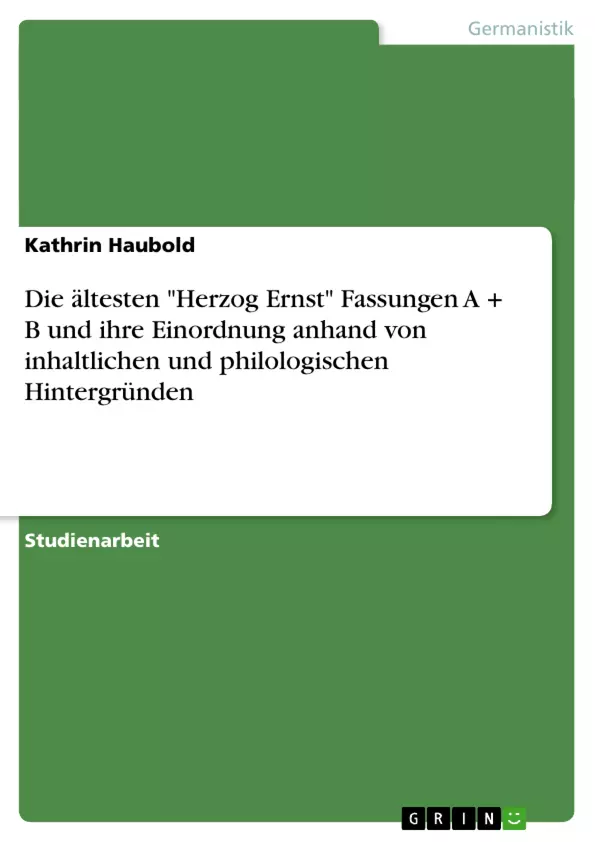Es gibt nur ganz wenige deutliche Daten und Anhaltspunkte in der mittelalterlichen Literaturgeschichte. So sind für viele Werke die Entstehungszeit, Lokalisierung sowie Verfasser, Auftraggeber und Adressat nur vage zu bestimmen. Das gilt besonders für den Versroman "Herzog Ernst", der durch seine außergewöhnliche Überlieferungsgeschichte eine besondere Rolle in der Literaturwissenschaft spielt. Die Geschichte des aus der Heimat vertriebenen und den Orient bereisenden bayerischen Herzogs gehört zu den beliebtesten der mittelalterlichen Erzählliteratur. Die Einordnungsversuche, besonders der älteren Fassungen, sind in der bisherigen Forschung sehr widersprüchlich.
Neueste Wortschatzuntersuchungen zur Datierung weisen darauf hin, daß der Text früher anzusetzen sei, als bisher angenommen wurde. Die Einordunung der Fassungen A und B des Herzog Ernst sei wahrscheinlich vor der traditionellen Datierung, die bisher um 1170/80 (höfische, bzw. frühhöfische Dichtung) angesetzt war, anzunehmen.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- I. 1. Fragestellung und These
- I. 2. Vorgehensweise
- I. 3. Handlungsgeschehen
- II. ZUM STAND DER FORSCHUNG
- II. 1. Herzog Ernst als politische Dichtung
- II. 2. Forschungstand
- a) Herzog Ernst A
- b) Herzog Ernst B
- III. ZUM HISTORISCHEN HINTERGRUND
- III. 1. Historische Fakten
- III. 2. Mögliche Verfasser und deren Anonymität
- III. 3. Pilgerreisen ◇ Kreuzzugsgedanken
- III. 4. Kaisertum Papsttum
- III. 5. Auseinandersetzungen zwischen Staufern und Welfen
- III. 6. Heinrich der Löwe
- III. 7. Zum Name,,Ernst”
- IV. UNTERSUCHUNGEN DES WORTSCHATZES DER FASSUNGEN A UND B
- IV. 1. Deutsch als Schriftsprache
- IV. 2. Wandlung des mittelalterlichen Städtewesens
- IV. 3. „,burc/g“ und „,stat” Wortschatz
- IV. 4. Analyse anhand von archaischen Worten
- V. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Einordnung der ältesten Fassungen A und B des Versromans „Herzog Ernst“. Ziel ist es, die Datierung der Fassungen anhand inhaltlicher und philologischer Hintergründe zu beleuchten und somit einen neuen Blick auf die Entstehung und Bedeutung des Werkes zu ermöglichen.
- Historische Hintergründe und ihr Einfluss auf die Dichtung
- Untersuchung der Rolle des „Herzog Ernst“ als politische Dichtung
- Analyse des Wortschatzes der Fassungen A und B im Hinblick auf die Datierung
- Einordnung des Werkes in die mittelalterliche Erzähltradition
- Bedeutung des „Herzog Ernst“ für die deutsche Literaturgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung und die These der Arbeit dar, die sich mit der Datierung der ältesten Fassungen A und B des Versromans „Herzog Ernst“ beschäftigt. Die Vorgehensweise beinhaltet sowohl eine inhaltliche als auch eine philologische Analyse.
Kapitel II beleuchtet den Forschungsstand zum „Herzog Ernst“ und setzt sich mit verschiedenen Interpretationen auseinander. Dabei werden insbesondere die älteren Fassungen A und B betrachtet.
Kapitel III behandelt den historischen Hintergrund des Werkes, indem es auf historische Fakten, mögliche Verfasser, Pilgerreisen, Kreuzzugsgedanken, das Verhältnis von Kaisertum und Papsttum sowie die Auseinandersetzungen zwischen Staufern und Welfen eingeht.
Kapitel IV widmet sich der Untersuchung des Wortschatzes der Fassungen A und B. Hierbei werden die Entwicklung des Deutschen als Schriftsprache, die Wandlung des mittelalterlichen Städtewesens und die Bedeutung des Wortschatzes „burc/g“ und „stat“ analysiert.
Schlüsselwörter
Herzog Ernst, Versroman, Mittelalter, Datierung, Forschungstand, Historischer Hintergrund, Wortschatzanalyse, Politische Dichtung, Deutsche Literaturgeschichte, Fassungen A und B, Kaisertum, Papsttum, Kreuzzüge, Pilgerreisen, Staufer, Welfen, Städtewesen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im mittelalterlichen Versroman „Herzog Ernst“?
Die Erzählung handelt von einem bayerischen Herzog, der aus seiner Heimat vertrieben wird und abenteuerliche Reisen in den Orient unternimmt. Es ist eines der beliebtesten Werke der mittelalterlichen Erzählliteratur.
Wann entstanden die Fassungen A und B des „Herzog Ernst“?
Traditionell wurden sie um 1170/80 datiert. Neuere Wortschatzuntersuchungen in dieser Arbeit legen jedoch nahe, dass die Texte früher anzusetzen sind.
Welche Rolle spielen historische Hintergründe in der Dichtung?
Die Arbeit analysiert Bezüge zu realen Ereignissen wie den Auseinandersetzungen zwischen Staufern und Welfen (Heinrich der Löwe), Kreuzzugsgedanken und dem Verhältnis von Kaisertum und Papsttum.
Wie hilft die Wortschatzanalyse bei der Datierung?
Durch die Analyse archaischer Begriffe und der Verwendung von Wörtern wie „burc/g“ und „stat“ im Kontext des sich wandelnden Städtewesens lassen sich Rückschlüsse auf die Entstehungszeit ziehen.
Gilt der „Herzog Ernst“ als politische Dichtung?
Ja, die Forschung betrachtet das Werk oft als politische Dichtung, die zeitgenössische Machtkonflikte und gesellschaftliche Ideale des Mittelalters reflektiert.
Sind die Verfasser der Fassungen bekannt?
Wie bei vielen mittelalterlichen Werken bleiben die Verfasser anonym. Die Arbeit diskutiert jedoch mögliche Urheber und Auftraggeber im historischen Kontext.
- Quote paper
- Kathrin Haubold (Author), 2002, Die ältesten "Herzog Ernst" Fassungen A + B und ihre Einordnung anhand von inhaltlichen und philologischen Hintergründen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16527