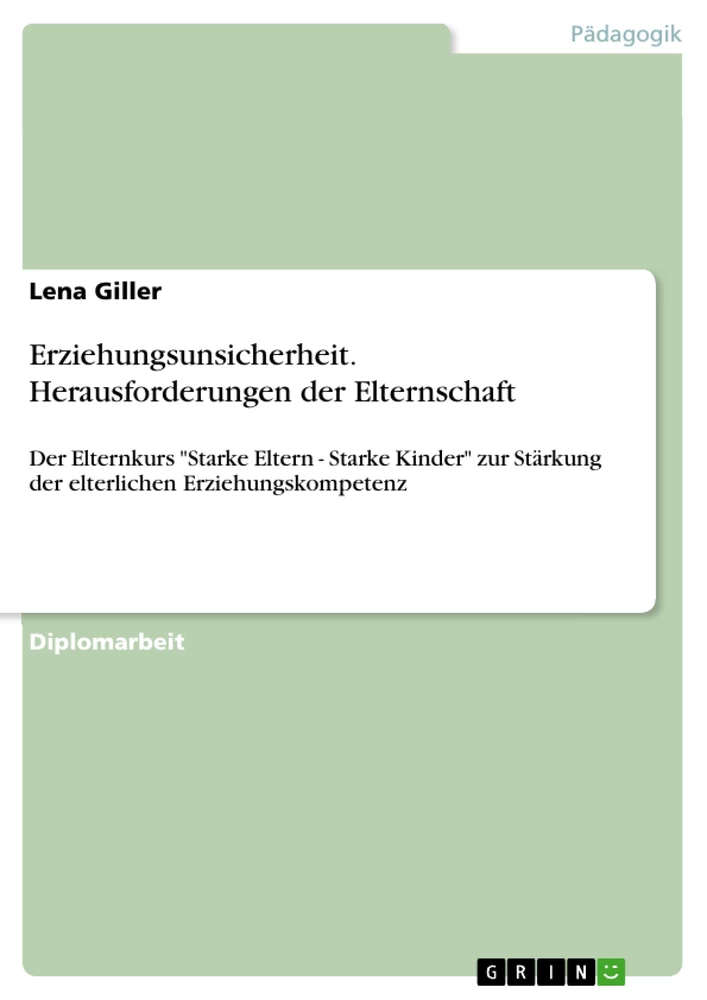Die Erziehung der Kinder ist eine alltägliche Aufgabe und Herausforderung, bei der immer mehr Eltern an ihre Grenzen stoßen. Die meisten Eltern lieben ihre Kinder und möchten in der Erziehung alles richtig machen. Ihre Kinder sollen sich zu starken, selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln. Aber wie sieht eine „gute“ und „richtige“ Erziehung aus?
Eltern stehen vor vielen Fragen und Entscheidungen, wenn es um die Entwicklung und Erziehung ihrer Sprösslinge geht: Braucht mein Kind klare Grenzen oder vor allem Freiraum, um sich entwickeln zu können? Welcher Erziehungsstil ist am besten? Wie kann ich mein Kind optimal fördern? Mit diesen und anderen Fragen müssen sich Eltern immer wieder auseinandersetzen.
Viele Eltern fühlen sich in ihrer Erziehungsaufgabe allein gelassen und sind auf der Suche nach Orientierung und Unterstützung. Seit Jahren ist das Interesse an den zum Teil sehr umstrittenen Medienangeboten, wie „Teenager außer Kontrolle - Letzer Ausweg Wilder Westen“ (zuletzt ausgestrahlt von Februar bis April 2010) oder „Die Super Nanny“ (RTL) ununterbrochen groß. „So kam Diplom-Pädagogin Katharina Saalfrank (…) auf einen Marktanteil von satten 21,7 Prozent (…), 2,59 Millionen 14 bis 49-Jährige waren dabei. Dies war zugleich Rang zwei in den Quoten-Top-Ten vom Mittwoch“ (Tv-Tipps 2009).
In „Die Super Nanny“ besucht eine Diplom-Pädagogin Familien mit Erziehungsproblemen in ihrem häuslichen Umfeld und steht ihnen beratend zur Seite. In der Reality Show „Teenager außer Kontrolle - Letzer Ausweg Wilder Westen“ werden schwer erziehbare Jugendliche einer Therapie in der freien Natur unterzogen. Sie sollen, weit entfernt von der Zivilisation, resozialisiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wandel der Familie
- Die Entstehung der modernen Kleinfamilie
- Die Individualisierungsthese von Beck
- Wertewandel
- Destabilisierung der traditionellen Kernfamilie
- Demographischer Wandel
- Pluralisierung der Familienformen
- Wandel des familialen Binnenlebens
- Wandel der Geschlechterrollen
- Veränderte Erziehungsvorstellungen
- Herausforderungen der Elternschaft und Erziehungsunsicherheit
- Erziehungskompetenz
- Begriffsdefinition Erziehung
- Erziehungsstile
- Elterliche Erziehungskompetenz
- Die Fünf Säulen der Erziehung
- Entwicklungsfördernde Erziehung
- Entwicklungshemmendes Erziehungsverhalten
- Die Fünf Säulen der Erziehung
- Begriffsdefinition Erziehung
- Elternbildung
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung
- Rechtliche Grundlagen
- UN-Kinderrechtskonvention
- Das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung
- Das Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Formen der Elternbildung
- Informelle Elternbildung
- Institutionelle Elternbildung
- Mediale Elternbildung
- Kategorisierung
- Aufgaben und Ziele
- Prävention durch Elternbildung
- Methoden und Ansatzpunkte
- Teilnehmer von institutionellen Elternbildungsangeboten
- Kenntnis und Nutzungsverhalten
- Teilnehmermotivation
- Teilnehmerproblematik
- Sprachbarrieren
- Verhaltensbarrieren
- Institutionelle Barrieren
- Forderungen und Perspektiven
- Der Elternkurs „Starke Eltern - Starke Kinder“
- Entstehungsgeschichte
- Konzeptionelle Grundlagen
- Inhalte und Ziele
- Das Modell der anleitenden Erziehung
- Aufbau und Ablauf der Kursabende
- Kursleitung
- Teilnehmer und Teilnehmermotive
- Starke Eltern, Starke Kinder - ganz praktisch
- Evaluation des Elternkurses
- Überblick zum bisherigen Forschungsstand
- Evaluationsstudie von Tschöpe-Scheffler und Niermann
- Teilnehmerbefragung
- Tiefeninterviews
- Kinderbefragung
- Zusammenfassende Ergebnisse
- Wirkungsanalyse des Elternkurses von Rauer
- Fragebogenuntersuchung der Eltern
- Fragebogenuntersuchung der Kinder
- Follow-up Erhebung
- Interaktionsbeobachtung
- Zusammenfassende Ergebnisse
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht den Elternkurs „Starke Eltern - Starke Kinder“ und beleuchtet die Herausforderungen der Elternschaft im Kontext des gesellschaftlichen Wandels und der zunehmenden Erziehungsunsicherheit. Die Arbeit analysiert die konzeptionellen Grundlagen des Elternkurses und evaluiert dessen Wirksamkeit anhand verschiedener Forschungsstudien.
- Der Wandel der Familie und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Elternschaft
- Die Bedeutung von Erziehungskompetenz und die Förderung elterlicher Ressourcen
- Die Rolle der Elternbildung in der Prävention von Erziehungsproblemen
- Die Analyse des Elternkurses „Starke Eltern - Starke Kinder“ und dessen konzeptionelle Grundlagen
- Die Evaluierung des Elternkurses anhand empirischer Studien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Elternschaft und Erziehungsunsicherheit ein und beleuchtet die wachsende Nachfrage nach Unterstützung und Orientierung in der Erziehungspraxis. Kapitel 2 analysiert den Wandel der Familie und dessen Auswirkungen auf die Herausforderungen der Elternschaft. Es werden die Entstehung der modernen Kleinfamilie, die Individualisierungsthese von Beck, die Destabilisierung der traditionellen Kernfamilie und der Wandel des familialen Binnenlebens beleuchtet. Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Begriff der Erziehungskompetenz und erläutert verschiedene Erziehungsstile. Die Bedeutung elterlicher Ressourcen und die Förderung einer entwicklungsfördernden Erziehung werden ebenfalls thematisiert. Kapitel 4 widmet sich dem Thema der Elternbildung, definiert den Begriff, beleuchtet rechtliche Grundlagen und kategorisiert verschiedene Formen der Elternbildung. Darüber hinaus werden Aufgaben und Ziele sowie Methoden und Ansatzpunkte der Elternbildung diskutiert. Kapitel 5 stellt den Elternkurs „Starke Eltern - Starke Kinder“ vor und beschreibt dessen Entstehungsgeschichte, konzeptionelle Grundlagen, Inhalte und Ziele sowie den Aufbau und Ablauf der Kursabende.
Schlüsselwörter
Elternschaft, Erziehungsunsicherheit, Familienwandel, Erziehungskompetenz, Elternbildung, Prävention, Elternkurs, „Starke Eltern - Starke Kinder“, Evaluation, empirische Studien.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Erziehungsunsicherheit?
Erziehungsunsicherheit beschreibt das Phänomen, dass Eltern trotz des Wunsches, alles richtig zu machen, aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen und vielfältiger Erziehungsmodelle an ihre Grenzen stoßen und Orientierung suchen.
Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche Wandel auf die Familie?
Durch Individualisierung (nach Beck), demographischen Wandel und die Pluralisierung von Familienformen hat sich die traditionelle Kernfamilie destabilisiert, was neue Anforderungen an die Elternschaft stellt.
Was sind die "Fünf Säulen der Erziehung"?
Dies ist ein Modell zur elterlichen Erziehungskompetenz, das zwischen entwicklungsförderndem und entwicklungshemmendem Erziehungsverhalten unterscheidet.
Was ist das Ziel des Elternkurses "Starke Eltern - Starke Kinder"?
Der Kurs basiert auf dem Modell der anleitenden Erziehung und zielt darauf ab, die Erziehungskompetenz zu stärken, elterliche Ressourcen zu fördern und Gewalt in der Erziehung vorzubeugen.
Welche Rolle spielen Medien wie "Die Super Nanny" für Eltern?
Solche medialen Angebote spiegeln den großen Informationsbedarf und die Suche nach Orientierung wider, werden jedoch aufgrund ihrer Darstellung oft kritisch betrachtet.
Gibt es rechtliche Grundlagen für die Elternbildung?
Ja, wichtige Grundlagen sind die UN-Kinderrechtskonvention, das Recht auf gewaltfreie Erziehung und das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG).
- Citar trabajo
- Lena Giller (Autor), 2010, Erziehungsunsicherheit. Herausforderungen der Elternschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165337