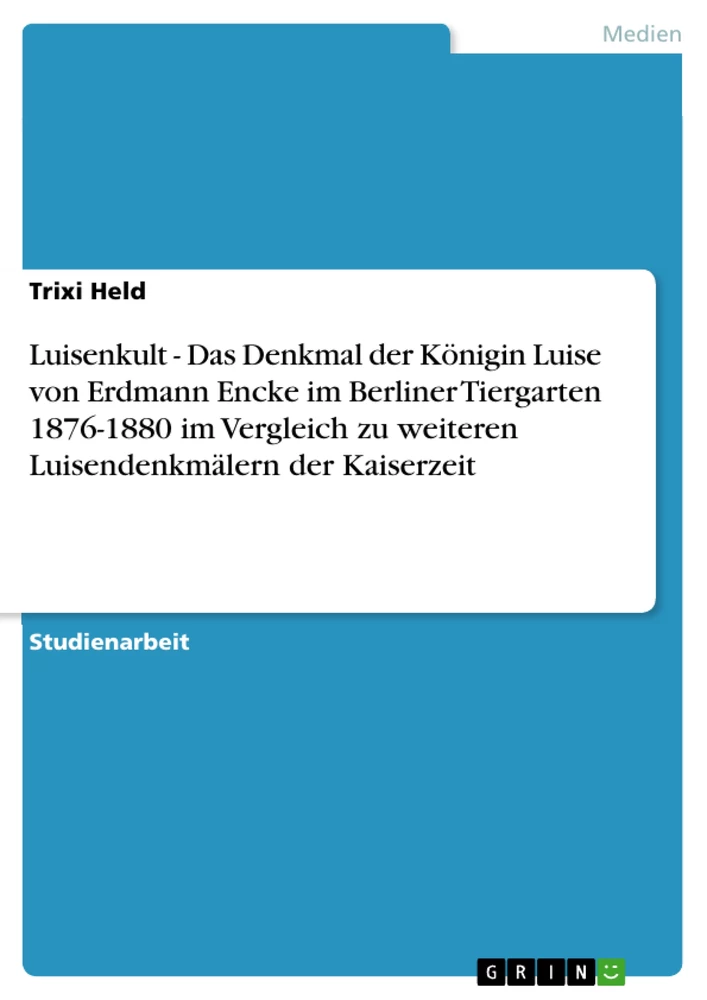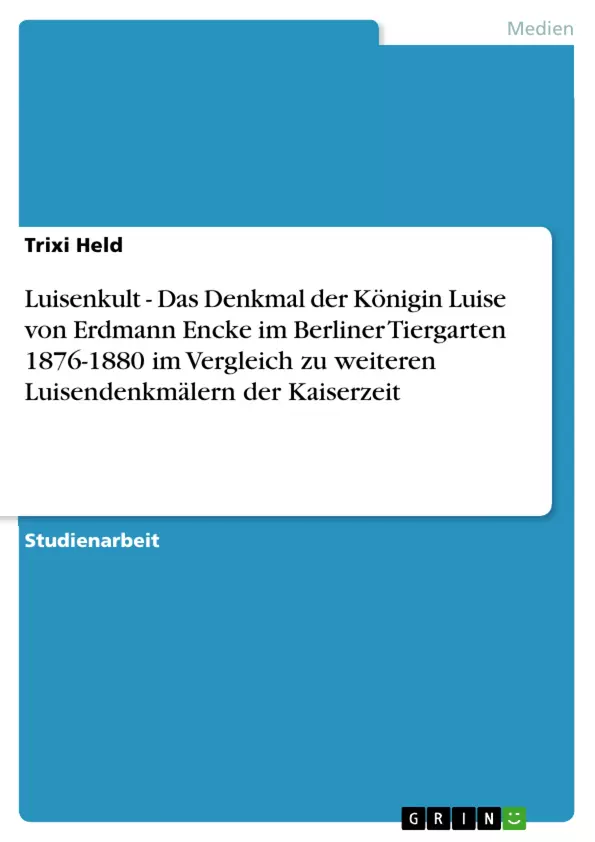Während des Kaiserreichs erlebte die Verehrung der preußischen Königin Luise einen Höhepunkt, indem sie von einem preußischen Kultbild zu einem Nationaldenkmal erhoben wurde.
Zu ihren Lebzeiten trat sie eng verbunden mit bürgerlichen Idealen als Frau, Gattin und Mutter auf. Die Rezeption der Gestalt der Königin Luise hat sich aber durchaus im Laufe der Zeit gewandelt und änderte sich mit dem historischen Kontext, indem mal bürgerliche Ideale, mal emanzipatorische oder auch nationale Forderungen mit ihrem Abbild vertreten wurden. In der gegenwärtigen Forschung sind hier die Begriffe des 'Mythos' und des 'Kultes' leitend. Die Mythenbildung um Luise war nicht starr, sondern dynamisch und wurde je nach zeitgenössischer Intention angepasst, ausgeschmückt oder verengt. Sie diente dazu, ihren Zeitgenossen die Gegenwart zu deuten, begreiflich zu machen und Werte zu vermitteln.
Die Frage dieser Studie lautet, wie das Bild der Königin Luise im deutschen Kaiserreich aussah. Hierzu wird das Berliner Denkmal von Erdmann Encke im Vergleich zu zwei weiteren Luisendenkmälern der Kaiserzeit besprochen: Welche Mythen werden hier vermittelt oder gebildet, und was wollten die Denkmalsetzer damit bewirken?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Forschungsstand und Fragestellungen
- 2. Denkmäler und Denkmalpolitik im 19. Jahrhundert
- II. Hauptteil
- 1. Luisendenkmal im Berliner Tiergarten
- 1.1 Entstehungshintergründe und Enthüllungskontext
- 1.2 Standort
- 1.3 Beschreibung des Denkmals
- 1.3.1 Standbild
- 1.3.2 Sockelrelief
- 2. Weitere Luisendenkmäler im deutschen Kaiserreich
- 2.1 Das Tilsiter Denkmal
- 2.2 Das Magdeburger Denkmal
- 3. Vergleich der drei Luisendenkmäler
- 1. Luisendenkmal im Berliner Tiergarten
- III. Schlussbetrachtungen
- Abschließendes Fazit
- IV. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Rezeption der preußischen Königin Luise im deutschen Kaiserreich, speziell im Kontext von Denkmälern. Die Untersuchung fokussiert auf das Luisendenkmal von Erdmann Encke im Berliner Tiergarten und setzt es in Bezug zu weiteren Luisendenkmälern der Kaiserzeit. Ziel ist es, die Mythenbildung um die Gestalt der Königin Luise im Kontext dieser Denkmäler zu analysieren und deren Funktion für die Denkmalpolitik des Kaiserreichs zu erforschen.
- Die Entwicklung des Luisenkults vom preußischen Kultbild zum Nationaldenkmal
- Die Bedeutung von Denkmalserrichtungen im Diskurs über Nation im 19. Jahrhundert
- Die Verwendung von politischen Mythen zur Identitätsbildung und Legitimierung
- Der Vergleich der Mythenbildung in verschiedenen Luisendenkmälern der Kaiserzeit
- Die Rolle von Standbild und Reliefprogrammen in der Vermittlung von Idealen und Werten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den Forschungsstand und die Fragestellungen, die im Zentrum der Arbeit stehen. Im ersten Kapitel werden die Entstehungshintergründe des Encke-Denkmals im Berliner Tiergarten, sein Standort und seine Beschreibung behandelt. Das zweite Kapitel befasst sich mit weiteren Luisendenkmälern im deutschen Kaiserreich, dem Tilsiter Denkmal und dem Magdeburger Denkmal. Das dritte Kapitel widmet sich einem Vergleich der drei Luisendenkmäler und analysiert die jeweils vermittelten Mythen.
Schlüsselwörter
Luisenkult, Denkmalpolitik, Kaiserreich, Nation, Mythos, Identitätsbildung, politische Mythen, Standbild, Reliefprogramm, Berlin, Tilsit, Magdeburg.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Luisenkult?
Der Luisenkult bezeichnet die intensive Verehrung der preußischen Königin Luise, die im deutschen Kaiserreich ihren Höhepunkt erreichte. Sie wurde dabei von einer privaten Kultfigur zu einem nationalen Symbol für preußische Tugenden und nationale Einheit erhoben.
Wer schuf das Luisendenkmal im Berliner Tiergarten?
Das Denkmal im Berliner Tiergarten wurde zwischen 1876 und 1880 von dem Bildhauer Erdmann Encke geschaffen. Es zeigt die Königin als Standbild auf einem Sockel mit Reliefs.
Welche Rolle spielten Denkmäler im 19. Jahrhundert?
Denkmäler dienten im 19. Jahrhundert als Instrumente der Denkmalpolitik. Sie sollten nationale Identität stiften, politische Mythen vermitteln und die herrschende Ordnung legitimieren.
Welche weiteren Luisendenkmäler gibt es neben dem Berliner Denkmal?
Neben dem Berliner Standbild sind das Luisendenkmal in Tilsit und das Denkmal in Magdeburg bedeutende Beispiele aus der Kaiserzeit, die jeweils unterschiedliche Aspekte des Luisen-Mythos betonen.
Warum wandelte sich das Bild der Königin Luise?
Die Rezeption passte sich dem historischen Kontext an: Zunächst stand sie für bürgerliche Ideale als Gattin und Mutter, später wurde sie zur heroischen Nationalfigur stilisiert, um den Zeitgenossen Werte und Identität zu vermitteln.
- Arbeit zitieren
- Trixi Held (Autor:in), 2007, Luisenkult - Das Denkmal der Königin Luise von Erdmann Encke im Berliner Tiergarten 1876-1880 im Vergleich zu weiteren Luisendenkmälern der Kaiserzeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165378