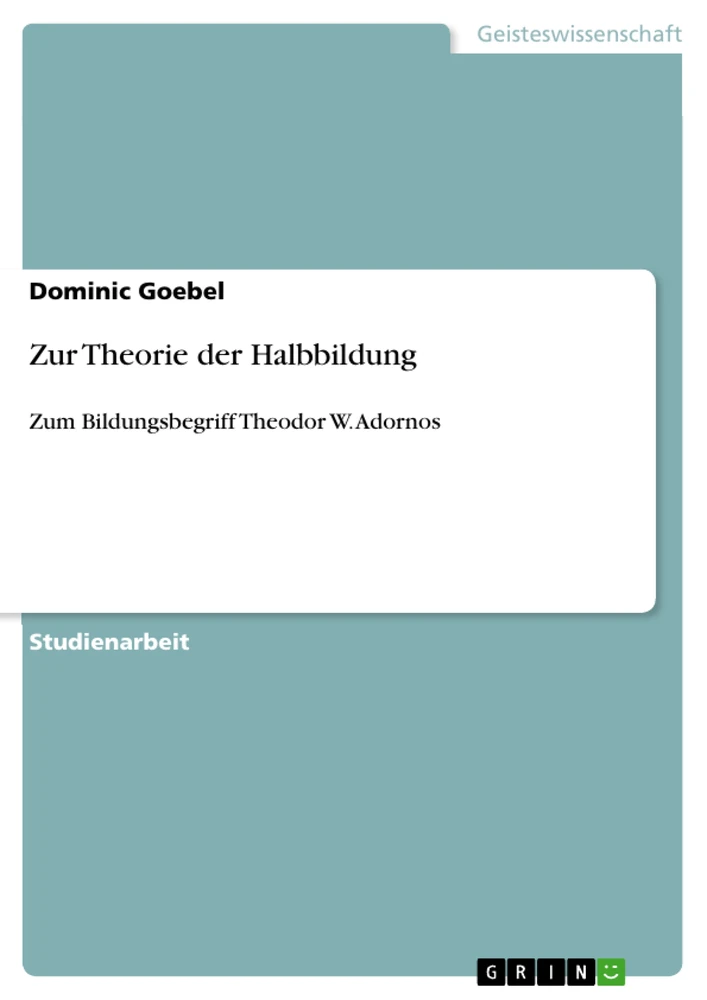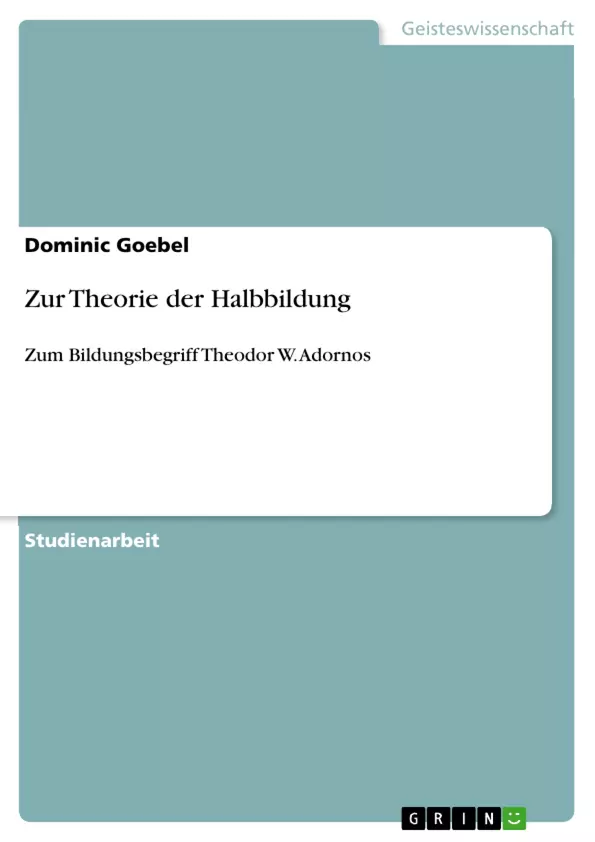Fällt der Begriff der Bildung, scheint es in der Öffentlichkeit meistens selbstverständlich, worum es geht. Von beruflicher Weiterbildung, über Volkshochschulkurse, das Schul- und Universitätswesen allgemein, ja sogar bis hin zu privater „Alltagsbildung“ mit Hilfe der heutzutage gängigen Medien wie Fernsehen und Internet scheint der Begriff all dies irgendwie zu fassen, um nur einige Beispiele zu nennen.
Demgegenüber wird auch die gleiche Selbstverständlichkeit suggeriert, wenn es an eben dieser „Bildung“ etwas zu kritisieren gibt, oder Forderungen diesbezüglich geltend gemacht werden. Regt sich in Deutschland oder anderswo Widerstand gegen diverse Umstrukturierungen im „Bildungswesen“, ist in den Medien regelmäßig von „Protesten gegen Bildungsabbau“ die Rede, beliebte Slogans solcher Auseinandersetzungen, beispielweise von Seiten der Studenten und Schüler, sind etwa „Bildung ist keine Ware!“ oder ähnliches. Intention der vorliegenden Ausführungen ist es nun nicht zu zeigen, welche Maßnahmen in den letzten Jahren im „Bildungssektor“ ergriffen wurden, auszuführen ob der Protest dagegen gerechtfertigt ist, oder gar Vorschläge zu einer adäquateren Organisation beispielsweise des Schulwesens in seiner heutigen Form zu entwerfen. Das hängt mit dem Umstand zusammen, das im Folgenden vielmehr die Ansicht vertreten wird, „Bildung“ lasse sich gar nicht isoliert und unabhängig von den gesellschaftlichen Verhältnissen betrachten in die sie eingebettet ist, ohne diese gleichzeitig zu fokussieren.
Stattdessen wird im Folgenden der Versuch unternommen werden, erst einmal die kategorialen Voraussetzungen zu klären, nach denen überhaupt eine angemessene Kritik am proklamierten „Bildungsverfall“ stattfinden könnte, ohne wie in den gängigen Verlautbarungen Protestierender den Verdacht zu nähren, es gelte lediglich eine noch bis vor kurzem intakte Bildungswelt zu erhalten bzw. zurückzufordern. Zu diesem Zweck werden das oben genannte Verhältnis von Gesellschaft und Bildung und der Begriff der Bildung selbst in seinem historischen Kontext zu betrachten sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte
- Problem- und Fragestellung
- Methodischer Aufbau
- Theorie der Halbbildung
- Der Doppelcharakter der Kultur
- Anpassung
- Bildung als reine Geisteskultur
- Die Physiognomik der Halbbildung
- Zur Seite des Subjekts
- Zur Seite des Objekts
- Resümierende Schlussbemerkung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der „Theorie der Halbbildung“ von Theodor W. Adorno und analysiert, wie der Begriff der Bildung in der heutigen Gesellschaft verstanden und kritisiert werden kann. Sie untersucht Adornos These, dass Halbbildung zur vorherrschenden Form des Bewusstseins geworden ist und stellt den Zusammenhang von Gesellschaft und Bildung in den Vordergrund.
- Der Doppelcharakter der Kultur
- Die Physiognomik der Halbbildung
- Die Kritik am „Bildungsverfall“
- Das Verhältnis von Gesellschaft und Bildung
- Der Einfluss von Adornos „kritischer Theorie“ auf den Bildungsbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problem- und Fragestellung sowie den methodischen Aufbau der Ausführungen skizziert. Anschließend wird der Begriff der Halbbildung im Kontext von Adornos Theorie der Kultur analysiert. Dabei wird der Doppelcharakter der Kultur, die Anpassung an gesellschaftliche Normen und die Bedeutung von Bildung als reine Geisteskultur beleuchtet. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Physiognomik der Halbbildung aus der Sicht des Subjekts und des Objekts untersucht. Diese Betrachtung beinhaltet die Kritik an der traditionellen Bildungsbegriff und die Folgen der sozialen Einflussnahme auf die Bildung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die „Theorie der Halbbildung“ von Theodor W. Adorno und behandelt Schlüsselbegriffe wie Bildung, Kultur, Gesellschaft, Anpassung, Halbbildung, Kritik, und die „Frankfurter Schule“. Weitere wichtige Themengebiete sind die Kritik am „Bildungsverfall“ und die gesellschaftlichen Bedingungen, die Bildung beeinflussen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Theodor W. Adorno unter "Halbbildung"?
Halbbildung ist für Adorno nicht das Fehlen von Bildung, sondern eine Form des Bewusstseins, die Bildungselemente nur oberflächlich konsumiert und sich gesellschaftlich anpasst.
Welchen Doppelcharakter hat die Kultur laut dieser Theorie?
Kultur dient einerseits der individuellen Bildung und geistigen Freiheit, andererseits aber auch der gesellschaftlichen Anpassung und Kontrolle.
Warum kann Bildung nicht isoliert von der Gesellschaft betrachtet werden?
Weil Bildung immer in gesellschaftliche Verhältnisse eingebettet ist; eine Kritik am "Bildungsverfall" muss daher immer auch eine Kritik an der Gesellschaft sein.
Welche Rolle spielt die Physiognomik der Halbbildung?
Sie untersucht die Erscheinungsformen der Halbbildung sowohl auf der Seite des Subjekts (des Einzelnen) als auch auf der Seite des Objekts (der Bildungsinhalte).
Was kritisiert die Arbeit an gängigen Bildungsprotesten?
Sie hinterfragt, ob Proteste gegen "Bildungsabbau" oft nur versuchen, eine vermeintlich intakte Vorwelt zurückzufordern, ohne die tieferen systemischen Ursachen zu verstehen.
- Quote paper
- Dominic Goebel (Author), 2008, Zur Theorie der Halbbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165381