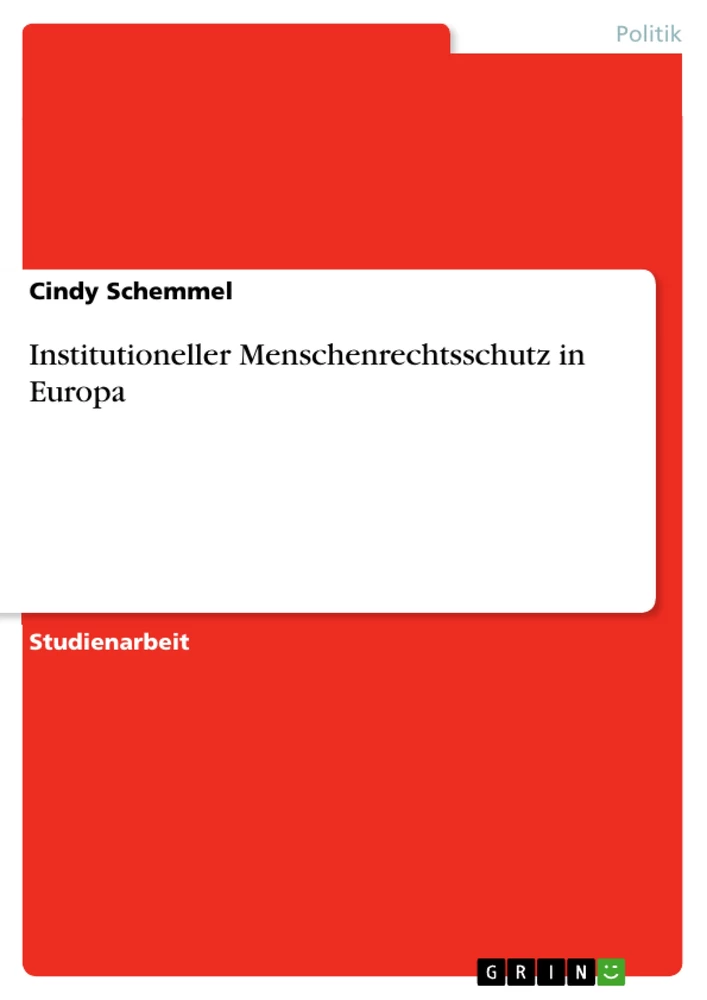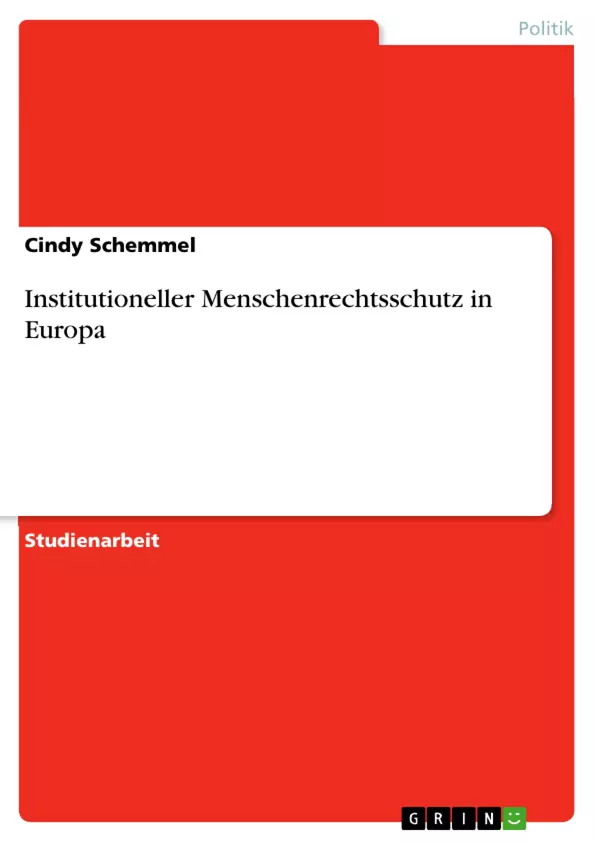[...] Eine extrem unruhige
Weltpolitik, gefolgt von zwei Weltkriegen maßen dem Menschenrechtsschutz im 20.
Jahrhundert vor allem in nationalen Rechtsordnungen mehr Bedeutung bei als jemals zuvor.
Heute kennen wir Menschenrechtsschutz als ein Mehrebenensystem, sowohl auf internationaler
als auch auf nationaler Ebene. Je individueller eine Rechtsordnung ist, desto schwieriger wird
ihre Durchsetzung und Einhaltung wenn sie über ihre Legitimitätsgrenzen hinaus reicht. Im
Gegensatz dazu ist die Umsetzung universeller Rechtsnormen ebenfalls kompliziert, wenn sich
nicht alle damit zu gleichen Teilen identifizieren können. Oft rufen kulturelle Verschiedenheiten
Unstimmigkeiten hervor, welche zu unüberwindbaren Problemen werden können. Das wohl
prominenteste Beispiel dafür sind die offenbar sehr verschiedenen Auffassungen von
Rechtsnormen in der Welt des Okzident und des Orient. Eine zunehmend stärker
zusammenrückende Welt erfordert jedoch eine Abstimmung bestimmter Spielregeln, damit
diese auch von allen Beteiligten eingehalten werden. Nur wer von den ihm auferlegten Regeln
überzeugt ist, wird auch bereit sein, diese zu achten.
Wie kein zweites Projekt auf der Welt versucht die Europäische Union, verschiedene Nationen
und unterschiedlich individuell geprägte Rechtsordnungen auf einer supranationalen Ebene zu
einen. Ihr Ziel ist es soweit wie möglich europaweit einheitliche Standards, zur Erleichterung
internationaler Beziehungen zu schaffen und ein transnationales Bewusstsein zwischen den
Völkern Europas aufzubauen. Zur Etablierung einheitlicher Standards gaben die beigetretenen
Staaten nationale Hoheitsrechte an die EG ab und formten zur Kontrolle und Wahrung der
abgetretenen Normen Institutionen, vertreten durch supranationale Organisationen.
Problematisch wird es, wenn aus den einst abgegebenen Rechten nur noch Pflichten entstehen
und keine oder ungenügende institutionelle Ordnung vorherrscht. So auch die Problematik eines
supranational geregelten Menschenrechtsschutzes innerhalb der Europäischen Union.
Die folgende Hausarbeit zeigt die Organisation des europäischen Menschenrechtsschutzes in
einem Mehrebenensystem und stellt sich die Frage, welche Disparitäten zwischen den
beteiligten Parteien, aufgrund institutioneller Schwachstellen, auftreten können. Den Abschluss
bildet ein Ausblick auf einen abgestimmten Menschenrechtsschutz für eine reformierte und
institutionalisierte Europäische Union.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Institutioneller Rahmen
- Begriffsklärung
- Die Europäische Gemeinschaft als institutionelle Einrichtung
- Schutz der Menschenrechte in Europa als institutionelles Instrument
- Ebenen des Menschenrechtsschutzes
- MRS im europäischen Raum
- Die EMRK
- Die Charta der Grundrechte der EU
- Grundrechtsschutz in der EU/EG
- EGMR versus EuGH
- Die Umsetzung des europäischen MRS in der nationalen Rechtsordnung
- Wie wirkt die EMRK im innerstaatlichen Recht?
- Institutionelle Sicherung des Europäischen Menschrechtschutzes im VVE
- Fehlende Rechtspersönlichkeit als institutionelles Problem
- Warum tritt die EU nicht der EMRK bei?
- Inkorporierung des Menschenrechtsschutzes als europäische Institution
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den institutionellen Rahmen des Menschenrechtsschutzes in Europa. Sie beleuchtet die verschiedenen Ebenen des Schutzes, insbesondere die Rolle der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Die Arbeit untersucht auch die Herausforderungen, die sich aus der fehlenden Rechtspersönlichkeit der EU ergeben, und diskutiert die Möglichkeiten einer stärkeren institutionellen Verankerung des Menschenrechtsschutzes.
- Die Bedeutung des institutionellen Menschenrechtsschutzes in Europa
- Die verschiedenen Ebenen des Menschenrechtsschutzes in Europa
- Die Rolle der EMRK und der Charta der Grundrechte der EU
- Die Herausforderungen der institutionellen Gestaltung des Menschenrechtsschutzes in der EU
- Möglichkeiten einer stärkeren institutionellen Verankerung des Menschenrechtsschutzes in der EU
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt den historischen Kontext des Menschenrechtsschutzes in Europa vor und betont die Bedeutung eines Mehrebenensystems. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus unterschiedlichen Rechtsordnungen und kulturellen Differenzen ergeben.
- Institutioneller Rahmen: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Institution“ und differenziert zwischen formellen und informellen Institutionen. Es stellt die Europäische Gemeinschaft als institutionelle Einrichtung vor und diskutiert die Herausforderungen, die sich aus der fehlenden Rechtspersönlichkeit der EU ergeben.
- Schutz der Menschenrechte in Europa als institutionelles Instrument: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Ebenen des Menschenrechtsschutzes in Europa. Es analysiert die Rolle der EMRK, der Charta der Grundrechte der EU und die Umsetzung des europäischen Menschenrechtsschutzes in den nationalen Rechtsordnungen.
- Institutionelle Sicherung des Europäischen Menschrechtschutzes im VVE: Dieses Kapitel untersucht die institutionellen Probleme, die sich aus der fehlenden Rechtspersönlichkeit der EU ergeben. Es beleuchtet die Gründe für die Nicht-Mitgliedschaft der EU in der EMRK und diskutiert die Möglichkeiten einer stärkeren institutionellen Verankerung des Menschenrechtsschutzes.
Schlüsselwörter
Institutioneller Menschenrechtsschutz, Europäische Union, Europäische Gemeinschaft, Europäische Menschenrechtskonvention, Charta der Grundrechte der EU, Rechtspersönlichkeit, supranationale Institutionen, intergouvernementale Beziehungen, Mehrebenensystem.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Mehrebenensystem des Menschenrechtsschutzes in Europa?
Es beschreibt den Schutz der Menschenrechte auf verschiedenen Ebenen: national durch Verfassungen, supranational durch die EU (Grundrechtecharta) und international durch den Europarat (EMRK).
Was ist der Unterschied zwischen der EMRK und der EU-Grundrechtecharta?
Die EMRK ist ein völkerrechtlicher Vertrag des Europarates, während die Grundrechtecharta spezifisch für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt.
Welche Rolle spielen der EGMR und der EuGH?
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wacht über die EMRK, während der Europäische Gerichtshof (EuGH) das EU-Recht und damit auch die Grundrechtecharta auslegt.
Warum ist die fehlende Rechtspersönlichkeit der EU ein Problem?
Ohne eigene Rechtspersönlichkeit war es der EU lange Zeit erschwert, internationalen Abkommen wie der EMRK beizutreten, was zu institutionellen Lücken im Rechtsschutz führte.
Wie wirkt die EMRK im innerstaatlichen Recht der Nationen?
Die Arbeit untersucht, wie die Bestimmungen der Konvention in nationales Recht inkorporiert werden und welche Bindungswirkung sie für nationale Gerichte haben.
- Quote paper
- Cindy Schemmel (Author), 2007, Institutioneller Menschenrechtsschutz in Europa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165504