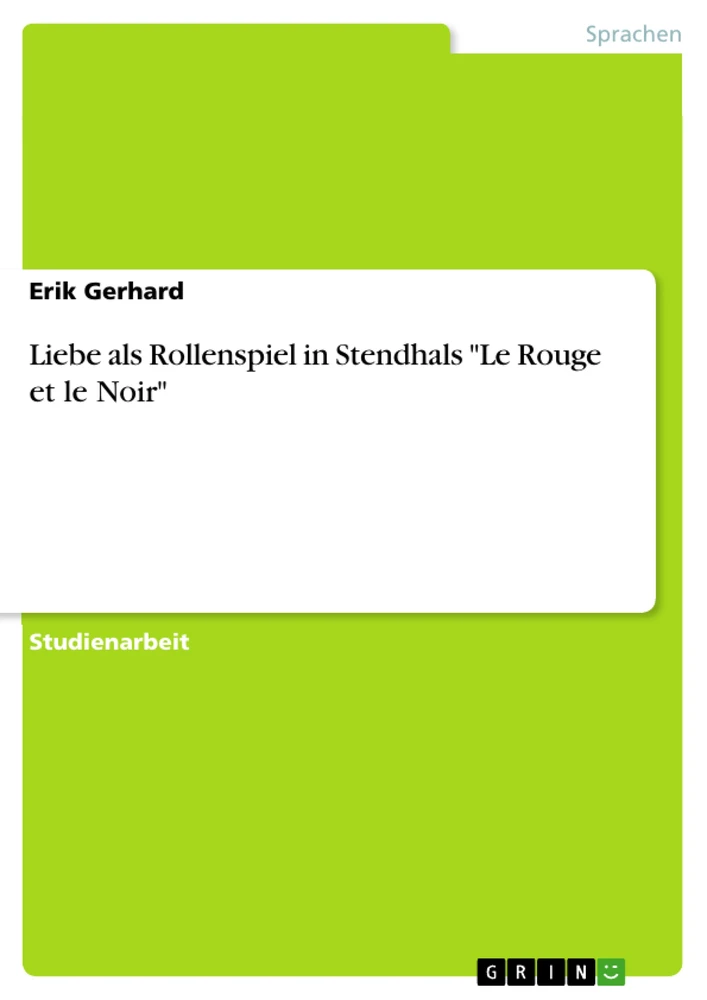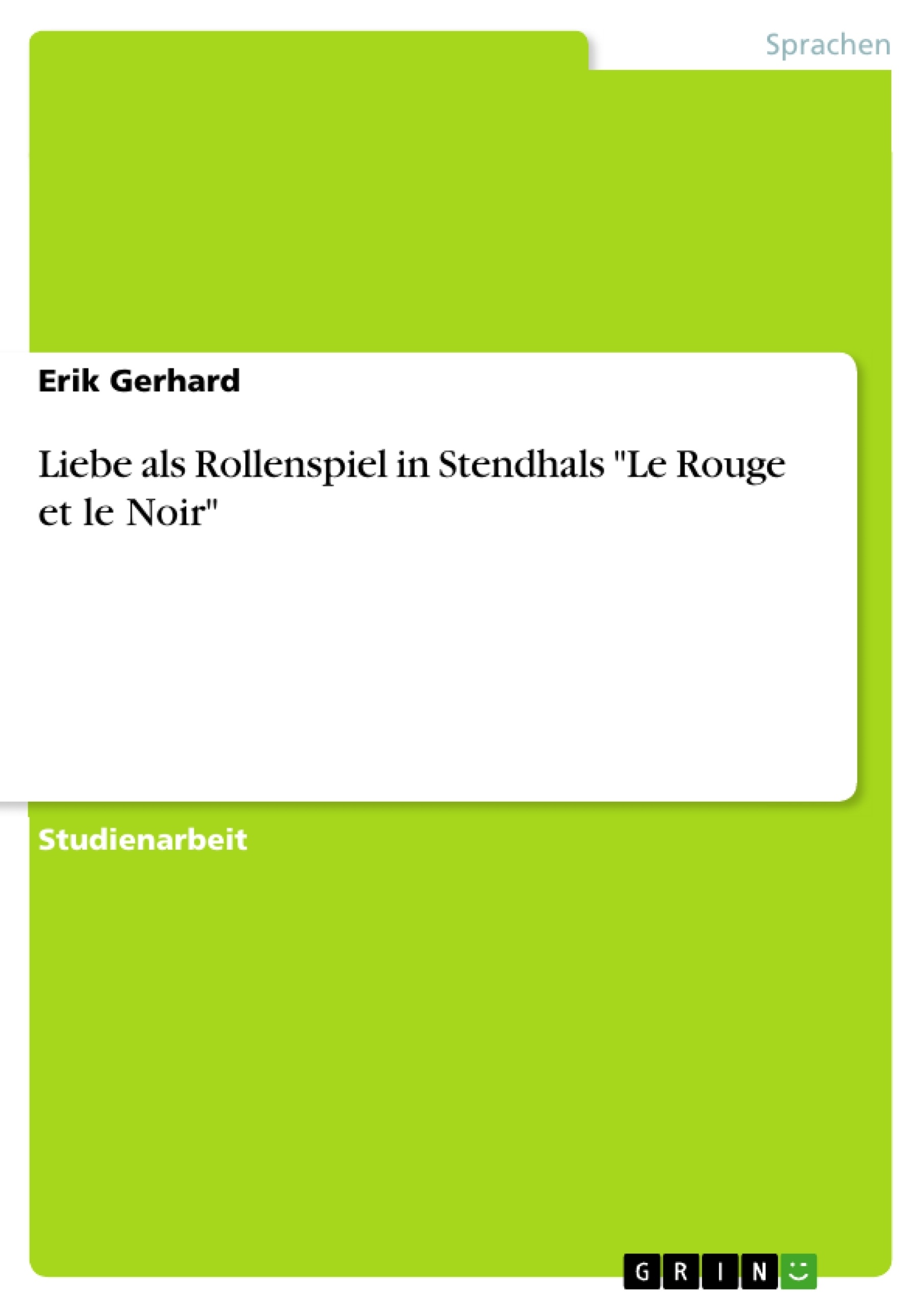Der Roman Le Rouge et le Noir von Stendhal erzählt die Geschichte des Sohns eines Mühlenbesitzers aus der französischen Provinz, Julien Sorel. Die Handlung spielt in der französischen Restauration, unmittelbar in der Zeit vor 1830. Im Mittelpunkt des Romans steht der soziale Aufstieg des Helden Julien, dem es gelingt, seiner niederen Herkunft zu entfliehen. Um in der Zeit der Restauration sein Glück zu machen, entscheidet sich Julien Priester zu werden. Dank seiner Intelligenz und Willenskraft bekommt er schnell eine Anstellung als Lehrer im Hause des Bürgermeisters von Verrières. Nachdem bekannt wird, dass Julien mit Mme de Rênal, der Frau des Bürgermeisters, eine Affäre hat, muss dieser Verrières verlassen. Ihm wird ein Platz im Priesterseminar von Besançon vermittelt, wo er zum Protegé des Seminarleiters, Abbé Pirard, wird. Durch den Einfluss des Abts erhält Julien schließlich eine Anstellung als Sekretär beim Marquis de la Mole, einem hochangesehenen Diplomaten in Paris.
Der Held betritt nun eine gänzlich neue Welt, die des alten Adels. Er wird täglich mit Reichtum und Überfluss konfrontiert und er spürt seine standesbedingte Unterlegenheit, die er aber nicht akzeptieren möchte.
Julien lernt die Tochter des Marquis de la Mole kennen, Mathilde. Schon bald entwickelt sich zwischen [den beiden] eine geheime Liebesbeziehung.
Die folgende Hausarbeit macht es sich zur Aufgabe, herauszuarbeiten, wieso man die Liebesbeziehung zwischen Julien und Mathilde als Rollenspiel bezeichnen muss, wieso man hierbei gerade nicht von aufrichtiger Liebe sprechen kann. So gilt es festzustellen, was dieses
Rollenspiel auszeichnet. Im Hinterkopf soll bei der Analyse stets die Fragestellung behalten werden, wie das Rollenspiel bewertet werden kann.
Dazu gilt es zunächst, die imaginären Rollen vorzustellen, die die beiden Hauptfiguren annehmen und durch die sie versuchen, sich von den gesellschaftlichen Zuständen ihrer Zeit zu distanzieren: Julien als Napoléon und Mathilde als Marguerite de Navarre. In einem nächsten Schritt soll der Leser kurz in die Grundlagen der Moralistik von La Rochefoucauld eingeführt werden, bevor die Bedeutung der Moralistik für das Rollenspiel in Le Rouge et le Noir dann im folgenden Abschnitt
an exemplarischen Textstellen erläutert wird. Im letzten Kapitel geht es um die Beantwortung der Frage, welche Bewertungsmöglichkeiten das Rollenspiel zulässt. Abschließend wird ein Fazit nochmals die wesentlichen Aspekte der Hausarbeit resümieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Nachahmung historischer Idole
- Julien als Napoléon
- Mathilde als Marguerite de Navarre
- Die Moralistik von La Rochefoucauld
- Die Rolle der Moralistik in Le Rouge et le Noir
- Die Entscheidung zur „Liebe“
- Liebe als Machtspiel
- Bewertungsmöglichkeiten des Rollenspiels
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Liebesbeziehung zwischen Julien und Mathilde in Stendhals Roman „Le Rouge et le Noir“ und untersucht, warum diese Beziehung als Rollenspiel bezeichnet werden muss. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob von aufrichtiger Liebe die Rede sein kann und welche Faktoren dieses Rollenspiel auszeichnen. Die Analyse zielt darauf ab, die Bewertungsmöglichkeiten des Rollenspiels zu erforschen, wobei insbesondere Stendhals Perspektive berücksichtigt wird.
- Die Nachahmung historischer Idole durch Julien und Mathilde
- Der Einfluss der Moralistik von La Rochefoucauld auf die Beziehung
- Die Darstellung von Liebe als Machtspiel
- Die Rolle von gesellschaftlichen Strukturen und Standesunterschiede
- Die Bewertungsmöglichkeiten des Rollenspiels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Handlung von „Le Rouge et le Noir“ ein und stellt den Protagonisten Julien Sorel sowie seine gesellschaftliche Position in der Zeit der französischen Restauration vor. Sie benennt die zentrale Frage der Hausarbeit: Warum ist die Liebesbeziehung zwischen Julien und Mathilde ein Rollenspiel?
Das zweite Kapitel beleuchtet die Nachahmung historischer Idole durch Julien und Mathilde. Julien verehrt Napoleon Bonaparte und sieht in ihm ein Vorbild für seinen eigenen Aufstieg. Mathilde hingegen identifiziert sich mit Marguerite de Navarre und flüchtet in die Welt der Geschichte, um dem langweiligen Adelsleben zu entkommen.
Das dritte Kapitel gibt eine kurze Einführung in die Moralistik von La Rochefoucauld, die die Grundlage für die Analyse der Beziehung zwischen Julien und Mathilde liefert.
Das vierte Kapitel untersucht die Rolle der Moralistik im Roman und zeigt auf, wie die Entscheidung zur „Liebe“ und die Darstellung von Liebe als Machtspiel durch die Moralistik geprägt werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind: "Le Rouge et le Noir", Stendhal, Julien Sorel, Mathilde de la Mole, Rollenspiel, Liebe, Moralistik, La Rochefoucauld, gesellschaftliche Strukturen, Standesunterschiede, Aufstieg, Napoleon, Marguerite de Navarre, Restauration.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Stendhals Roman "Le Rouge et le Noir"?
Der Roman thematisiert den sozialen Aufstieg des Julien Sorel während der französischen Restauration, der versucht, durch eine Priesterlaufbahn und Beziehungen zum Adel seine niedere Herkunft zu überwinden.
Warum wird die Beziehung zwischen Julien und Mathilde als Rollenspiel bezeichnet?
Die Beziehung basiert weniger auf aufrichtiger Liebe als vielmehr auf der Nachahmung historischer Vorbilder und dem Wunsch, sich durch diese Rollen von den gesellschaftlichen Zuständen der Zeit zu distanzieren.
Welche historischen Idole ahmen die Hauptfiguren nach?
Julien Sorel orientiert sich an Napoléon Bonaparte als Vorbild für seinen Aufstieg, während Mathilde de la Mole sich mit Marguerite de Navarre identifiziert.
Welche Rolle spielt die Moralistik von La Rochefoucauld in der Analyse?
Die Moralistik dient als theoretische Grundlage, um die "Liebe" im Roman als ein von Eigenliebe und Machtkalkül geprägtes Spiel zu entlarven.
Wie beeinflussen Standesunterschiede die Handlung?
Julien spürt in der Welt des Adels ständig seine Unterlegenheit, was seinen Ehrgeiz antreibt und die Dynamik seiner Beziehungen maßgeblich beeinflusst.
- Citar trabajo
- Erik Gerhard (Autor), 2010, Liebe als Rollenspiel in Stendhals "Le Rouge et le Noir", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165535