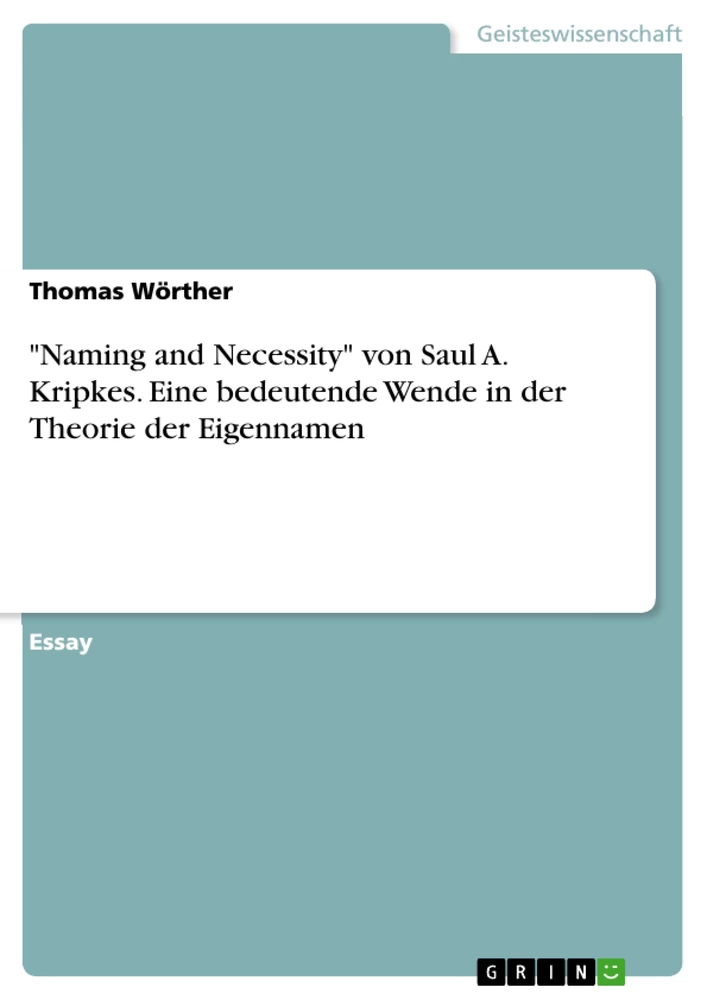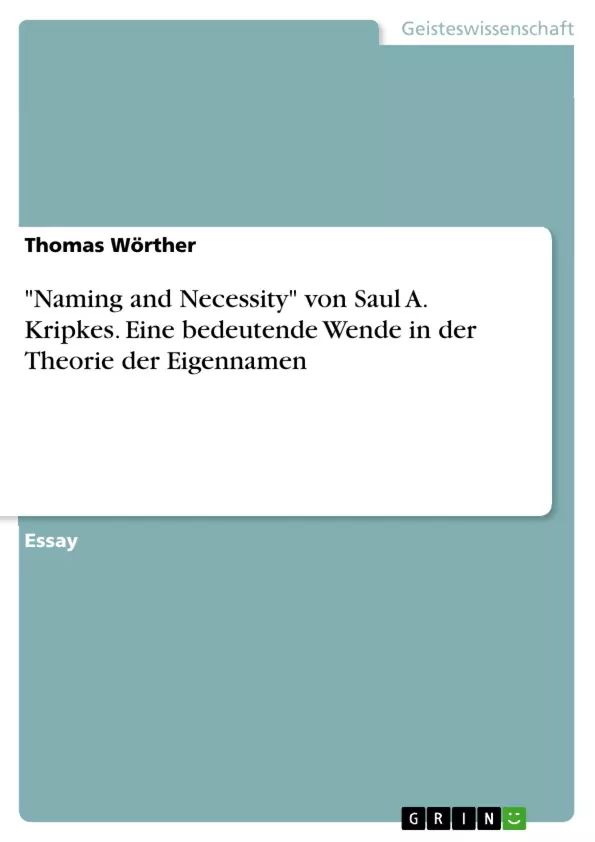Eine bedeutende Wende in der Theorie der Eigennamen wurde durch Saul A. Kripkes 1972 erschienene Vorträge "Naming and Necessity" eingeleitet. Hierin verwirft er die gesamte bisherige Eigennamentheorie der analytischen Philosophie.
Für Kripke stehen Eigennamen zwar für einen Gegenstand, sie haben aber, wie schon zuvor bei Mill, keine Bedeutung. Kripkes Kritik richtet sich somit in erster Linie gegen die Beschreibungs- und Bündeltheorie. Darin wird behauptet, daß der Träger eines Eigennamens derjenige Gegenstand ist, der als einziger die Beschreibungen oder die Mehrzahl aus einem Bündel von Beschreibungen erfüllt, die wir mit dem Namen verbinden.
Kripke entwickelt dagegen folgendes Bild: Würde jemand, der mit dem Namen "Kolumbus" "der Entdecker Amerikas" verbindet, erfahren, daß ein Normanne Amerika Jahre früher entdeckt hat, den Namen "Kolumbus" fortan auf diesen Normannen übertragen? Sicherlich nicht. Kripke zeigt damit, daß der Gegenstand Träger des Namens bleibt, selbst wenn alle seine Beschreibungen falsch sind. Folglich können die Beschreibungen nicht die Bedeutung eines Eigennamens ausmachen.
Inhaltsverzeichnis
- Kripke
- Kritiker
- Dummett
- Reinhardt
- Kuzminski
- Searle
- Evans
- Burkhardt
- Wolf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Kripkes Theorie der Eigennamen und die darauf folgenden kritischen Auseinandersetzungen. Ziel ist es, die zentralen Argumente Kripkes und seiner wichtigsten Kritiker darzustellen und zu vergleichen.
- Kripkes kausale Namentheorie
- Kritik an der Beschreibungstheorie
- Der Begriff der starren Bezeichnung
- Verschiedene kritische Ansätze
- Vergleichende Analyse der Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
Kripke: Kripkes wegweisende Arbeit "Naming and Necessity" revolutionierte die Eigennamentheorie. Er widerlegte die gängige Beschreibungs- und Bündeltheorie, die besagt, dass Eigennamen Bedeutungen durch Beschreibungen erhalten. Kripke argumentierte, dass Eigennamen zwar auf Gegenstände verweisen, aber keine Bedeutung im traditionellen Sinne haben. Der Gegenstand bleibt der Träger des Namens, selbst wenn alle damit verbundenen Beschreibungen falsch sind. Er führte den Begriff der starren Bezeichnung ein, der besagt, dass Eigennamen denselben Gegenstand in allen möglichen Welten bezeichnen. Kripke betont die Rolle der "Taufe" und die Übertragung des Namens durch eine kausale Kommunikationskette, wobei die Sprecherintention zentral ist. Der Referenzbegriff wird als irreduzibel postuliert.
Kritiker: Die Reaktionen auf Kripkes Theorie lassen sich in drei Gruppen einteilen: Übernahme und Weiterentwicklung, Verteidigung der klassischen Theorie und Verbindung beider Ansätze. Die Arbeit konzentriert sich auf die zweite und dritte Gruppe. Dummett kritisiert die Irreduzibilität des Referenzbegriffs und greift auf die Beschreibungstheorie zurück. Reinhardt betont die Notwendigkeit eindeutiger Kennzeichnungen zur Vermeidung mehrdeutiger Beziehungen. Kuzminski argumentiert, dass auch Kripkes Theorie implizit auf Kennzeichnungen beruht, jedoch auf innere statt äußere Eigenschaften. Searle versucht, die Bedeutung von Eigennamen im Rahmen einer Intentionalitätstheorie zu erklären, wobei die mentale Referenz im Vordergrund steht. Evans verbindet kausale und deskriptive Elemente, während Burkhardt je nach Kontext zwischen klassischer und kausaler Theorie unterscheidet. Wolf integriert Aspekte der kausalen Theorie, bestreitet aber, dass Eigennamen bedeutungslos sind.
Schlüsselwörter
Eigennamen, Kripke, kausale Namentheorie, Beschreibungstheorie, starre Bezeichnung, Referenz, Bedeutung, Intentionalität, Dummett, Reinhardt, Searle, Evans, Burkhardt, Wolf, Kennzeichnung, kontrafaktische Situationen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kripkes Kausale Namentheorie und ihre Kritik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Kripkes Theorie der Eigennamen und die darauf folgenden kritischen Auseinandersetzungen. Das Ziel ist der Vergleich der zentralen Argumente Kripkes mit denen seiner wichtigsten Kritiker.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Kripkes kausale Namentheorie, die Kritik an der Beschreibungstheorie, den Begriff der starren Bezeichnung, verschiedene kritische Ansätze gegenüber Kripkes Theorie (u.a. von Dummett, Reinhardt, Kuzminski, Searle, Evans, Burkhardt und Wolf) und eine vergleichende Analyse der verschiedenen Theorien.
Was ist Kripkes zentrale These?
Kripke widerlegt in "Naming and Necessity" die Beschreibungs- und Bündeltheorie von Eigennamen. Er argumentiert, dass Eigennamen zwar auf Gegenstände verweisen, aber keine Bedeutung im traditionellen Sinne haben. Die Referenz bleibt bestehen, selbst wenn alle damit verbundenen Beschreibungen falsch sind. Zentral ist der Begriff der starren Bezeichnung und die Rolle der "Taufe" und der kausalen Übertragung des Namens.
Welche Kritikpunkte an Kripkes Theorie werden diskutiert?
Die Kritikpunkte lassen sich in verschiedene Gruppen einteilen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Kritik, die die klassische Theorie verteidigt oder Ansätze beider Theorien verbindet. Dummett kritisiert die Irreduzibilität des Referenzbegriffs, Reinhardt die Notwendigkeit eindeutiger Kennzeichnungen, Kuzminski die implizite Verwendung von Kennzeichnungen bei Kripke, Searle den Erklärungsansatz mittels Intentionalität, Evans die Verbindung von kausalen und deskriptiven Elementen, Burkhardt den kontextabhängigen Gebrauch der Theorien und Wolf die Behauptung, Eigennamen seien bedeutungslos.
Welche Autoren werden neben Kripke behandelt?
Die Arbeit behandelt neben Kripke die Kritikpunkte von Dummett, Reinhardt, Kuzminski, Searle, Evans, Burkhardt und Wolf.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die Schlüsselbegriffe sind Eigennamen, Kripkes kausale Namentheorie, Beschreibungstheorie, starre Bezeichnung, Referenz, Bedeutung, Intentionalität, Kennzeichnung und kontrafaktische Situationen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und eine Liste mit Schlüsselwörtern. Sie beschreibt detailliert Kripkes Theorie und die wichtigsten Gegenargumente seiner Kritiker.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, welches sich mit der Philosophie des Sprachgebrauchs, insbesondere der Namentheorie, auseinandersetzt.
- Citar trabajo
- Thomas Wörther (Autor), 2005, "Naming and Necessity" von Saul A. Kripkes. Eine bedeutende Wende in der Theorie der Eigennamen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165564