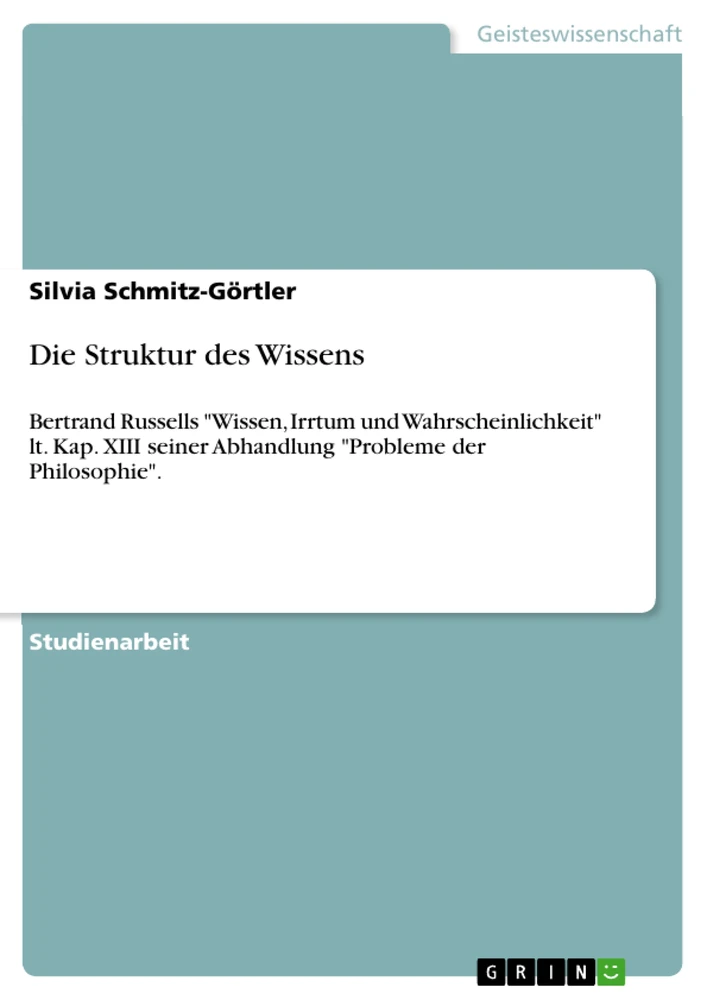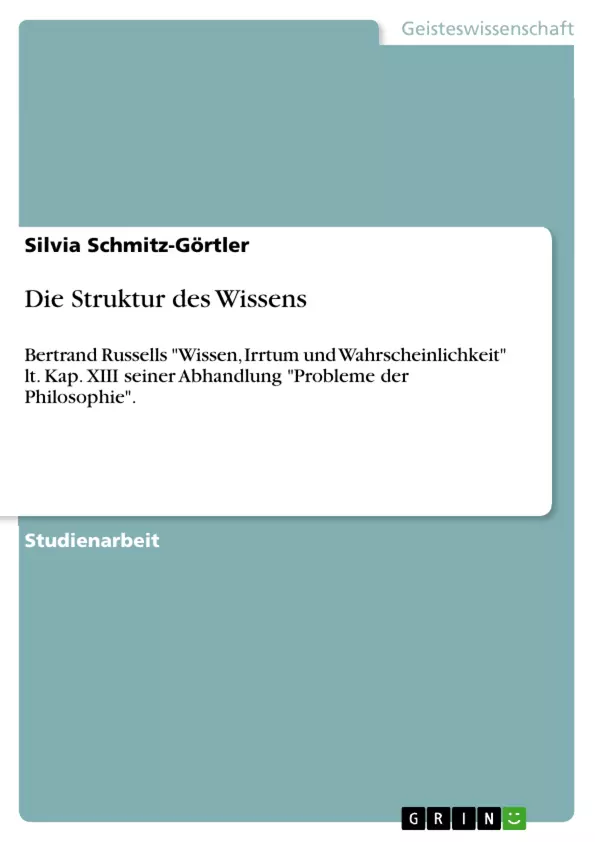Wie können wir wissen, was wahr oder falsch ist? Dieser Frage widmet Bertrand Russel ein eigenes Kapitel in einer ersten einfachen Auseinandersetzung mit der Erkenntnistheorie Problems of Philosophy (1912, dt. Probleme der Philosophie). Hierin bezeichnet Russell als eine der Hauptaufgaben der Philosophie das Ordnen und Organisieren von Wissen mit dem Ziel des Ausschlusses von Zweifeln. Diesen frühen philosophischen Standpunkt bezeichnet er selbst als analytischen Realismus. Realismus versteht sich im Sinne von nichtmentalen unabhängigen Enitäten, unabhängig vom erkennenden Subjekt, aus denen sich die Welt zusammensetzt. Das Subjekt tritt in erkenntnismäßige Relationen zu den Gegenständen der Welt. Der Akt der Erkenntnis verändert diese Relationen nicht, denn diese sind extern. Analytisch ist Russells Realismus dadurch, dass das Komplexe in Abhängigkeit zum Einfachen steht und nicht umgekehrt. Ein Objekt bleibt unverändert, ob als Teil eines komplexen Objekts oder nicht. Ob wir Teile oder Ausschnitte der Welt erkennen, das Objekt bleibt unverändert, eine Verfälschung ist nicht möglich. Russell sieht hinter den vagen und unbestimmten Alltagserscheinungen eine höhere, genau bestimmtere und präzisere Welt, deren Gegenstände und Relationen ebenso genau und präzise bestimmt werden können. Die Welt ist für den frühen Russell eine logische Welt. Diese hat eine logische Struktur, die allerdings erst durch die logische Analyse gefunden werden muss, denn an der Oberfläche liegen Vagheit und Unbestimmtheit. Erst im Laufe seiner späteren Arbeit verabschiedet sich Russell allmählich von seinem logischen Weltbild, indem er eingesteht, dass die logische Struktur der Welt allererst durch große begriffliche Anstrengungen erfordernde Analysen herausgearbeitet werden muss, um schließlich sehr viel später einzusehen, dass sich Vagheit und Unbestimmtheit in der Erkenntnis der wirklichen Welt nicht verbannen lassen.
Die vorliegende Hausarbeit Die Struktur des Wissens in Bertrand Russells Wissen, Irrtum und Wahrscheinlichkeitsglaube lt. Kapitel XIII der erkenntnistheoretischen Abhandlung Probleme der Philosophie folgt der logischen Analyse Russells auf dem Weg zu seiner komplexen Theorie des Wissens, die ein logisches Wissensideal impliziert, das Russell als absolute Grenze, die niemals erreichbar ist, logisch konstruiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel XIII im erkenntnistheoretischen Gesamtduktus der Probleme der Philosophie
- Wissen als ...
- ...das Wissen der Wahrheit
- Abgeleitetes Wissen
- Intuitives Wissen
- das Wissen von Dingen
- Wissen durch Beschreibung
- Wissen durch Bekanntschaft
- ...das Wissen der Wahrheit
- Wissen, Irrtum, Wahrscheinlichkeitsglaube
- Das Wissen
- Irrtum und Wahrscheinlichkeitsglaube
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Struktur des Wissens in Bertrand Russells "Wissen, Irrtum und Wahrscheinlichkeitsglaube" und analysiert das Kapitel XIII seiner erkenntnistheoretischen Abhandlung "Probleme der Philosophie". Ziel der Arbeit ist es, Russells logische Analyse des Wissens zu verfolgen und seine komplexe Theorie des Wissens aufzuzeigen, die ein logisches Wissensideal impliziert, das er jedoch durch die Einführung des Wahrscheinlichkeitsglaubens relativiert.
- Die logische Struktur des Wissens nach Russell
- Das Wissen der Wahrheit und das Wissen von Dingen
- Die verschiedenen Formen des Wissens (abgeleitetes, intuitives, Wissen durch Beschreibung, Wissen durch Bekanntschaft)
- Die Beziehung zwischen Wissen, Irrtum und Wahrscheinlichkeitsglaube
- Die Unmittelbarkeit des Wissens in der logischen Analyse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer kurzen Einordnung von Kapitel XIII der "Probleme der Philosophie" in den Gesamtduktus der Abhandlung. Anschließend werden die verschiedenen Formen des Wissens nach Russell analysiert, beginnend mit dem Wissen der Wahrheit und dem Wissen von Dingen. Die Analyse erfolgt entlang der Argumentationsstruktur von Kapitel XIII.
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird das Wissen als Wahrheit, Irrtum und Wahrscheinlichkeitsglaube näher beleuchtet und einer kritischen Prüfung unterzogen. Dabei wird auch die Korrespondenztheorie und ihre Problematik im Kontext des menschlichen Handlungs- und Praxisbezugs der Wahrheit diskutiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Fokus-Themen der Arbeit sind: Bertrand Russell, Erkenntnistheorie, Wissen, Irrtum, Wahrscheinlichkeitsglaube, logische Analyse, Wissen der Wahrheit, Wissen von Dingen, abgeleitetes Wissen, intuitives Wissen, Wissen durch Beschreibung, Wissen durch Bekanntschaft, Korrespondenztheorie, Evidenz, "Probleme der Philosophie", Kapitel XIII.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Philosophie laut Bertrand Russell?
Russell sieht eine Hauptaufgabe darin, Wissen zu ordnen und zu organisieren, um Zweifel auszuschließen und eine präzise Struktur der Welt zu finden.
Was unterscheidet "Wissen durch Bekanntschaft" von "Wissen durch Beschreibung"?
Wissen durch Bekanntschaft ist die direkte Wahrnehmung von Sinnesdaten; Wissen durch Beschreibung ist indirektes Wissen über Dinge, die wir nicht unmittelbar erfahren.
Was versteht Russell unter "Wahrscheinlichkeitsglaube"?
Da absolutes Wissen oft unerreichbar ist, stützt sich unsere Erkenntnis meist auf Grade von Wahrscheinlichkeit, die zwischen sicherem Wissen und Irrtum liegen.
Was bedeutet "analytischer Realismus" bei Russell?
Es ist die Ansicht, dass die Welt aus unabhängigen Entitäten besteht und dass komplexe Dinge durch die Analyse ihrer einfachen Bestandteile verstanden werden können.
Warum revidierte Russell später sein logisches Weltbild?
Er erkannte, dass Vagheit und Unbestimmtheit in der Erkenntnis der wirklichen Welt niemals vollständig verbannt werden können.
- Quote paper
- B.A. Silvia Schmitz-Görtler (Author), 2010, Die Struktur des Wissens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165613