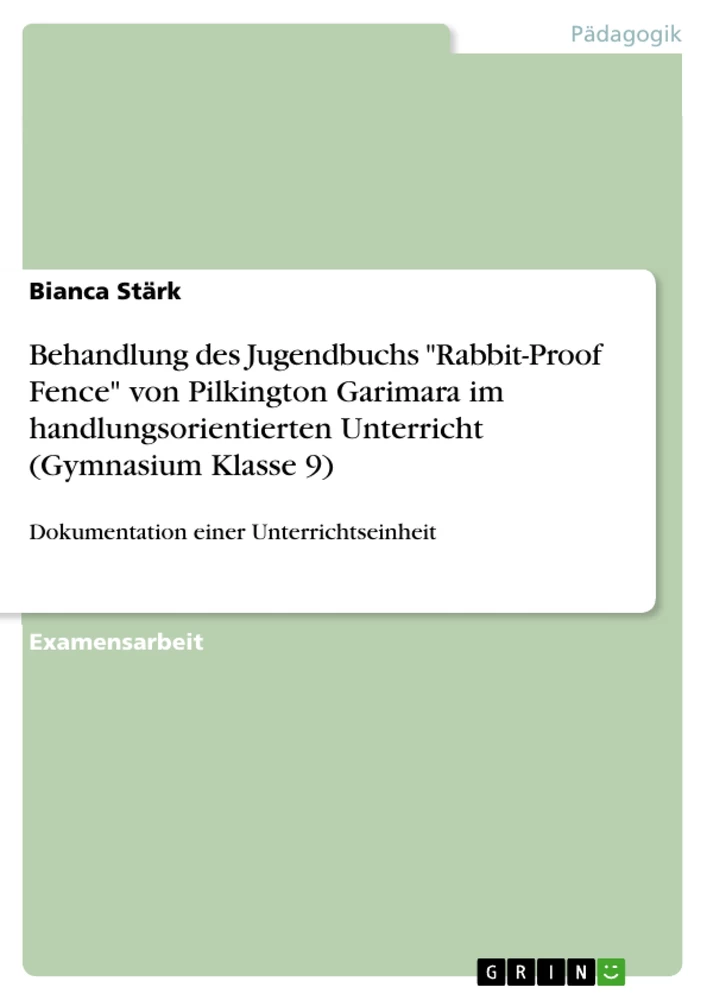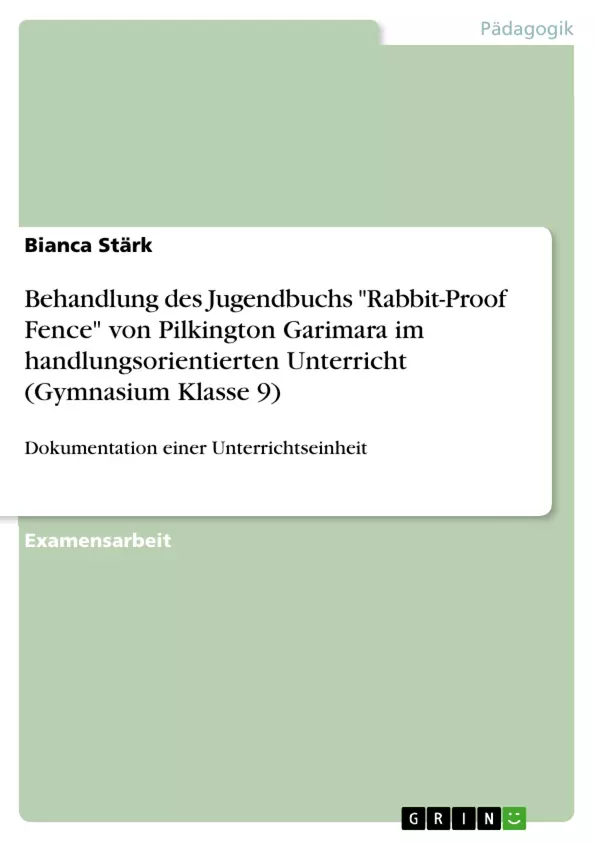Australien, ein Kontinent der Weiten und einer exotischen, auf der Welt einmaligen Flora und Fauna. Aber nicht nur das, Australien ist auch die Heimat der Aborigines, der Ureinwohner Australiens. Die wenigsten Menschen wissen von der unmenschlichen Schmach, die Aboriginefamilien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erleiden mussten. Mischlingskinder wurden den Familien weggenommen und in Camps untergebracht mit der Absicht, sie wie Europäer zu erziehen und später als Bedienstete in weiße Haushalte zu schicken. Der Hintergedanke dabei war, die Verbreitung der Aboriginegene zu unterbinden.
Die Mischlingskinder sollten später weiße Partner erhalten und so über mehrere Generationen hinweg wieder ‚weiß' werden. Was diese Politik für die betroffenen Familien bedeutete, ist unvorstellbar. Mithilfe des Buches Rabbit-proof Fence sollte in dieser Unterrichtseinheit den Schülern die Vergangenheit der Aborigines nahe gebracht werden. Reist man durch den fünften Kontinent, sieht man in den Städten oftmals Aborigines im mittleren Alter mit leerem Blick und alkoholabhängig in den Parks und Einkaufszentren ihr Dasein fristen. Erst mit dem Hintergrundwissen über das, was dieser Generation von Menschen, der so genannten ‚stolen generation' angetan wurde, kann man die Lebenssituation dieser Menschen nachvollziehen.
Dieses Hintergrundwissen in Form einer authentischen Geschichte soll der Mittelpunkt der Unterrichtseinheit in einer 9. Klasse sein. Die Schülerinnen und Schüler sollen neben grundlegendem Faktenwissen über Australien einen Einblick in die Welt der ursprünglichen Herren des Kontinents bekommen. Sie sollen nachvollziehen können, was in den Aboriginefamilien damals vorgegangen sein muss und wie sie behandelt wurden und teilweise noch heute behandelt werden. Für die Schülerinnen und Schüler ist es das zweite Buch, das sie in der Fremdsprache Englisch lesen. Es stellt sich somit die Frage nach der Wahl der Methoden, um die Schüler angemessen zu fördern. Die Frage nach den Ergebnissen, die in so kurzer Zeit erzielt werden sollen, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Wahl der Methoden.
In der Dokumentation sollen diese und weitere Fragen geklärt werden. Der erste Teil beinhaltet die didaktisch-methodische Analyse, in der die Voraussetzungen für die Unterrichtseinheit erörtert werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIDAKTISCH-METHODISCHE ANALYSE
- Voraussetzungen in der Klasse
- Voraussetzungen die Lehrperson betreffend
- Sachanalyse
- Thema und Begründung der Auswahl
- Didaktische Reduktion
- Festlegung der Lernziele
- Kognitive Lernziele der Einheit
- Instrumentelle Lernziele der Einheit
- Affektive Lernziele der Einheit
- Methodische Analyse
- DURCHFÜHRUNG
- Tabellarische Übersicht über die Unterrichtseinheit
- Durchführung der Unterrichtseinheit
- Erste Stunde: The kidnapping of Aborigine-children in history
- Zweite Stunde: The kidnapping of the three girls in a comic strip
- Dritte Stunde: „The road not taken“
- Vierte Stunde:,,Mrs Flanagan was a cruel woman.“
- Fünfte Stunde: Seventy years later; How to write a screenplay
- Sechste Stunde: Writing a screenplay I.
- Siebte Stunde: Writing a screenplay II + role-plays I.
- Achte Stunde: Role-plays II + Filming I.
- Neunte Stunde: Filming II
- Zehnte Stunde: Evaluation of the short movies/ reading journals
- LEISTUNGSKONTROLLE (KA/ TESTS)
- Vokabeltest
- Klassenarbeit
- SCHLUSSBETRACHTUNG
- LITERATURVERZEICHNIS
- ANHANG – ÜBERSICHTSBLATT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtseinheit zielt darauf ab, den Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse ein tieferes Verständnis der Geschichte der Aborigines in Australien zu vermitteln. Sie sollen die brutale Vergangenheit der „stolen generation“ kennenlernen und die Auswirkungen dieser Politik auf die heutigen Aborigines verstehen. Die Schüler sollen außerdem Einblicke in die Welt der ursprünglichen Herren des Kontinents erhalten und die Lebensbedingungen der Aborigines aus einer neuen Perspektive betrachten.
- Die Geschichte der „stolen generation“ in Australien
- Die Auswirkungen der „stolen generation“ auf die heutigen Aborigines
- Die Kultur und Lebensweise der Aborigines
- Der Umgang mit dem Roman „Rabbit-proof Fence“ im handlungsorientierten Unterricht
- Die Entwicklung von Filmkompetenz bei den Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Unterrichtseinheit vor und erläutert die Relevanz des Themas. Die didaktisch-methodische Analyse beinhaltet eine detaillierte Beschreibung der Voraussetzungen der Klasse, der Lehrperson und des Themas. Es werden die Lernziele der Einheit definiert und die methodische Vorgehensweise erläutert. Die Durchführung der Unterrichtseinheit wird in einer tabellarischen Übersicht dargestellt und die einzelnen Stunden werden detailliert beschrieben, einschließlich der verwendeten Materialien und Methoden. Die Kapitel zur Leistungskontrolle und der Schlussbetrachtung werden in dieser Vorschau nicht behandelt, um den Leser nicht vorzeitig über die Ergebnisse der Einheit zu informieren.
Schlüsselwörter
Aborigines, Australien, „stolen generation“, „Rabbit-proof Fence“, handlungsorientierter Unterricht, Filmkompetenz, Kultur, Geschichte, Identität, Soziales, Rassismus, Kolonialismus
- Quote paper
- Bianca Stärk (Author), 2008, Behandlung des Jugendbuchs "Rabbit-Proof Fence" von Pilkington Garimara im handlungsorientierten Unterricht (Gymnasium Klasse 9), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165656