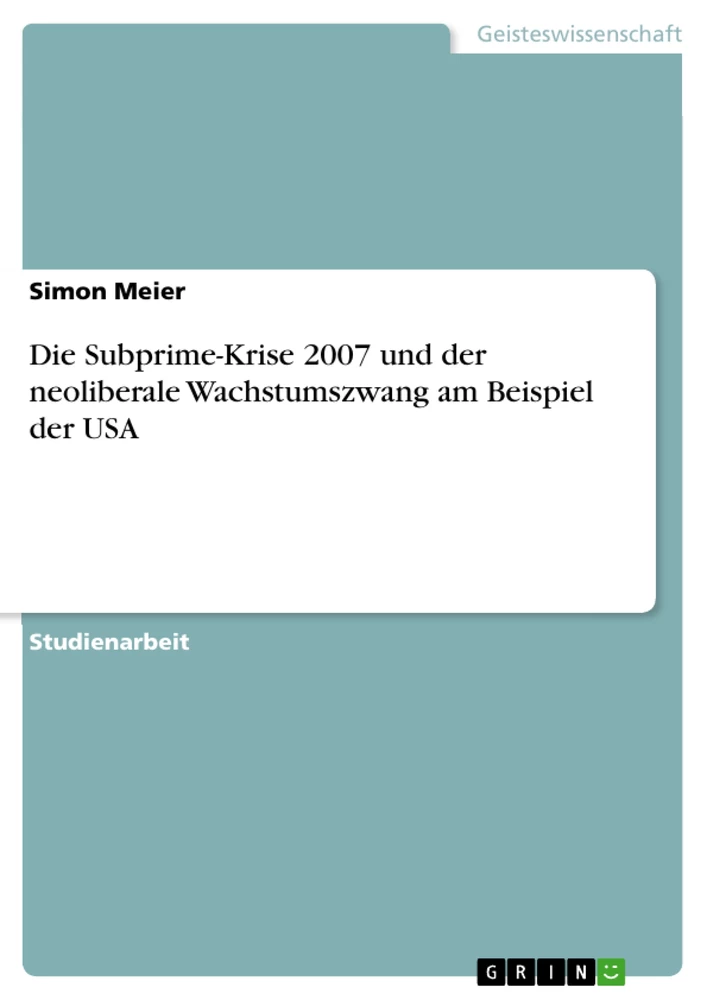Als im Frühling 2007 die Welt in eine globale Finanz- und in Folge Wirtschaftskrise rutschte, platzte nicht nur die amerikanische Immobilienblase als Resultat nicht gedeckter Subprime-Kredite und mit ihr scheinbar die Kreditwürdigkeit zahlreicher Finanzinstitute, sondern auch der neoliberale Mythos eines natürlichen, stetigen Wirtschaftswachstums. Die Angewiesenheit auf Wachstum, so meine Ausgangsthese, ist ein Zwang, dem das Funktionieren des neoliberalen Finanzsystems unterliegt. Dieser Zwang wälzt sich in kulturellen Determinanten auf das Handeln des Einzelnen ab, der durch gesellschaftliche Strukturen, Ethiken und Anreize dazu angehalten wird, durch Produktivität, Konsumwille und Konformität seinen Beitrag zur Wachstumsdynamik zu leisten. Im Verlaufe dieser Arbeit möchte ich den verschiedenen Facetten dieser These genauer nachgehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wirtschaftsethnologische Diskurse und Wachstumszwang
- Das wirtschaftsethnologische Paradigma
- Wachstumszwang aus formalistischer Perspektive
- Wachstumszwang aus substantivistischer Perspektive
- Produktivität und Konsum in der politischen Ökonomie
- Das Paradigma der politischen Ökonomie
- Der Zwang zur Produktivität
- Die Produktion von Bedürfnissen
- Fallbeispiel Subprime-Krise der USA
- Der Zwang zur Wertschöpfung und die Wall Street
- Der Glaube in Modelle
- Die Produktion von Bedürfnissen und die Verteilung von Risiken
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zwang zu stetigem Wirtschaftswachstum im neoliberalen Finanzsystem und dessen Auswirkungen auf das Handeln des Einzelnen. Die Arbeit zeigt auf, wie dieser Zwang in kulturellen Determinanten verankert ist und den Einzelnen durch gesellschaftliche Strukturen, Ethiken und Anreize dazu bewegt, durch Produktivität, Konsumwille und Konformität seinen Beitrag zur Wachstumsdynamik zu leisten.
- Die Rolle des Wachstumszwangs im neoliberalen Finanzsystem
- Die Einbettung von Wirtschaftsethnologien in kulturelle Determinanten
- Das Verhältnis von Produktivität, Konsum und Konformität zum Wachstumszwang
- Die Subprime-Krise der USA als Fallbeispiel für die Folgen des Wachstumszwangs
- Die Kritik am homo oeconomicus und die Relevanz des substantivistischen Paradigmas
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die These vor, dass der neoliberale Mythos eines natürlichen Wirtschaftswachstums durch die Subprime-Krise 2007 widerlegt wurde. Die Arbeit untersucht den Wachstumszwang als Kern des neoliberalen Finanzsystems und die daran beteiligten kulturellen Faktoren.
Kapitel 2 führt in die wirtschaftsethnologischen Paradigmen ein und analysiert den Wachstumszwang aus formalistischer und substantivistischer Sichtweise. Die formalistische Theorie betont die rationale und egoistische Natur des Menschen, während die substantivistische Theorie die soziale Einbettung von Wirtschaftssystemen und die kulturelle Determinierung von Handeln hervorhebt.
Kapitel 3 beleuchtet die Rolle von Produktivität und Konsum in der politischen Ökonomie. Der Zwang zur Produktivität und die Produktion von Bedürfnissen werden als zentrale Elemente des neoliberalen Systems dargestellt.
Kapitel 4 analysiert die Subprime-Krise der USA als Fallbeispiel für den Wachstumszwang. Die Wall Street, der Glaube an Finanzmodelle und die Verteilung von Risiken werden als entscheidende Faktoren der Krise identifiziert.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen wie Wachstumszwang, Neoliberalismus, Subprime-Krise, Wirtschaftsethnologie, formalistische und substantivistische Theorie, Produktivität, Konsum, politische Ökonomie, homo oeconomicus, Kultur, gesellschaftliche Strukturen, Ethiken und Anreize. Die Analyse fokussiert auf die Zusammenhänge zwischen dem neoliberalen Finanzsystem, kulturellen Determinanten und dem Handeln des Einzelnen im Kontext von Wirtschaftswachstum.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „neoliberale Wachstumszwang“?
Es ist die These, dass das moderne Finanzsystem auf stetiges Wirtschaftswachstum angewiesen ist, um stabil zu bleiben, was Druck auf den Einzelnen ausübt.
Wie hängen Produktivität und Konsum mit der Krise zusammen?
Der Zwang zu ständiger Produktivität und die künstliche Erzeugung von Konsumbedürfnissen führten zur riskanten Kreditvergabe im Vorfeld der Subprime-Krise.
Was war die Ursache der Subprime-Krise 2007?
Das Platzen der amerikanischen Immobilienblase aufgrund massenhafter Ausfälle ungedeckter Hypothekenkredite (Subprime-Kredite).
Was kritisiert der „substantivistische“ Ansatz am Homo Oeconomicus?
Er betont, dass wirtschaftliches Handeln immer in soziale und kulturelle Kontexte eingebettet ist und nicht nur auf rein rationaler Egozentrik beruht.
Welche Rolle spielte die Wall Street bei der Krisenentstehung?
Finanzinstitute entwickelten komplexe Modelle zur Risikoverteilung, die den tatsächlichen Wertschöpfungszwang verschleierten und systemische Risiken erhöhten.
- Quote paper
- Simon Meier (Author), 2011, Die Subprime-Krise 2007 und der neoliberale Wachstumszwang am Beispiel der USA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165688