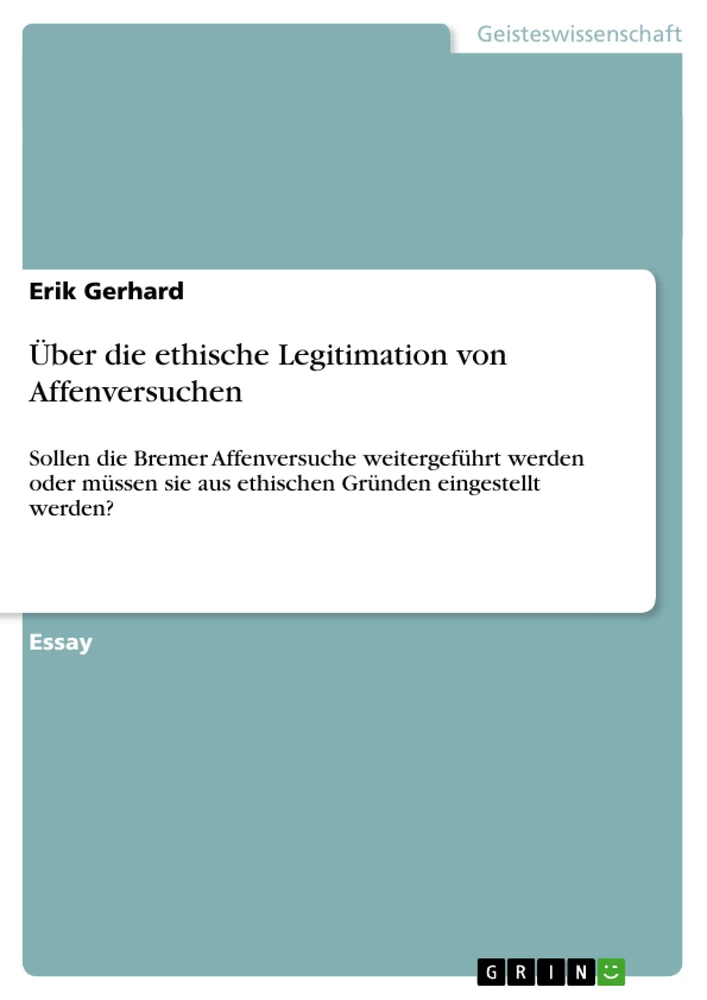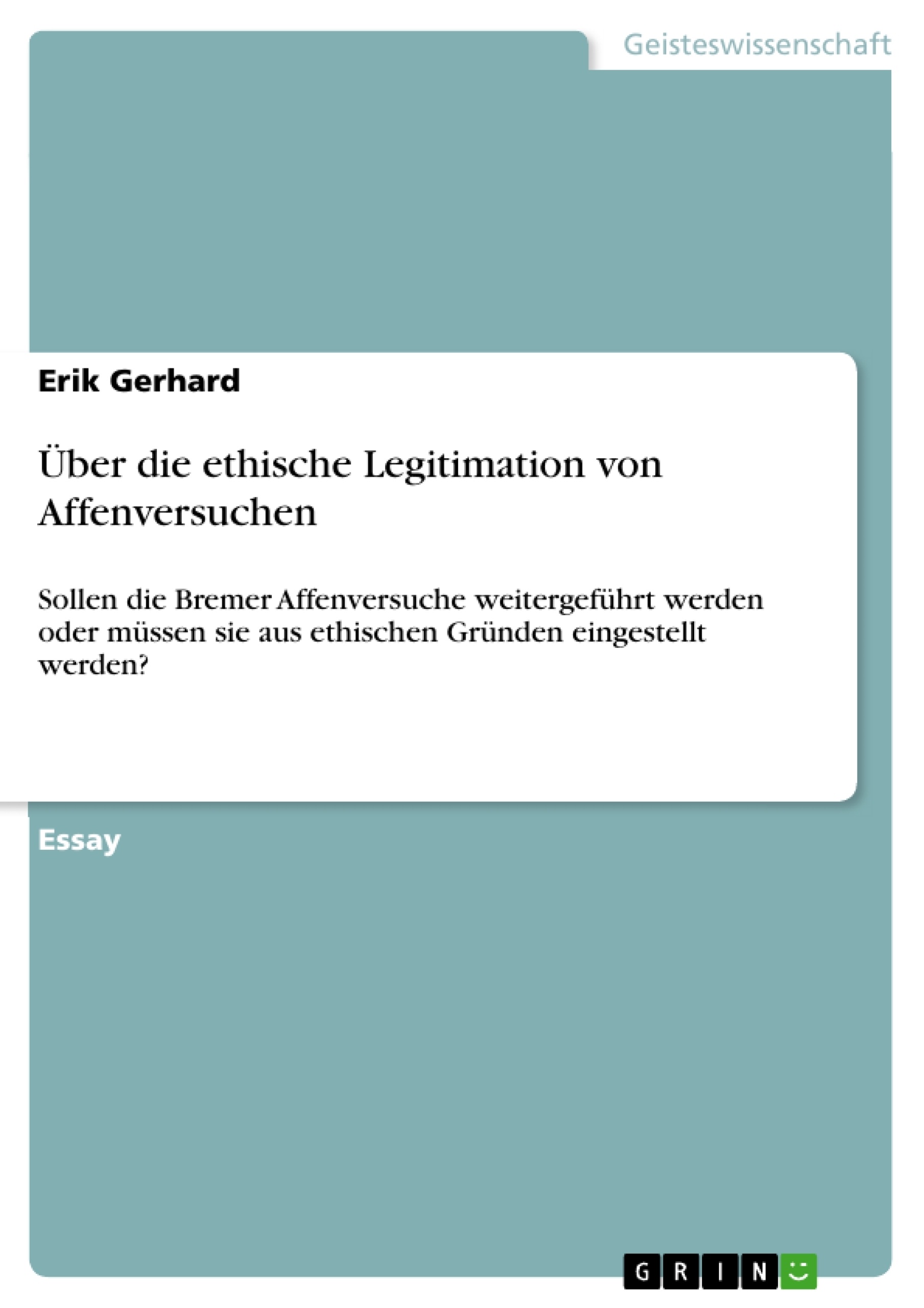Seit 1997 führt das Zentrum für Kognitionswissenschaften am Institut für Hirnforschung der
Universität Bremen, kurz ZKW, fortlaufend Tierversuche an gut zwei Dutzend Makaken
durch. Während der Versuchsphasen müssen die Tieraffen stundenlang in derselben Position
verharren[...]wobei auch ihr Kopf fixiert ist. Um die
Aktivität der Nervenzellen [..] messen zu können, ist das Gehirn der
Tiere mit feinen Elektroden verbunden, hierzu wurde den Affen unter Narkose eine winzige
Öffnung in die Schädeldecke gebohrt. Damit die Makaken während der Experimente
kooperieren, lässt man sie in der vorangehenden Nacht und am Morgen vor den Versuchen
dursten. Der im Nachhinein verabreichte Saft stellt für sie einen Anreiz dar und ist zugleich
Belohnung. Fünf bis 10 Jahre müssen die Primaten die Experimente über sich ergehen lassen,
anschließend werden sie eingeschläfert.1
Ziel der Hirnforschung an den Affen ist ein besseres Verständnis, wie Wahrnehmung,
Aufmerksamkeit und Gedächtnis funktionieren. Durch die Makakenversuche erhofft man
sich, wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, die dazu dienen könnten, menschliches
Leid zu verhindern oder zumindest zu verringern. So glaubt Andreas Kreiter, Neurobiologe
und leitender Forscher am ZKW, dass seine Tierversuche beispielsweise zu wichtigen
Erkenntnissen im Bezug auf die Behandlung von Epilepsiepatienten führen könnten.2
Tierschützer fordern seit langem das Ende seiner Versuche, da sie eine zu große Belastung für
die Tiere unterstellen, außerdem erschließt sich ihnen der Zweck der Experimente nicht in
aller Deutlichkeit. Die Forscher hingegen berufen sich auf die Freiheit der Wissenschaft, die
man nicht einfach ohne zwingenden Grund untergraben könne, die ja schließlich den
medizinischen Fortschritt gewährleiste.
Ich mache es mir im Folgenden zur Aufgabe, eine Stellungnahme für oder gegen die
Weiterführung der Bremer Makakenversuche auszuarbeiten. Um eine schlüssige Position
vertreten zu können, werde ich meiner Arbeit die ethischen Konzeptionen von Peter Singer
und Norbert Hoerster zugrunde legen, sie gegeneinander abwägen und mein Urteil auf ihrer
Basis fällen. Besonderes Gewicht soll dabei folgender Frage zukommen, anhand derer ich
beurteilen möchte, welcher der o.g. Philosophen, durch seine ethische Konzeption, die
überzeugenderen Antworten liefert:
Darf man Tierversuche dann durchführen, wenn der Vorteil, der dem Menschen durch sie
entsteht, größer ist, als das Leiden der Tiere, das durch die Experimente verursacht wird?
Inhaltsverzeichnis
- Ziel der Hirnforschung an den Affen
- Tierschützer fordern das Ende der Versuche
- Ethische Konzeptionen von Peter Singer und Norbert Hoerster
- Singers Prinzip der gleichen Interessenabwägung
- Singers Speziesismus
- Leidensfähigkeit von Affen und Menschen
- Moralische Verwerfung von Experimenten an Säuglingen und geistig schwer Behinderten
- Hoersters altruistische Einstellung zum Wohl des Tieres
- Hoersters Kritik am Utilitarismus und der gleichen Interessenberücksichtigung
- Diskriminierungsverbote gegenüber Andersrassigen und Frauen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die ethische Frage, ob die Bremer Makakenversuche weitergeführt werden sollten. Der Autor analysiert die Argumente von Peter Singer und Norbert Hoerster und versucht anhand ihrer ethischen Konzeptionen eine schlüssige Position zu vertreten. Dabei wird insbesondere die Frage diskutiert, ob Tierversuche moralisch vertretbar sind, wenn der Vorteil für den Menschen größer ist als das Leiden der Tiere.
- Tierethik und Speziesismus
- Leidensfähigkeit von Tieren
- Gleichbehandlung von Interessen
- Altruismus und Tierschutz
- Utilitaristische Ethik und deren Grenzen
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Autor stellt die Bremer Makakenversuche vor und beschreibt die Ziele der Hirnforschung an Affen. Er beleuchtet die Kritik von Tierschützern und die Verteidigung der Versuche durch die Forscher.
- Die Arbeit stellt Singers Prinzip der gleichen Interessenabwägung vor, welches Tiere und Menschen auf einer Ebene betrachtet, da beide Bedürfnisse und Interessen haben. Singer argumentiert, dass wir Tieren keinen geringeren Daseinswert zuordnen dürfen als Menschen.
- Singer wirft dem Menschen Speziesismus vor, da wir uns selbst gegenüber anderen Spezies privilegieren. Er argumentiert, dass das Leiden von Tieren nicht ignoriert werden darf, nur weil sie nicht die gleichen kognitiven Fähigkeiten wie Menschen besitzen.
- Der Autor untersucht, ob man aufgrund des Prinzips der gleichen Interessenabwägung Experimente an Säuglingen oder geistig schwer Behinderten zulassen würde. Er argumentiert, dass wir diese moralisch verwerfen würden, was wiederum die Zulässigkeit von Tierversuchen in Frage stellt.
- Hoerster argumentiert, dass Tierschutz auf einer altruistischen Haltung des Menschen beruhen sollte, die das Wohl des Tieres berücksichtigt. Er kritisiert Singers Prinzip der gleichen Interessenabwägung, da es seiner Meinung nach keine objektive Grundlage hat.
- Hoerster untersucht die Diskriminierung von Andersrassigen und Frauen und argumentiert, dass die gleiche Interessenberücksichtigung für alle Menschen gilt. Er sieht in der natürlichen Verbundenheit, der Kooperation und der Gleichbehandlung die Grundlage für moralische Prinzipien.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Tierethik, insbesondere dem Speziesismus, der Leidensfähigkeit von Tieren und der Frage der Gleichbehandlung von Interessen. Weitere wichtige Schlagwörter sind: Affenversuche, Hirnforschung, Utilitarismus, Altruismus, Diskriminierung, natürliche Verbundenheit, Kooperation.
Häufig gestellte Fragen
Warum werden an der Universität Bremen Affenversuche durchgeführt?
Die Hirnforschung an Makaken soll helfen, Funktionen wie Wahrnehmung und Gedächtnis besser zu verstehen und Krankheiten wie Epilepsie zu behandeln.
Was besagt Peter Singers Prinzip der gleichen Interessenabwägung?
Singer argumentiert, dass die Fähigkeit zu leiden das entscheidende Kriterium für moralische Berücksichtigung ist, unabhängig von der Spezies.
Was versteht man unter "Speziesismus"?
Die Bevorzugung der eigenen Spezies (Mensch) gegenüber anderen fühlenden Wesen, was Singer als moralisch falsch analog zum Rassismus betrachtet.
Welche Position vertritt Norbert Hoerster zu Tierversuchen?
Hoerster sieht Tierschutz als altruistische Pflicht des Menschen, lehnt aber Singers radikale Gleichstellung von Mensch und Tier ab.
Darf man Tieren Leid zufügen, um Menschen zu helfen?
Dies ist die zentrale ethische Frage der Arbeit, die utilitaristische Abwägungen gegen moralische Rechte von Tieren prüft.
- Arbeit zitieren
- Erik Gerhard (Autor:in), 2010, Über die ethische Legitimation von Affenversuchen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165727