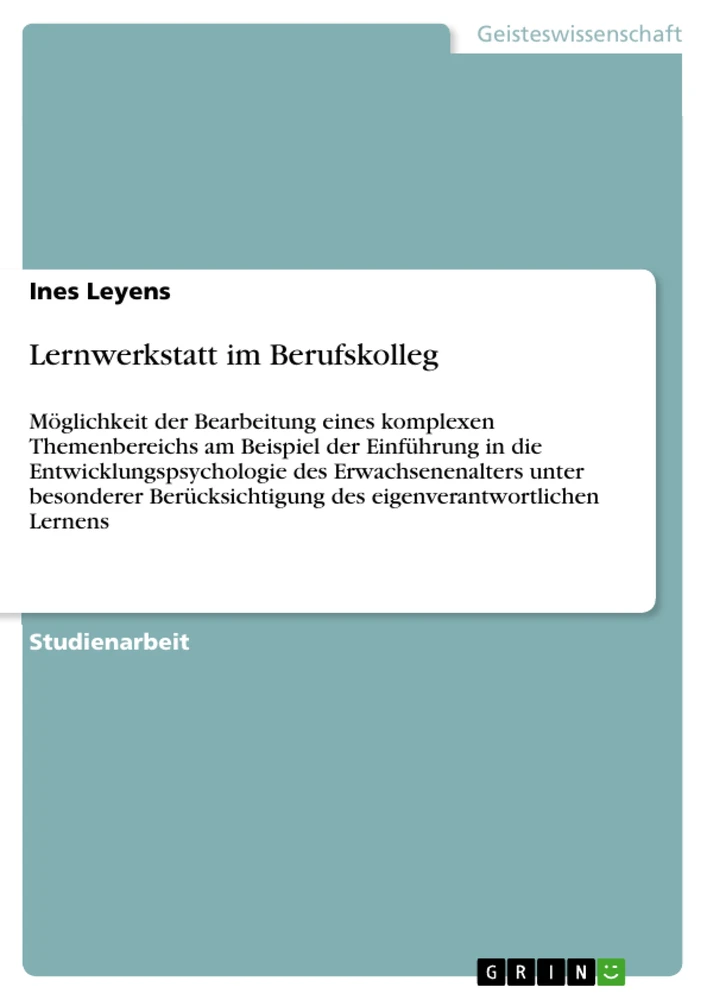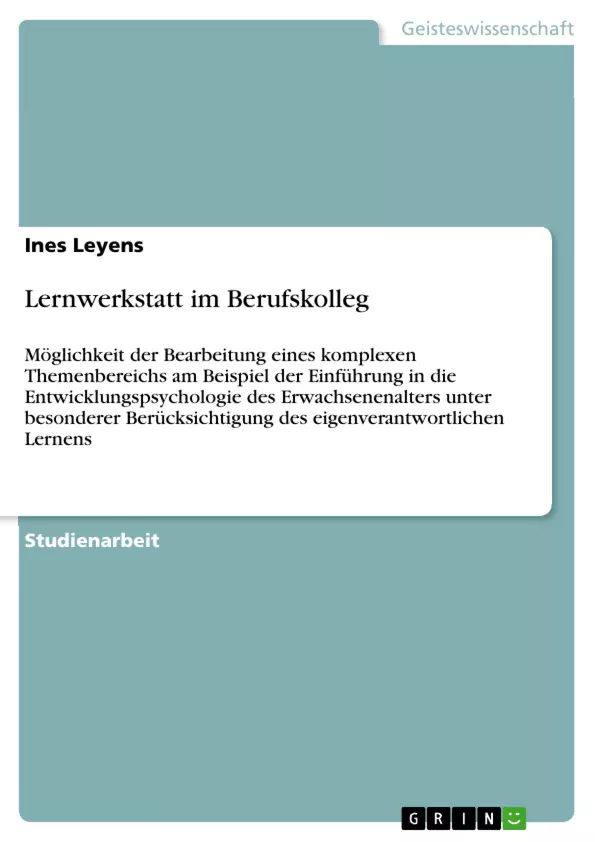Werkstattunterricht besteht in einem von der Lehrerin geplanten offenem Arrangement von Lernsituationen mit multisensorischen und handlungsorientierten Arbeitsmaterialien. Diese werden den Schülerinnen zur individuellen und selbstständigen Bearbeitung angeboten (vgl. www.ph.-heidelberg.de 2003). Die Gesamtthematik wird in Teilbereiche zerlegt und die Schülerinnen werden zum eigenverantwortlichen Lernen herausgefordert. Aufträge und Materialien sind kreativ und abwechslungsreich strukturiert und sollen möglichst viele Sinne ansprechen. Das Arbeitstempo und die Verweildauer an den Stationen bestimmen die Schülerinnen selbst. Nach B. Andreas et. al (Flensburger Methodenwerkstatt) ist diese Methode besonders geeignet, um komplexe Themen zu bearbeiten. Hier wird die Idee deutlich, dass solche Themenschwerpunkte (wie Entwicklungspsychologie) nach einer Methode verlangen, die den Kriterien
Handlungsorientierung,
selbstorganisiertes, selbstkontrolliertes Lernen,
Förderung der Teamfähigkeit und kooperativen Kompetenzen,
lerndifferenzierte Angebote (z.B. Akzeptanz des individuellen Lerntempos und Lerntypus),
Aufbau eines Netzwerkes zu den unterschiedlichsten Gebieten (erst ein Gesamtüberblick, dann Details hinzufügen)
versucht gerecht zu werden. Diese gesuchte Methode kann die Lernwerkstatt sein. Neben den oben genannten Kriterien ist die Hauptintention der Lernwerkstatt, dass ein Sachverhalt auf unterschiedlichen Ebenen angeboten wird und dadurch neue Denkmuster und Assoziationen (vgl. Bauer 1997) gefördert werden können. Die „Förderung der Gesamtpersönlichkeit durch kognitives, soziales und kreatives Lernen“ (www.papenschule-hameln@-t-online.de 2003) steht im Mittelpunkt. Dies geschieht unter anderem dadurch, dass die Aufmerksamkeit durch motivierende Aufgaben geweckt wird (Neugierde anregen) und der Wechsel der Sozialformen sowohl dem Menschen als Einzel- als auch als Sozialwesen, oder wie Weber es ausdrückt, dem Menschen als Individualist auf der einen Seite und dem Menschen mit seinem Wunsch des Aufbaus seiner Sozialkompetenz auf der anderen Seite gerecht wird. Es besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Unterrichtsphasen wie Verarbeitung, Vernetzung oder Sicherung in unterschiedliche Sozialformen einzubauen.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- Il Idee, Definition und Ziele der Lernwerkstatt für das Berufskolleg
- III Detailplanung des Konzepts
- 1 Analyse der Lerngruppe und Anbindung an die Richtlinien
- 2 Ziele der Unterrichtseinheit und der Lernwerkstatt
- 3 Verlaufsplanung der Lernwerkstatt
- 3.1 Auswahl der darzustellenden Stunden
- 3.1.1 Die Vorbereitungsstunde
- 3.1.2 Die Einführungsstunde
- 3.1.3 Die einzelnen Lernstationen
- 3.1.4 Fortführung der Themenarbeit
- 3.1.5 Die Abschlussstunden
- IV Kritische Reflexion wesentlicher Aspekte der Durchführung und Zielsetzung
- 1 Reflexion und Darstellung der hier erbrachten Lehrerinnenkompetenzen: Unterrichten, Innovieren, Evaluieren
- 2 Der grüne Punkt - Perspektiven zum häufigeren Einsatz der Lernwerkstatt im Schulalltag
- V Schlußbemerkungen
- Einsatz der Lernwerkstatt als innovative Unterrichtsmethode
- Förderung von selbstorganisiertem und eigenverantwortlichem Lernen
- Einbezug von verschiedenen Arbeitsformen und Sozialformen
- Analyse der Lehrerinnenkompetenzen in Bezug auf Unterricht, Innovation und Evaluation
- Potenziale und Herausforderungen des Lernwerkstatteinsatzes im Berufskolleg
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Planung und Umsetzung einer Lernwerkstatt zum Thema "Einführung in die Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters" im Berufskolleg. Ziel ist es, die Lernwerkstatt als alternative Unterrichtsform zu etablieren und ihre Vorteile im Vergleich zum traditionellen Frontalunterricht aufzuzeigen. Dabei werden die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen berücksichtigt und der Fokus auf selbstorganisiertes und erfahrungsorientiertes Lernen gelegt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Projekt "Lernwerkstatt" vor, das im Rahmen des Referendariats entstanden ist. Hier wird der Bedarf an alternativen Lernformen im Berufskolleg sowie die Motivation zur Einführung einer Lernwerkstatt im Fach Erziehungswissenschaften erläutert. Die Autorin geht auf die Herausforderung der heterogenen Lerngruppen im Berufskolleg ein und erklärt die Bedeutung des selbstorganisierten Lernens.
Im zweiten Kapitel werden die Idee, Definition und Ziele der Lernwerkstatt für das Berufskolleg vorgestellt. Die Autorin vergleicht verschiedene Begriffsdefinitionen und zeigt die historische Entwicklung des Stationenlernens auf. Sie hebt die Relevanz individueller Interessen und Bedürfnisse der Schülerinnen sowie die Bedeutung von unterschiedlichen Leistungs- und Lernniveaus im heutigen Berufskolleg hervor.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Detailplanung des Lernwerkstatt-Konzepts. Die Autorin analysiert die Lerngruppe, die Richtlinien und die Rahmenbedingungen des Unterrichts. Sie definiert die Ziele der Unterrichtseinheit und der Lernwerkstatt und stellt den Verlaufsplan mit den einzelnen Stunden dar.
Schlüsselwörter
Lernwerkstatt, selbstorganisiertes Lernen, Handlungsorientierung, Entwicklungspsychologie, Erwachsenenalter, Berufskolleg, Unterricht, Unterrichtsformen, Lehrerinnenkompetenzen, Evaluation, Heterogenität, individuelle Bedürfnisse, Lerntypen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept einer Lernwerkstatt im Berufskolleg?
Es handelt sich um ein offenes Arrangement von Lernsituationen, bei dem Schüler individuell, handlungsorientiert und selbstständig an verschiedenen Stationen arbeiten.
Welche Ziele verfolgt der Werkstattunterricht?
Zentral sind die Förderung der Teamfähigkeit, die Akzeptanz des individuellen Lerntempos sowie das kognitive, soziale und kreative Lernen.
Warum eignet sich diese Methode für das Thema Entwicklungspsychologie?
Komplexe Themen verlangen nach Methoden, die den Aufbau eines Netzwerkes zwischen verschiedenen Wissensgebieten ermöglichen und unterschiedliche Sinne ansprechen.
Welche Rolle übernimmt die Lehrkraft in der Lernwerkstatt?
Die Lehrkraft fungiert als Planerin des Rahmens und Begleiterin des Lernprozesses, wobei Kompetenzen im Unterrichten, Innovieren und Evaluieren gefragt sind.
Wie wird die Lernwerkstatt im Unterrichtsalltag evaluiert?
Die Arbeit reflektiert die Durchführung kritisch und prüft, inwieweit die gesetzten Ziele zur Förderung der Gesamtpersönlichkeit erreicht wurden.
- Citation du texte
- Oberstudienrätin Ines Leyens (Auteur), 2003, Lernwerkstatt im Berufskolleg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165821