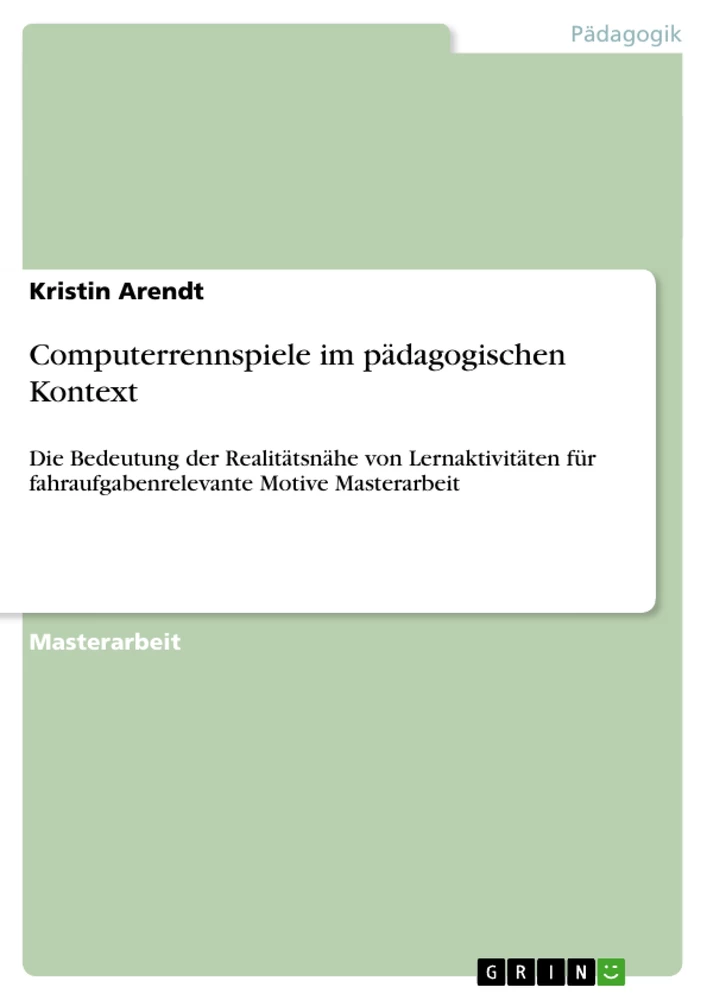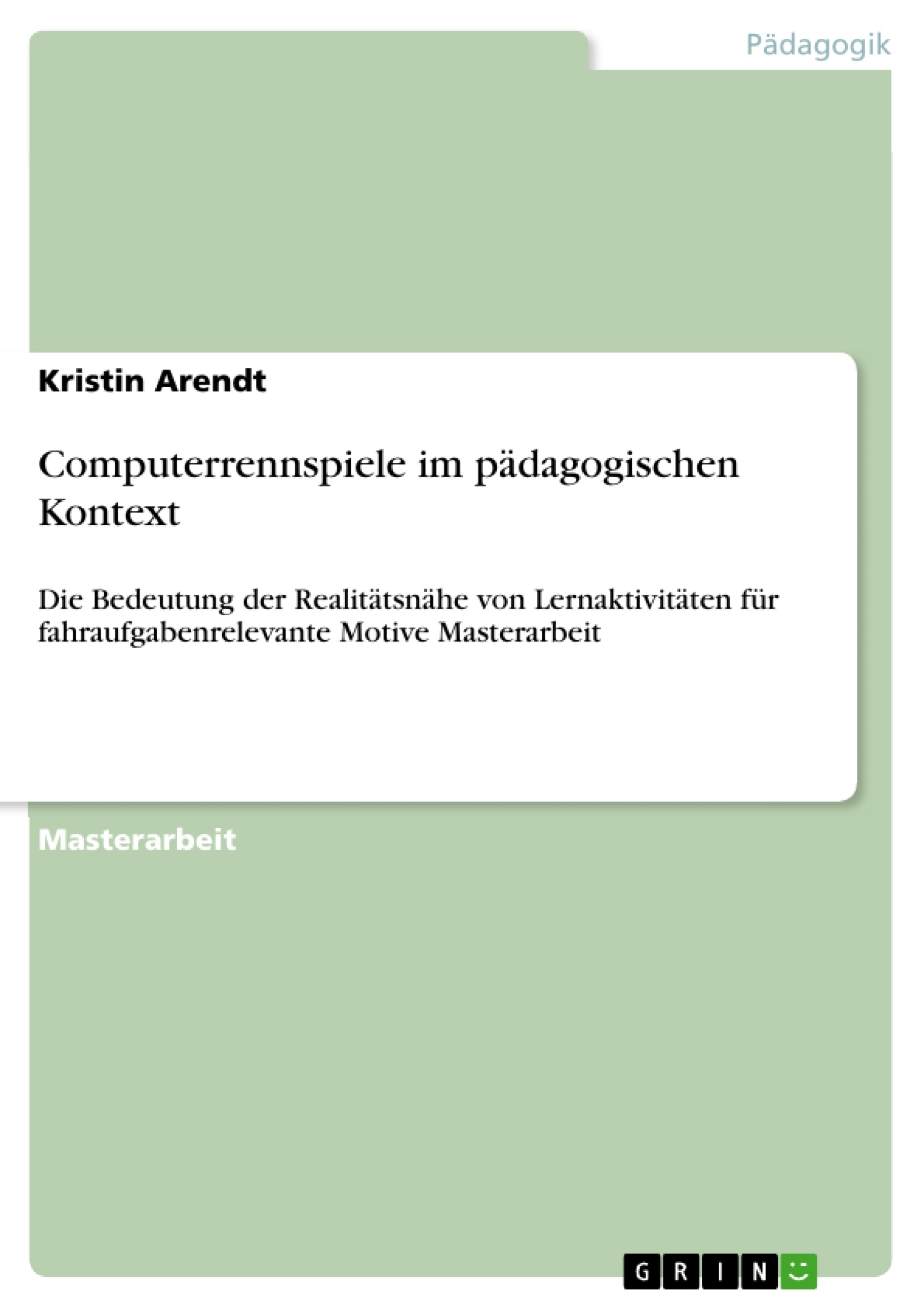Um der Frage nach dem Einfluss von Video- und Computerrennspielen auf das Fahrverhalten junger Fahrer nachzugehen, hat die Musikhochschule Hannover im Auftrag für die Bundesanstalt für Straßenwesen eine Studie durchgeführt (Klimmt & Vorderer, 2006).
Dabei wurden nach dem Konsum von Rennspielen wie „Need for Speed“ mit den Probanden Simulationsfahrten durchgeführt, um festzustellen, inwiefern kritische Verhaltensweisen gezeigt werden. Es wurde beobachtet, dass die Spieler Verhaltensweisen ausleben, die in der Realität verboten sind, aber nur Vielspieler unmittelbar nach dem Spielen geringfügig schneller fahren und einen etwas geringeren Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen einhalten.In der vorliegenden Arbeit wird der Zusammenhang zwischen der Qualität der Performanz einer praxisnahen Fahraufgabe im Rahmen eines Computerrennspiels und der
wahrgenommenen Selbstwirksamkeit für reale Fahr- und Verkehrssituationen untersucht. Zugrunde liegt dabei die Annnahme, dass der Grad der Realitätsnähe den Zusammenhang beeinflusst. Da die Fahraufgabe mit Hilfe eines Computerrennspiels realisiert wurde, wird zu Beginn die mit Beispielen unterlegte Realitätsnähe von Video- und Computerrennspielen beschrieben (Kap. 1.1). Anschließend zeigt die „Perceived-Reality“-Forschung auf, mit welchen Anforderung das „mehr“ an Realität verbunden ist (Kap. 1.2). Anschlussfragen zu
den möglichen Wirkungen fahrzeugbezogener Computerspiele werden im Kapitel 2 erläutert. Dabei wird das A-Priori-Modell von Klimmt und Vorderer (2006) visualisiert und zusammenfassend erläutert. Auf Grundlage einer kritischen Betrachtung und im Hinblick auf die empirischen Arbeit wird das Modell modifiziert. Das Kapitel 3 steht ganz im Zeichen der Selbstwirksamkeit von Bandura (1997). Ausgehend von der sozial-kognitiven Theorie Banduras (1997) wird der Begriff Selbstwirksamkeit zunächst definiert. Es folgt die Darstellung der Selbstwirksamkeit in Bezug auf ihre Entstehung, Erfassung und
verhaltensregulativen Funktionsweisen. Anschließend erfolgt die Darstellung der empirischen Studie (Kap. 4), in der der Frage nach dem Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Leistung und der Selbstwirksamkeitserwartung für reales Fahren unter dem Kriterium der Realitätsnähe nachgegangen wird. Im darauf folgenden Kapitel 5 werden die empirischen Befunde diskutiert. Das Kapitel 6 schließt das Thema meiner Arbeit ab, indem es die empirischen Untersuchung zusammenfasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung von Computerrennspielen
- Computerspiele auf dem Weg zur virtuellen Realität
- Realitätsnähe - mehr als ein Gestaltungsaspekt
- A-Priori-Modell zu den möglichen Wirkungen fahrzeugbezogener Computerspiele auf das Fahrverhalten
- Fähigkeiten und Fertigkeiten
- Sicherheitsrelevante Motive
- Lernprozesse
- Merkmale von Rennspielen
- Objektive und subjektive Realitätsnähe als intervenierende Variablen
- Exkurs: Physische und funktionale Genauigkeit
- Zusammenfassung und Kritik
- Selbstwirksamkeit - ein Merkmal unserer Persönlichkeit
- Ausgangspunkt: sozial-kognitive Theorie von Bandura
- Entstehung
- Abgrenzung und Erfassung
- Dimensionen der Selbstwirksamkeit
- Selbstwirksamkeit und (Leistungs-)Verhalten
- Selbstwirksamkeit und Geschlechterrollen
- Exkurs: Selbstwirksamkeitserleben beim Computerspielen
- Empirische Forschung und pädagogische Perspektiven
- Empirische Untersuchung
- Fragestellungen
- Methodisches Vorgehen
- Analyse ausgewählter Computerrennspiele
- Beschreibung der Stichprobe
- Operationalisierung der Konstrukte
- Untersuchungsdesign
- Treatment Check
- Durchführung
- Probleme bei der Durchführung
- Darstellung der Ergebnisse
- Stichprobenbeschreibung
- Treatment Check
- Auswertung der abhängigen Variablen
- Überprüfung der Hypothesen
- Kontrolle der abhängigen Variablen
- Einfluss moderierender Variablen
- Beantwortung der Fragestellungen
- Diskussion der Ergebnisse und Ausblick
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Auswirkungen von Computerrennspielen auf das Fahrverhalten und die Selbstwirksamkeitserwartungen von Spielern. Dabei werden die Lernprozesse, die durch den Einsatz von Computerrennspielen ermöglicht werden, analysiert und in den pädagogischen Kontext eingeordnet.
- Die Bedeutung von Realitätsnähe in Computerrennspielen für das Lernen fahrrelevanter Fähigkeiten und Fertigkeiten
- Die Rolle von Selbstwirksamkeit im Zusammenhang mit dem Spiel und dem realen Fahrverhalten
- Der Einfluss von Computerrennspielen auf das Sicherheitsbewusstsein und die Motivation für sicheres Fahrverhalten
- Die Eignung von Computerrennspielen als pädagogisches Werkzeug zur Förderung von Fahrkompetenz
- Die Entwicklung eines A-Priori-Modells zur Erklärung der Wirkungen von Computerrennspielen auf das Fahrverhalten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Masterarbeit ein und erläutert die Relevanz von Computerrennspielen im pädagogischen Kontext.
Das erste Kapitel befasst sich mit der Entwicklung von Computerrennspielen und der Rolle von Realitätsnähe in der Spielgestaltung.
Im zweiten Kapitel wird ein A-Priori-Modell vorgestellt, das die möglichen Wirkungen von fahrzeugbezogenen Computerspielen auf das Fahrverhalten beschreibt.
Das dritte Kapitel beleuchtet das Konzept der Selbstwirksamkeit und seine Relevanz für das Lernen und das Verhalten.
Das vierte Kapitel präsentiert die empirische Untersuchung der Masterarbeit. Hierbei werden Fragestellungen, Methode und Ergebnisse der Studie vorgestellt.
Schlüsselwörter
Computerrennspiele, Fahrverhalten, Realitätsnähe, Selbstwirksamkeit, Pädagogik, Lernprozesse, Simulation, Motivation, Sicherheitsbewusstsein, A-Priori-Modell, Empirische Untersuchung
- Quote paper
- Kristin Arendt (Author), 2008, Computerrennspiele im pädagogischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165827