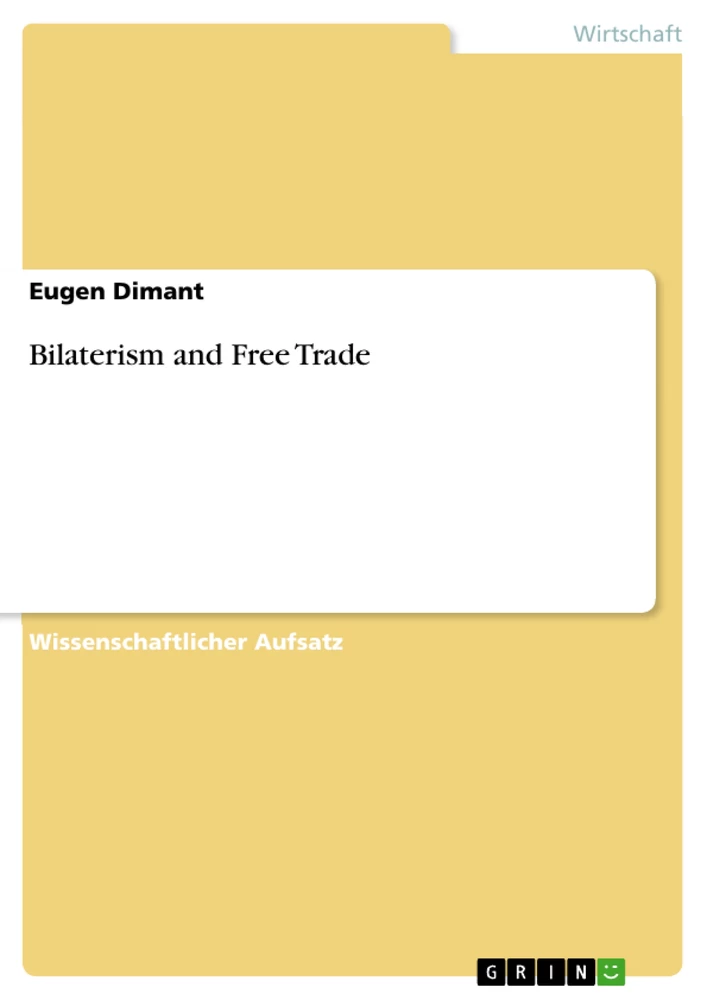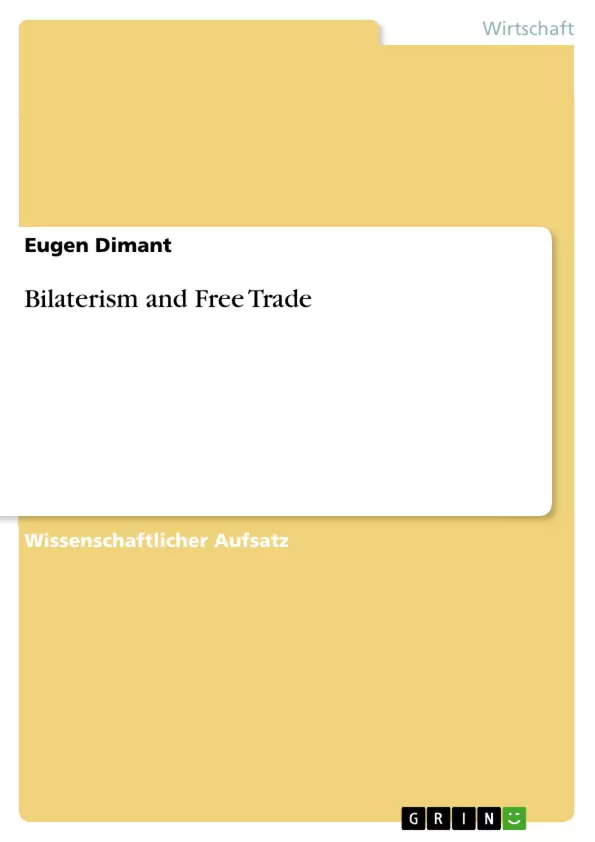Im Zuge der weltweiten Globalisierung von intra- und interindustriellem Handel rückt die Betrachtung der Entstehung und der Beschaffenheit von Handelsverträgen in den Vordergrund. Diese Handelsverträge – im folgenden „Free Trade Agreements“ (oder: FTA) genannt – bilden die Basis für die Entstehung von Handel. Zum heutigen Zeitpunkt beinhaltet die Weltgemeinschaft eine enorme Anzahl bilateraler und multilateraler Handelsverträge, die in ihrer Vielschichtigkeit und Komplexität zum Zwecke der Transparenz von der WTO verwaltet werden, was die besondere Relevanz dieses Themas hervorhebt [vgl. WTO 2010]. Die sich seit dem 18. Jahrhundert explosionsartig entwickelnde Globalisierung wurde vor allem durch den industriellen Fortschritt, neuartige technologische Entwicklungen, der Transportkostenreduktion und der kulturellen sowie sozialen Konvergenz im Zuge der Emigration und Immigration von qualifizierten Arbeitskräften („brain drain“) begünstigt.
Die Anreize zur Bildung von Handelsverträgen und die Folgen für sowohl inkludierte als auch exkludierte Länder werden in dieser Arbeit näher betrachtet. Hierbei soll mit Hilfe der Netzwerktechnik eine prägnante Analyse der nachhaltigen Entstehung von Netzwerken, bestehend aus bilateralen Handelsabkommen,
durchgeführt werden. Als Maßgrundlage dient das Modell von Goyal/Joshi (2006)
und deren Betrachtungen von Stabilität und Effizienz der möglichen Netzwerkausprägungen, besonders unter dem Gesichtspunkt der individuellen und kollektiven Wohlfahrtssteigerung.
Hierbei werden im Folgenden zunächst die theoretischen und mathematischen Implikationen des originären Modells herausgearbeitet, die prävalenten Effekte bei der Entstehung von Handelsabkommen in den Fokus gerückt und die Beschaffenheit der dabei hervorgehenden Gleichgewichte modelliert.
Diese Ausführungen bilden das Fundament für die Erweiterungen und Generalisierungen des Basismodells, auf welche summarisch eingegangen wird. Den Abschluss bildet eine kritische Schlussbetrachtung des vorgestellten Modells und dessen Eignung zur treffenden Abbildung realitätsnaher Handelsstrukturen.
Demnach sollen in erster Linie zwei Fragestellungen diskutiert werden: Was sind die Gründe für die Bildung von „Free Trade Agreements“ und wie sehen diese möglicherweise stabilen und effizienten Handelsvereinbarungen aus?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Motivation
- Analyse von „Bilaterism and Free Trade”
- Modelltheoretischer Aufbau im originären Modell.
- Prävalente Effekte und Entstehung von Free Trade Agreements
- Entstehung und Beschaffenheit von Gleichgewichten
- Erweiterte Modellannahmen..
- Schlussfolgerungen und Kritik.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entstehung und Beschaffenheit von Handelsabkommen, insbesondere „Free Trade Agreements“ (FTAs), im Kontext der Globalisierung. Dabei werden die Anreize zur Bildung von Handelsverträgen und die Folgen für teilnehmende und nicht teilnehmende Länder untersucht. Mithilfe der Netzwerktechnik wird eine prägnante Analyse der nachhaltigen Entstehung von Netzwerken aus bilateralen Handelsabkommen durchgeführt.
- Analyse der Entstehung von „Free Trade Agreements“
- Untersuchung der Auswirkungen von FTAs auf teilnehmende und nicht teilnehmende Länder
- Anwendung der Netzwerktechnik zur Modellierung der Entstehung von Handelsnetzwerken
- Bewertung der Stabilität und Effizienz von verschiedenen Netzwerkstrukturen
- Kritik und Diskussion der Eignung des Modells zur Abbildung realitätsnaher Handelsstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung und Motivation: Dieses Kapitel führt in das Thema „Bilaterism and Free Trade“ ein und erläutert die Relevanz von Handelsabkommen in der globalisierten Welt. Es wird der Forschungsstand sowie die Forschungslücke und die Forschungsfragen der Arbeit vorgestellt.
- Analyse von „Bilaterism and Free Trade”: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Modelltheoretischen Aufbau des Modells von Goyal/Joshi (2006). Es werden die Prävalenten Effekte bei der Entstehung von Handelsabkommen sowie die Entstehung und Beschaffenheit der dabei hervorgehenden Gleichgewichte beleuchtet. Des Weiteren werden erweiterte Modellannahmen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Globalisierung, Bilaterismus, Free Trade Agreements (FTAs), Netzwerktechnik, Wohlfahrtssteigerung, Stabilität, Effizienz, Handelsstrukturen, Modellanalyse, Goyal/Joshi-Modell, erweiterte Modellannahmen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptgründe für die Bildung von Freihandelsabkommen (FTAs)?
FTAs entstehen durch Anreize zur Wohlfahrtssteigerung, technologischen Fortschritt, Reduktion von Transportkosten und die zunehmende globale Vernetzung.
Wie werden Handelsnetzwerke mathematisch modelliert?
Die Arbeit nutzt die Netzwerktechnik und das Modell von Goyal/Joshi (2006), um die Stabilität und Effizienz bilateraler Abkommen zu analysieren.
Welche Auswirkungen haben FTAs auf nicht teilnehmende Länder?
Die Modellierung untersucht, ob exkludierte Länder durch Handelsumlenkung benachteiligt werden oder indirekt von stabilen Netzwerken profitieren.
Was bedeutet "Stabilität" in einem Handelsnetzwerk?
Ein Netzwerk gilt als stabil, wenn kein Land einen Anreiz hat, bestehende Verträge zu kündigen oder neue Verträge einseitig einzugehen.
Welche Rolle spielt die WTO bei bilateralen Verträgen?
Die WTO verwaltet die Vielzahl komplexer Abkommen weltweit, um Transparenz in der Weltgemeinschaft zu gewährleisten.
- Arbeit zitieren
- Eugen Dimant (Autor:in), 2010, Bilaterism and Free Trade, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165862