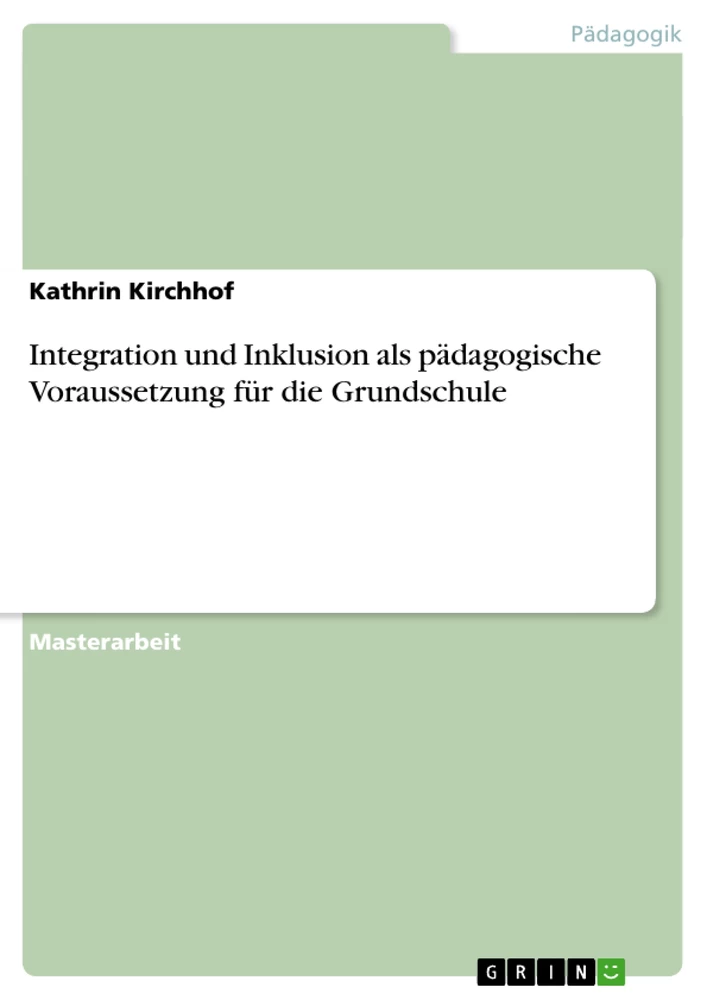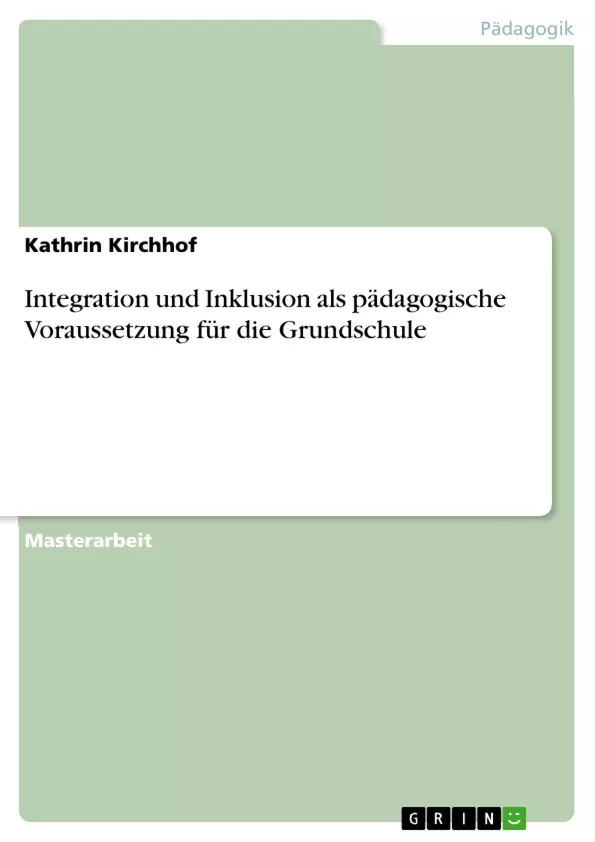Diese Arbeit widmet sich vorrangig der Frage, inwiefern "Integration und Inklusion als pädagogische Voraussetzung für die Grundschule" aufzufassen sind. Mit dieser Frage bewege ich mich im Feld der Auseinandersetzung um den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung. Um einen soliden Überblick über die historischen Grundlagen der pädagogischen Integrationsbewegung zu bekommen, werden zunächst die historischen Aspekte der Integration und Inklusion erörtert und in weiterer Folge einer politischen, einer gesellschaftlichen sowie einer pädagogischen Reflexion unterzogen.
Im weiteren Verlauf werden die Begriffe der Integration - Segregation und Exklusion - Inklusion herausgestellt und in dem von mir eigens erdachten Begriff "Inteklusion" zusammengeführt. Um einen Überblick über die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zur Absicherung der schulischen und gesellschaftlichen Integration zu bekommen, werden die gesetzlichen und gesellschaftlichen Voraussetzung für Integration bzw. Inklusion beinhaltet. Weiterhin zeige ich auf, welche besonderen Formen der Heterogenität in pädagogischen Arbeitsfeldern berücksichtigt werden sollten. Dies wird am Ende der Arbeit durch die Darstellung am Beispiel der Hamburger Integrationsklassen aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Aspekte der Integration und Inklusion
- Historische Aspekte der Integration und Inklusion aus politischer Sicht
- Historische Aspekte der Integration und Inklusion aus gesellschaftlicher Sicht
- Historische Aspekte der Integration und Inklusion aus pädagogischer Sicht
- Regelschulpädagogik
- Sonderschulpädagogik
- Systematische Aspekte der Integration und Inklusion
- Begriffsbestimmung Integration versus Separation
- Begriffsbestimmung Inklusion versus Exklusion
- Inteklusion als neuer Begriff
- Inteklusionskonzept
- Gesetzliche und gesellschaftliche Voraussetzung der Integration bzw. Inklusion
- Gesetzliche Voraussetzungen
- Grundgesetz (GG)
- Sozialgesetz (SGB)
- Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)
- Schulgesetz Berlin (SchulG)
- Entwurf eines Integrationsgesetzes
- Gesellschaftliche Voraussetzungen
- Barrierefreiheit aus pädagogischer Sicht
- Barrierefreiheit aus gesellschaftlicher Sicht
- Schlussfolgerungen
- Gesetzliche Voraussetzungen
- Integration und Inklusion von Kindern und Jugendlichen aus gesellschaftlicher Perspektive
- Integration von Kindern mit Migrationshintergrund
- Integration von Kindern mit Behinderungen
- Integration von Kindern aus sozialschwachen Familien
- Integration von Mädchen und Jungen
- Schlussfolgerungen
- Orientierungsrahmen zur pädagogischen Gestaltung des Lehrprozesses am Beispiel der Hamburger Integrationsklassen
- Entstehung der Integrationsklassen
- Integrative Schulstruktur
- Integrative Unterrichtsstruktur
- Elternarbeit
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Konzepte der Integration und Inklusion im Kontext der Grundschulbildung zu analysieren. Dabei werden die historischen, systematischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Aspekte beleuchtet.
- Die Entwicklung von Integration und Inklusion in der Geschichte
- Die Definition und Abgrenzung von Integration und Inklusion
- Die rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von Integration und Inklusion
- Die Herausforderungen und Chancen der Integration verschiedener Gruppen in der Grundschule
- Die praktische Umsetzung von Integrations- und Inklusionskonzepten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Integration und Inklusion in der Grundschule dar und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Historische Aspekte der Integration und Inklusion: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Verständnisses von Integration und Inklusion aus politischer, gesellschaftlicher und pädagogischer Sicht.
- Systematische Aspekte der Integration und Inklusion: Hier werden die Begriffe Integration und Inklusion definiert und abgegrenzt. Zudem wird das Inklusionskonzept vorgestellt.
- Gesetzliche und gesellschaftliche Voraussetzung der Integration bzw. Inklusion: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Integration und Inklusion von Kindern und Jugendlichen. Es werden sowohl das Grundgesetz, die Sozialgesetzgebung und das Behindertengleichstellungsgesetz als auch die Bedeutung von Barrierefreiheit betrachtet.
- Integration und Inklusion von Kindern und Jugendlichen aus gesellschaftlicher Perspektive: Dieses Kapitel befasst sich mit der Integration verschiedener Gruppen von Kindern und Jugendlichen in der Grundschule, darunter Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Behinderungen, Kinder aus sozialschwachen Familien und Mädchen und Jungen.
- Orientierungsrahmen zur pädagogischen Gestaltung des Lehrprozesses am Beispiel der Hamburger Integrationsklassen: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung und die Struktur von Integrationsklassen sowie die Gestaltung von Unterricht und Elternarbeit in diesem Kontext.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Integration, Inklusion, Grundschule, Pädagogik, Inklusionskonzept, Barrierefreiheit, Diversität, Inklusionsklassen, Hamburger Integrationsklassen, Bildungsgerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe.
- Quote paper
- Kathrin Kirchhof (Author), 2010, Integration und Inklusion als pädagogische Voraussetzung für die Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165931