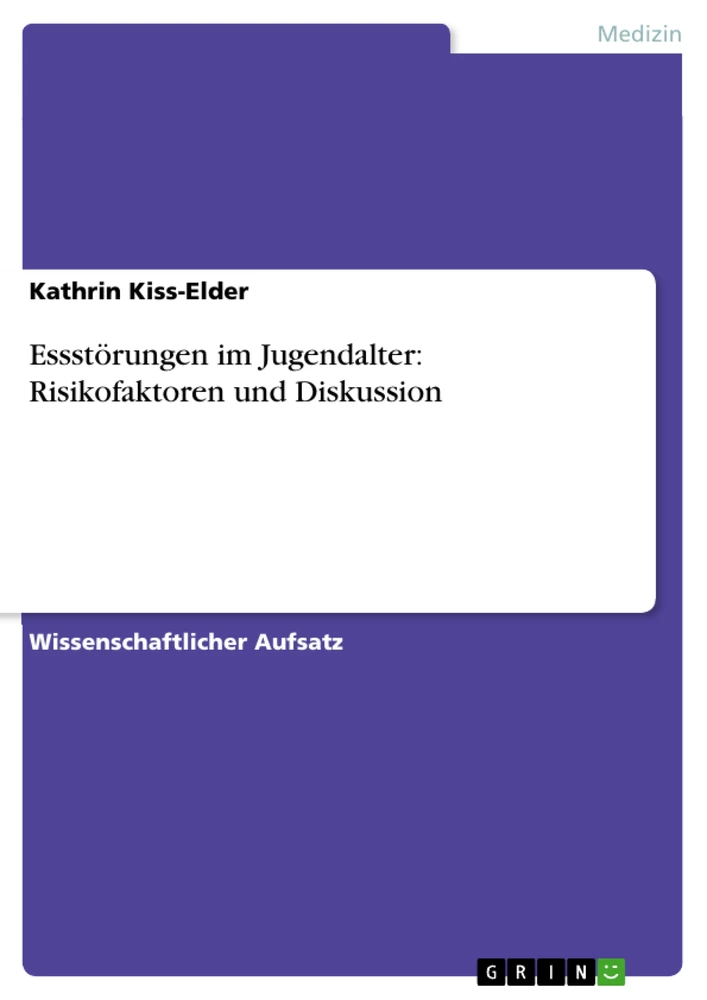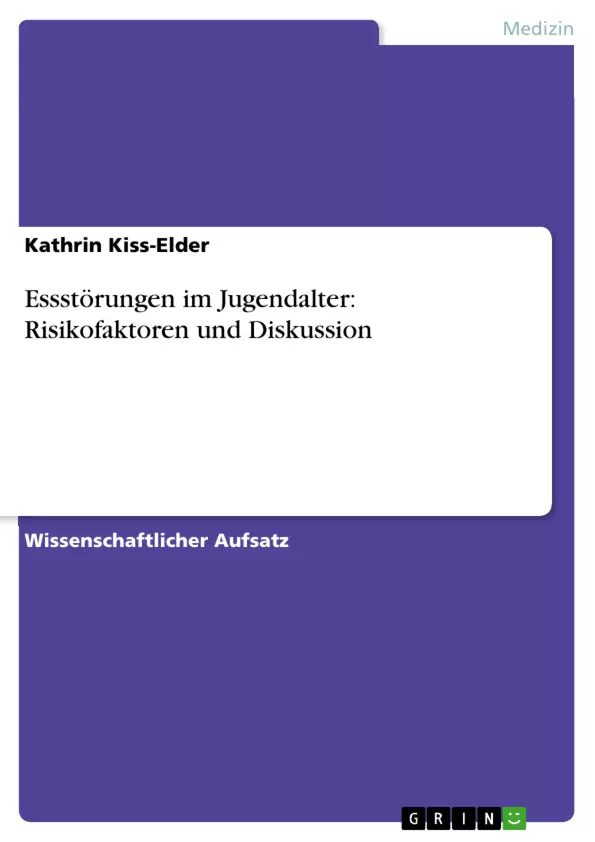Essstörungen sind inzwischen zum epidemischen Problem geworden. Der Anteil der Menschen, die von einer Essstörung betroffen sind, scheint kontinuierlich zu wachsen, und zwar sowohl quantitativ – wie viele von Essstörungen betroffen sind – als auch hinsichtlich der Positionierung im Leben – wie auch hinsichtlich der Chronifizierung der Störung.
Der Mediziner Zipfel zitiert in seiner Studie zu den biopsychosozialen Aspekten der Anorexia Nervosa folgende Ergebnisse einer Forsa-Studie: „Jede zweite Frau zwischen 20 und 60 möchte weniger wiegen. Jede zweite Frau hat bereits eine längerfristige Diät gemacht.
Für 47% der Frauen gibt es „verbotene Lebensmittel“. Jedes dritte Mädchen unter 10 und 60% der 15jährigen haben schon Diäterfahrung.“ (Zipfel, 2003: 3) Das epidemische Auftreten von Essstörungen verlangt damit ein Ausmaß gesellschaftlicher, professioneller wie sozial-individueller Fürsorge, um das Leiden der Betroffenen und Mitbetroffenen zu lindern bzw. überhaupt zu verhindern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jugendalter - Konstruktion einer Lebensphase
- Definition Jugendalter
- Historische Entwicklung der Jugend
- Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
- Familie
- Magersucht - eine Form der Essstörung
- Definition
- Physische Folgen
- Epidemiologie
- Erklärungsansätze für Essstörungen bzw. Magersucht
- Grundlegende Struktur
- Familiendynamische Ansätze
- Soziokulturelle und gesellschaftliche Ansätze
- Essstörungen und die Sucht nach Identität
- (Psychosoziale) Möglichkeiten der Sozialen Arbeit
- Prävention (möglichkeiten)
- Interventionsmöglichkeiten
- Stabilisationsmöglichkeiten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit Essstörungen im Jugendalter. Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung dieser Krankheit im Kontext der Jugendphase zu untersuchen. Dabei werden die verschiedenen Risikofaktoren, die zu Essstörungen führen können, beleuchtet, sowie die Bedeutung der Familie und der Gesellschaft für die Entstehung dieser Erkrankungen.
- Definition und Charakterisierung des Jugendalters
- Entwicklungspsychologische und soziokulturelle Faktoren im Jugendalter
- Ursachen und Risikofaktoren für Essstörungen
- Möglichkeiten der sozialen Arbeit im Umgang mit Essstörungen
- Die Bedeutung der Familie und der Gesellschaft für die Prävention und Behandlung von Essstörungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Essstörungen im Jugendalter vor und verdeutlicht die Relevanz des Themas in der heutigen Zeit. Die zweite Sektion beleuchtet die Lebensphase Jugend und deren Konstruktion durch biologische, intellektuelle und soziale Veränderungen. Die verschiedenen Entwicklungs- und Aufgabenbereiche dieser Lebensphase werden genauer betrachtet. Es wird hervorgehoben, dass die Familie, trotz Veränderungen in ihrer Struktur, für Jugendliche immer noch eine wichtige Rolle spielt.
Im dritten Kapitel wird Magersucht als eine Form der Essstörung definiert und deren physische Folgen sowie die epidemiologische Verbreitung beschrieben. Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Erklärungsansätze für Essstörungen, insbesondere die Magersucht. Es werden familiendynamische, soziokulturelle und gesellschaftliche Ansätze betrachtet sowie die Rolle der Identitätsfindung in der Entstehung von Essstörungen analysiert.
Das fünfte Kapitel widmet sich den (psychosozialen) Möglichkeiten der Sozialen Arbeit im Umgang mit Essstörungen. Hier werden Präventions-, Interventions- und Stabilisationsmöglichkeiten beleuchtet. Das Fazit fasst die wichtigsten Punkte der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Essstörungen, Jugendalter, Risikofaktoren, Familienstruktur, Soziokulturelle Einflüsse, Identität, Prävention, Intervention, Soziale Arbeit, Magersucht.
Häufig gestellte Fragen
Warum nehmen Essstörungen im Jugendalter zu?
Gründe sind komplexe biopsychosoziale Faktoren, gesellschaftliche Schönheitsideale, familiäre Dynamiken und die Herausforderungen der Identitätsfindung in der Pubertät.
Welche Rolle spielt die Familie bei Essstörungen?
Familiendynamische Ansätze zeigen, dass familiärer Druck oder dysfunktionale Strukturen zur Entstehung von Magersucht oder Bulimie beitragen können.
Was sind die physischen Folgen von Magersucht?
Dazu gehören extremes Untergewicht, Organschäden, Hormonstörungen und im fortgeschrittenen Stadium Lebensgefahr durch Herz-Kreislauf-Versagen.
Wie kann Soziale Arbeit bei Essstörungen helfen?
Soziale Arbeit bietet Unterstützung durch Präventionsprogramme, Krisenintervention und langfristige Stabilisierungsmaßnahmen für Betroffene und deren Angehörige.
Was versteht man unter der „Sucht nach Identität“?
Bei Jugendlichen kann die Kontrolle über das Essverhalten als Ersatz für die fehlende Kontrolle über die eigene Identitätsentwicklung und Lebensgestaltung dienen.
- Citar trabajo
- Dr. phil. Kathrin Kiss-Elder (Autor), 2008, Essstörungen im Jugendalter: Risikofaktoren und Diskussion, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165936