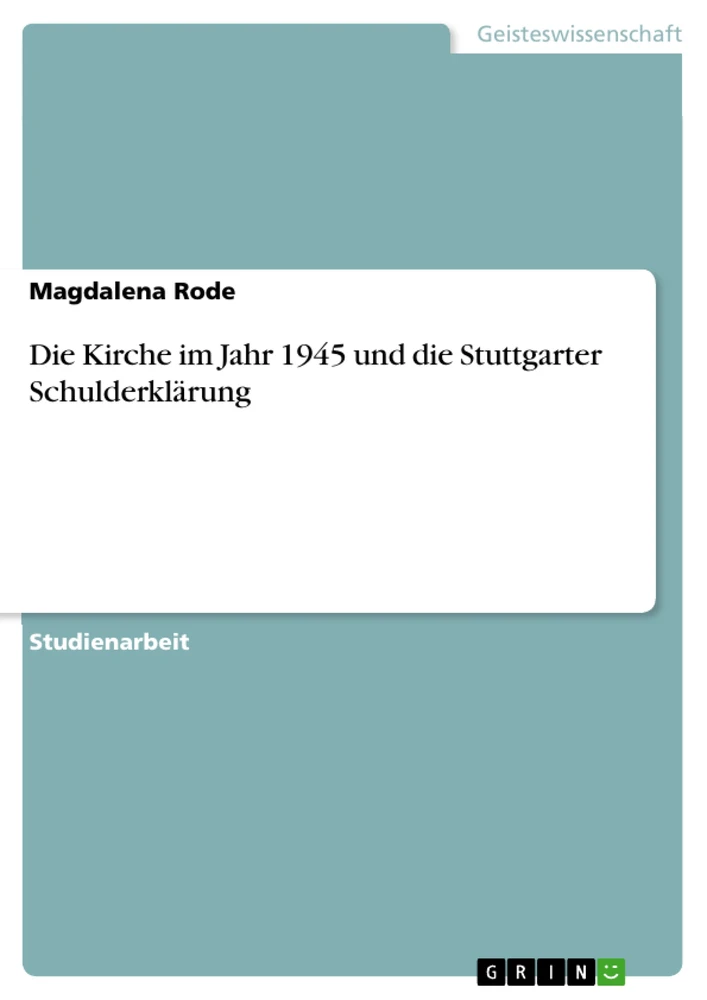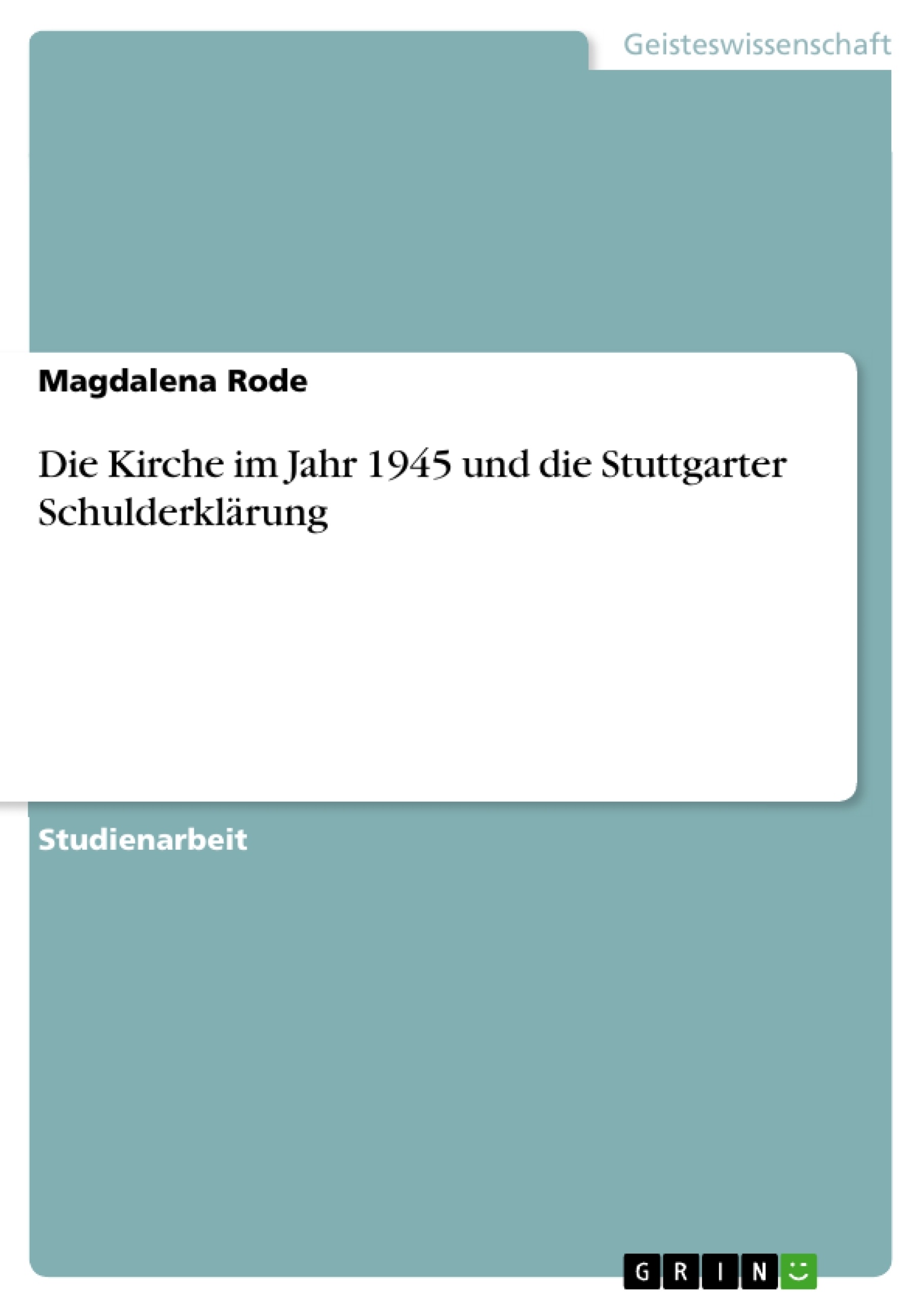In dieser Hausarbeit thematisiere ich das Jahr 1945 und die Stuttgarter Schulderklärung. Dabei beschränke ich mich auf den Zeitraum vom 8. Mai 1945 bis zur Stuttgarter Schulderklärung im Oktober 1945.
Um diese Hausarbeit zu schreiben habe ich mir folgende Leitfragen gestellt:
Was geschah mit Deutschland am 8. Mai 1945? Welche Stimmungslage herrschte im Jahr 1945 nach Kriegsende?
War es dem deutschen Volk überhaupt möglich, in dieser schwierigen Zeit – geprägt von Existenzängsten, Trauer und großem Leid – sich über die eigene Schuld bewusst zu wer-den und diese einzugestehen?
Wie ging die Kirche mit dieser Situation um und wie reagierte sie auf die Schuldfrage? Bezog die Kirche für ihr ‚Versagen‘ während des NS-Regimes Stellung?
Was führte letztendlich zu der Schulderklärung von Stuttgart und wie waren die Reaktionen auf dieses Schuldbekenntnis – auch in Bezug auf die Siegermächte und das Ausland, unter dessen Beobachtung Deutschland stand?
Woran orientierte sich die Stuttgarter Schulderklärung und welches Ziel verfolgte sie?
Fürchtete die Kirche eine Rechtfertigung für ihr Nichteinschreiten oder das zu zaghafte Einschreiten während des Nationalsozialismus und war dies der Grund für ein Schuldbekenntnis – die Hoffnung, durch diese Schulderklärung nicht zu scharf verurteilt zu werden?
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Das Jahr 1945
- Probleme und Situation
- Vergangenheitsbewältigung in der unmittelbaren Nachkriegszeit
- Wegbereiter der Stuttgarter Schulderklärung
- Dietrich Bonhoeffer
- Nach dem Krieg - die Kirchenversammlung in Treysa
- Die Stuttgarter Schulderklärung von 1945
- Probleme der Stuttgarter Schulderklärung – Stimmen zur Stuttgarter Schulderklärung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Jahr 1945 und der Stuttgarter Schulderklärung. Sie analysiert die unmittelbare Nachkriegszeit und untersucht, wie die deutsche Kirche mit der Schuldfrage umging. Im Fokus stehen die Reaktionen auf die Kriegsniederlage, die Rolle der Kirche im Nationalsozialismus und die Entstehung der Stuttgarter Schulderklärung.
- Die Situation in Deutschland nach der Kapitulation am 8. Mai 1945
- Die Rolle der Kirche im Nationalsozialismus
- Die Entstehung der Stuttgarter Schulderklärung
- Die Bedeutung der Stuttgarter Schulderklärung für die Vergangenheitsbewältigung
- Die Reaktionen auf die Stuttgarter Schulderklärung
Zusammenfassung der Kapitel
Das Jahr 1945: Dieses Kapitel beschreibt die schwierige Situation in Deutschland nach der bedingungslosen Kapitulation. Die Zerstörung des Landes, die Hungersnot, die Flüchtlingsströme und die politische Instabilität prägten die Zeit. Die deutsche Bevölkerung litt unter Existenzängsten, Trauer und großem Leid.
Wegbereiter der Stuttgarter Schulderklärung: Das Kapitel beleuchtet die Rolle von Dietrich Bonhoeffer, einem bedeutenden Theologen, der sich gegen den Nationalsozialismus stellte. Weiterhin wird die Kirchenversammlung in Treysa thematisiert, die eine wichtige Vorstufe zur Stuttgarter Schulderklärung darstellte.
Die Stuttgarter Schulderklärung von 1945: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung der Stuttgarter Schulderklärung. Es geht auf die Motive und Ziele der Erklärung ein und beleuchtet die verschiedenen Reaktionen auf das Schuldbekenntnis.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen der Hausarbeit sind: Stuttgarter Schulderklärung, Vergangenheitsbewältigung, Schuldfrage, Kirche, Nationalsozialismus, Deutschland, Nachkriegszeit, 1945.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Stuttgarter Schulderklärung?
Es handelt sich um ein Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche aus dem Oktober 1945, in dem sie ihr Versagen gegenüber dem Nationalsozialismus eingestand.
Welche Stimmung herrschte 1945 in Deutschland?
Die Zeit unmittelbar nach dem Kriegsende war geprägt von Existenzängsten, Hunger, Trauer über die Zerstörung und politischer Instabilität.
Welchen Einfluss hatte Dietrich Bonhoeffer auf die Erklärung?
Bonhoeffer gilt als wichtiger theologischer Wegbereiter, da er bereits früh zum Widerstand gegen das NS-Regime aufrief und die moralische Verantwortung der Kirche betonte.
Wie reagierte das Ausland auf das Schuldbekenntnis?
Die Erklärung stand unter starker Beobachtung der Siegermächte und diente auch dazu, die internationale Isolation der deutschen Kirche zu beenden.
Was war die Kirchenversammlung in Treysa?
Die Versammlung in Treysa war eine entscheidende Vorstufe nach dem Krieg, um die Neuordnung der evangelischen Kirche und die Schuldfrage zu diskutieren.
- Quote paper
- Magdalena Rode (Author), 2009, Die Kirche im Jahr 1945 und die Stuttgarter Schulderklärung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165945