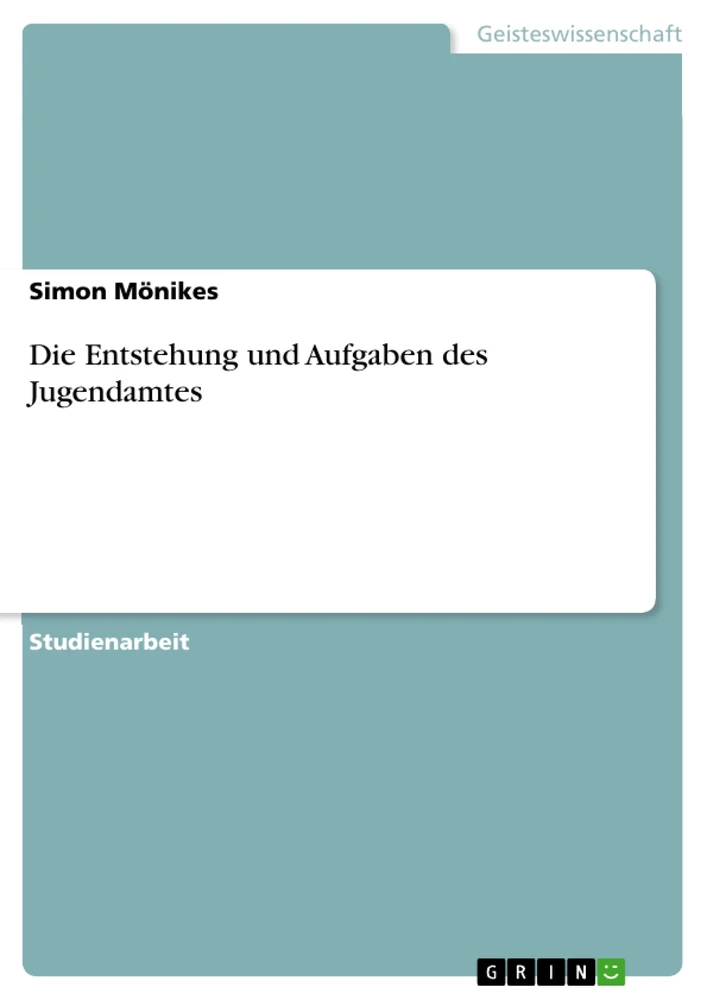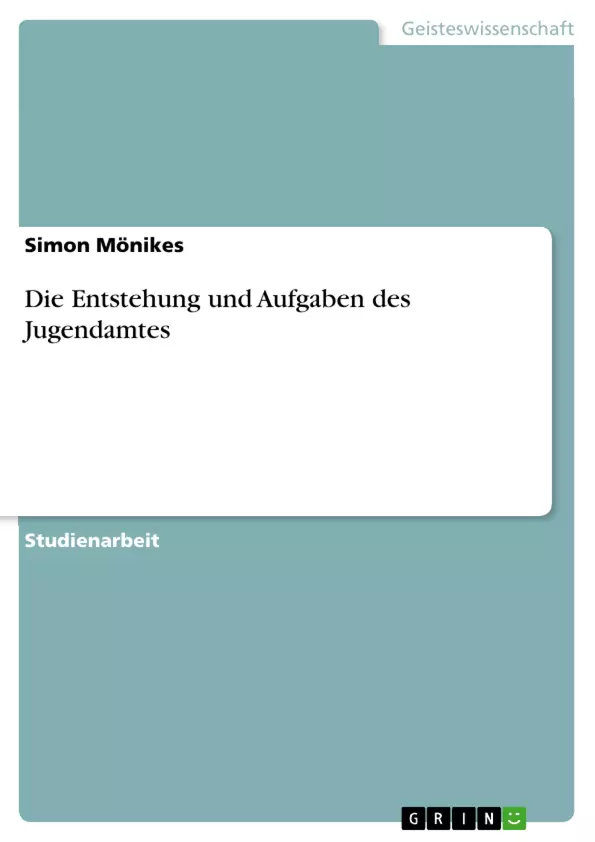Ich werde mich in meiner Hausarbeit mit dem Thema „Das Jugendamt – seine Entstehung und Aufgaben“ beschäftigen. Mein Themenschwerpunkt liegt hierbei zum einen auf der Geschichte des Jugendamtes, sowie auf die Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe.
2. Die Entstehung des Jugendamtes
Als erstes möchte ich auf den Vorgänger des heutigen Jugendamtes, also die frühere Fürsorgeerziehung eingehen. Des Weiteren auf die Entstehung des Jugendamtes und deren Entwicklung im Lauf der Jahrzehnte.
2.1 Der Vorläufer des Jugendamtes – die Fürsorgeerziehung
Der Beginn der Jugendfürsorge war der Anfang des 19. Jahrhunderts (ca.1839). Ihre Wurzeln lagen in der Kinder- und Armenfürsorge. Der damalige Rechtsstaat lehnte Eingriffe in die Erziehung von Armenkindern ab, doch griff er in vereinzelten Fällen ein, wenn das Wohl des Kindes stark gefährdet war. Die gesamte Familie erhielt ein Mindestmaß an Unterstützung. Wenn sie Waisen waren wurden sie in Pflegefamilien oder Armenhäusern untergebracht wo ihre sozialen und wirtschaftlichen Belange versorgt und gesichert wurden. Um die Kinder auch in den weiteren erzieherischen Belangen zu versorgen wurde die Volksschule gegründet, diese stand den Belangen
der Eltern und der der Industrie, die die Kinder als billige Arbeitskraft sah, im Weg.
Der Fürsorge ging ein wichtiges Teilgebiet verloren, da die Armenkinder keinen
Zugang zu den Volksschulen hatten – so entstanden die freien (privaten)
Erziehungsfürsorgen, die vom Staat unterstützt wurden. In Preußen bildeten sich
verschiedenste Rettungshilfevereine die sich zur Aufgabe gemacht hatten
misshandelte Kinder in Rettungshäuser zu bringen und Erziehungsanstalten zu
schließen in denen Kinder misshandelt wurden. Sie setzten sich auch mit der
Jugendkriminalität und der Verwahrlosung auseinander. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Entstehung des Jugendamtes
- 2.1 Der Vorläufer des Jugendamtes - die Fürsorgeerziehung
- 2.2 Das Jugendamt
- 2.2.1 Erziehung statt Strafe
- 2.2.2 Fürsorgeerziehung und ihre Kritik
- 2.2.3 Das Recht auf Erziehung
- 2.4 1924-1928
- 2.5 Der Wendepunkt für die Jugendhilfe 1927
- 2.6 Die nationalsozialistische Wohlfahrtspolitik
- 2.6.1 Die nationalsozialistische Jugendhilfe
- 2.6.2 Die Organisationsformen des Jugendamtes
- 2.6.3 War das Jugendamt nationalsozialistisch ?
- 2.7 Das Jugendamt in der BRD
- 2.8 Das Jugendamt neuer Prägung
- 2.9 Die 70er Jahre
- 3. Was ist die Kinder- und Jugendhilfe
- 4. Welche Aufgaben hat die KJH noch?
- 4.1 Die Aufgabenerfüllung des Jugendamtes kostet Geld!
- 4.2 Personal der Jugendhilfe
- 5. Die allgemeinen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe
- 5.2 Kinder- und Jugendschutz
- 5.3 Förderung der Erziehung in der Familie
- 5.3.1 Familienbildungsstätte
- 5.3.2 Elterliche Sorge und Beistand
- 5.4 Wenn Eltern „ausfallen“
- 5.5 Beratung für die Familie
- 5.6 Hilfen in Belastungs- und Krisensituationen
- 5.7 Zusammenfassung der Kinder- und Jugendhilfe
- 6. Die Akteure der Jugendhilfe
- 7. Unterteilung der Jugendhilfe
- 8. Fazit
- 9. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Entstehung und den Aufgaben des Jugendamtes. Der Fokus liegt dabei auf der historischen Entwicklung des Jugendamtes, sowie auf dessen Rolle in der Kinder- und Jugendhilfe.
- Die Entstehung des Jugendamtes im Kontext der Fürsorgeerziehung
- Die Entwicklung des Jugendamtes im 20. Jahrhundert
- Die Aufgaben des Jugendamtes in der Kinder- und Jugendhilfe
- Die rechtlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe
- Die Finanzierung und Organisation der Jugendhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Zielsetzung sowie die Themenschwerpunkte. Kapitel 2 befasst sich mit der Entstehung des Jugendamtes, indem es zunächst den Vorläufer, die Fürsorgeerziehung, beleuchtet. Anschließend wird die Entwicklung des Jugendamtes im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts beschrieben.
Kapitel 3 definiert den Begriff der Kinder- und Jugendhilfe und beschreibt deren Aufgaben. Kapitel 4 geht näher auf die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe und deren Finanzierung ein.
Kapitel 5 beleuchtet die allgemeinen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, einschließlich des Kinder- und Jugendschutzes, der Förderung der Erziehung in der Familie, der Unterstützung von Familien in schwierigen Situationen sowie der Beratung und Hilfe in Belastungs- und Krisensituationen.
Schlüsselwörter
Jugendamt, Fürsorgeerziehung, Kinder- und Jugendhilfe, Aufgaben, Entwicklung, Recht, Finanzierung, Organisation, Familienhilfe, Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz, Beratung.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Vorläufer des Jugendamtes?
Die Wurzeln liegen in der Kinder- und Armenfürsorge sowie der sogenannten Fürsorgeerziehung des 19. Jahrhunderts.
Wann entstand das Jugendamt in seiner heutigen Form?
Ein wichtiger Wendepunkt war das Jahr 1927, das als Meilenstein für die moderne Jugendhilfe gilt.
Was sind die Hauptaufgaben des Jugendamtes?
Zu den Aufgaben gehören der Kinder- und Jugendschutz, die Förderung der Erziehung in der Familie sowie Hilfen in Krisensituationen.
Wie veränderte sich die Jugendhilfe im Nationalsozialismus?
Die Jugendhilfe wurde ideologisch instrumentalisiert und in die nationalsozialistische Wohlfahrtspolitik eingegliedert.
Wer finanziert die Aufgaben des Jugendamtes?
Die Erfüllung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe wird durch öffentliche Mittel finanziert, wobei die Kostenstruktur ein wesentlicher Aspekt der Verwaltung ist.
- Arbeit zitieren
- Simon Mönikes (Autor:in), 2011, Die Entstehung und Aufgaben des Jugendamtes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165979