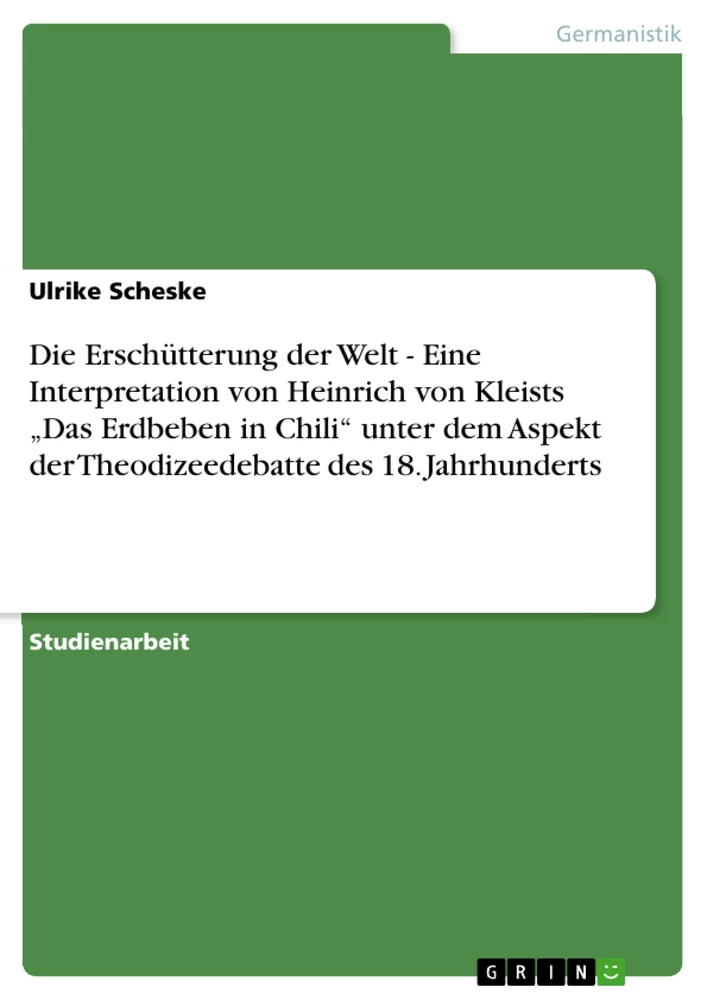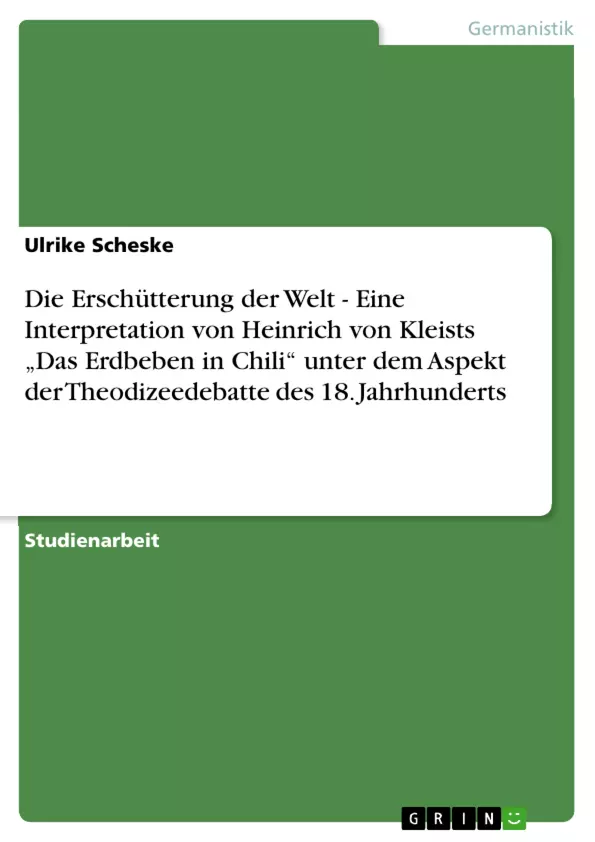Das Erdbeben von Lissabon im Jahr 1755 gab den Anstoß zu einer philosophischen, theologischen und literarischen Auseinandersetzung. Die Theodizeetheorie des Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz und die ihr vorangegangenen rationalistischen Weltentwürfe waren nicht mehr haltbar, weil sie ein Übel wie die Naturkatastrophe von Lissabon nicht ausreichend erklären konnten. Leibniz versuchte in seinem 1710 veröffentlichten Essay "Die Theodizee von der Güte Gottes, der Freiheit des Menschen und dem Ursprung des Übels" nachzuweisen, dass die Existenz des Bösen in der Welt nicht der Güte Gottes widerspreche und dass die existierende Welt die beste aller möglichen Welten sei. Philosophen wie Voltaire, Rousseau und Kant, als auch Theologen beschäftigten sich nun mit dem Problem, wie ein allmächtiger und gütiger Gott eine Katastrophe mit solch verheerenden Folgen zulassen kann.
Auch Kleist thematisierte in der 1806 verfassten Novelle "Das Erdbeben in Chili" das grundlegende Paradoxon zwischen dem Schöpfergott, der nur Gutes geschaffen hat, und dem existierenden Übel. Welche Position nimmt Kleist gegenüber dem Übel in der Welt ein? Wie steht er zu dem philosophischen Modell der "besten aller Welten" von Leibniz, das zu seiner Zeit das weitverbreitetste war?
Heinrich von Kleist war wie viele seiner Zeitgenossen von der Erschütterung des Weltbildes durch die Französische Revolution und die Kritiken Kants betroffen. In seinen Erzählungen begegnet der Leser immer wieder dem Ausdruck „gebrechliche Einrichtung der Welt“. Die Beschäftigung mit Kants Philosophie bewog ihn zu denken, dass der Mensch niemals vollständige Erkenntnis über die Welt erlangen könne und somit einer nicht berechenbaren Welt ausgeliefert sei.
In der vorliegenden Arbeit wird herausgestellt, dass sich in der Novelle, neben Deutungsmustern der Theodizeediskussion, Kleists eigenes Konzept von der Unerkennbarkeit einer objektiven Weltordnung durch die menschliche Erkenntnis widerspiegelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theodizeedebatte des 18. Jahrhunderts
- Der Theodizeebegriff von Gottfried Wilhelm Leibniz und Christian Wolff
- Die Theodizeediskussion nach dem Erdbeben von Lissabon
- Kleists eigenes Weltbild
- Die Novelle „Das Erdbeben von Chili“ unter dem Blickwinkel der Theodizeedebatte
- Das unaufgeklärte Gesellschaftssystem vor dem Erdbeben
- Die Funktion des Zufalls
- Jeronimo, Josephe und die Vorstellungen des metaphysischen Optimismus
- Grenzen der Utopie
- Die theologische Auslegung des Erdbebens durch die Strafpredigt
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, Heinrich von Kleists Novelle „Das Erdbeben in Chili“ im Kontext der Theodizeedebatte des 18. Jahrhunderts zu analysieren. Sie beleuchtet die Auseinandersetzung mit dem Problem des Leids und der Existenz des Bösen in der Welt, die durch das Erdbeben von Lissabon im Jahr 1755 angestoßen wurde.
- Die Theodizeedebatte und ihre verschiedenen Positionen
- Kleists Kritik am metaphysischen Optimismus
- Das Konzept der Unerkennbarkeit einer objektiven Weltordnung
- Die Rolle des Zufalls und des Erdbebens als Katalysator für gesellschaftliche und individuelle Entwicklung
- Die Grenzen der menschlichen Erkenntnis und die Frage nach dem Sinn des Leidens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Theodizeedebatte und das Erdbeben von Lissabon als Ausgangspunkt für die philosophische und theologische Auseinandersetzung mit dem Übel in der Welt ein. Sie stellt zudem die Bedeutung von Kleists Novelle „Das Erdbeben in Chili“ in diesem Kontext dar.
Kapitel 1 behandelt die Theodizeedebatte des 18. Jahrhunderts, beginnend mit Leibniz’ Vorstellung von der „besten aller Welten“ und seiner Unterscheidung verschiedener Arten des Übels. Die Verbreitung dieser Theorie durch Christian Wolff und die Kritik an ihr durch Philosophen wie Voltaire werden in diesem Kapitel ebenfalls beleuchtet.
Kapitel 2 analysiert die Novelle „Das Erdbeben in Chili“ unter dem Blickwinkel der Theodizeedebatte. Es untersucht das unaufgeklärte Gesellschaftssystem vor dem Erdbeben, die Rolle des Zufalls und die Vorstellungen des metaphysischen Optimismus, die durch die Figuren Jeronimo und Josephe verkörpert werden. Zudem wird die theologische Auslegung des Erdbebens durch die Strafpredigt betrachtet.
Schlüsselwörter
Theodizee, Erdbeben von Lissabon, Gottfried Wilhelm Leibniz, Christian Wolff, Voltaire, metaphysischer Optimismus, Unerkennbarkeit, Zufall, Leid, Sinn, „Das Erdbeben in Chili“, Heinrich von Kleist.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängt Kleists Novelle mit dem Erdbeben von Lissabon zusammen?
Das historische Erdbeben von 1755 löste eine europaweite Debatte über die Güte Gottes (Theodizee) aus, die Kleist in seiner fiktiven Erzählung über Chile verarbeitet.
Was kritisiert Kleist an der Theorie von Leibniz?
Kleist stellt den "metaphysischen Optimismus" von der "besten aller Welten" infrage, indem er die Grausamkeit der Natur und der Gesellschaft zeigt.
Welche Rolle spielt der Zufall in "Das Erdbeben in Chili"?
Der Zufall rettet die Protagonisten vor der Hinrichtung, führt sie aber letztlich in eine Situation, in der sie der menschlichen Brutalität schutzlos ausgeliefert sind.
Was bedeutet "gebrechliche Einrichtung der Welt" bei Kleist?
Dieser Begriff beschreibt Kleists Weltbild, in dem die Ordnung instabil ist und menschliche Erkenntnis nicht ausreicht, um das Schicksal zu verstehen oder zu kontrollieren.
Wie wird das Erdbeben theologisch gedeutet?
In der Novelle nutzen religiöse Eiferer die Katastrophe als "Strafgericht Gottes", um Gewalt gegen die Ausgestoßenen zu legitimieren.
- Quote paper
- Ulrike Scheske (Author), 2008, Die Erschütterung der Welt - Eine Interpretation von Heinrich von Kleists „Das Erdbeben in Chili“ unter dem Aspekt der Theodizeedebatte des 18. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165988