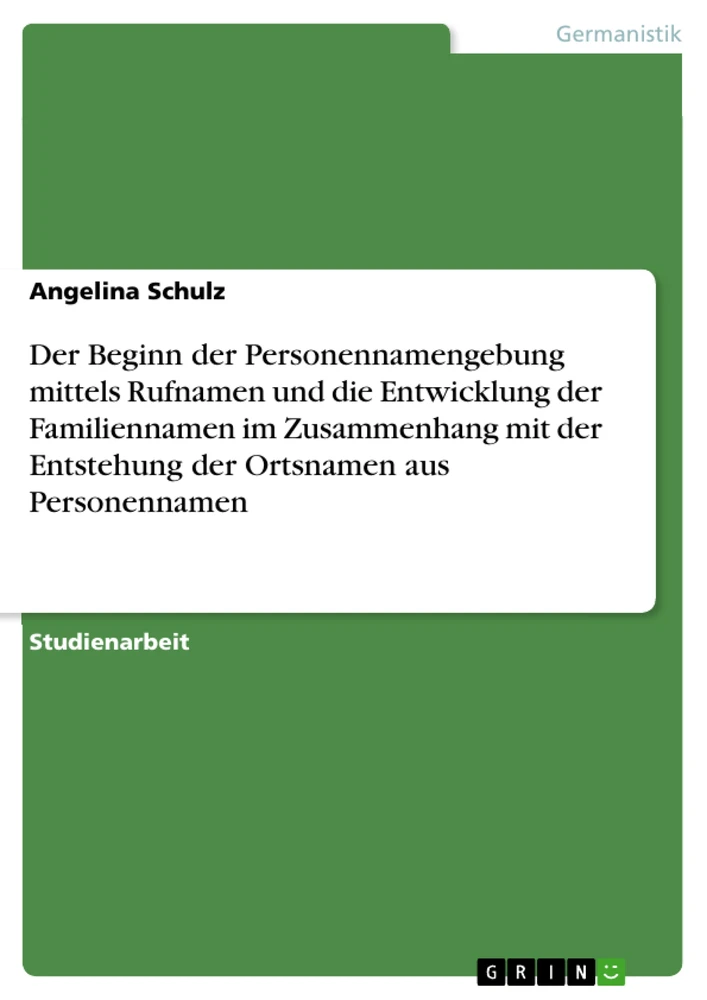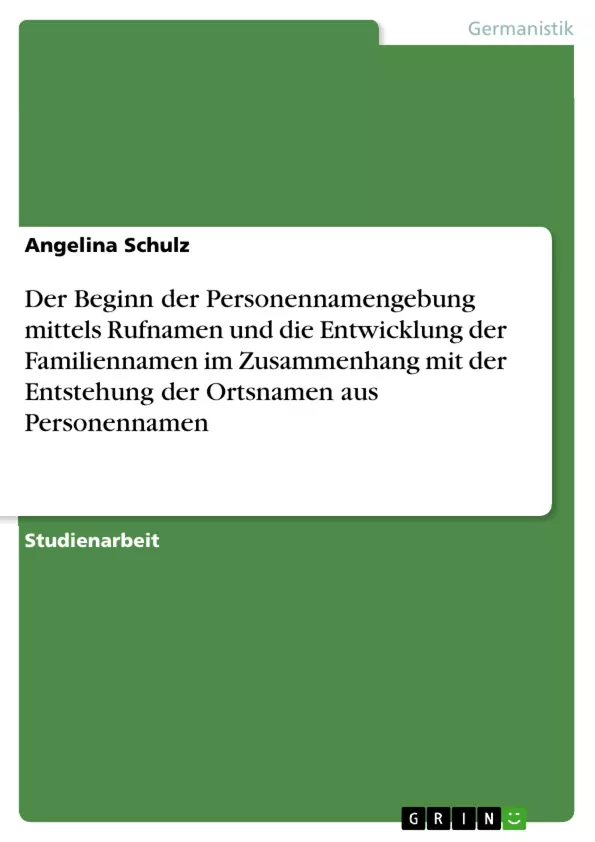Ich beschäftige mich in dieser Arbeit nicht nur mit den Rufnamen und der Entstehung von Familiennamen, sondern stelle auch eine Verbindung zur Ortsnamenforschung (Topomastik) her. Eine Verknüpfung erachte ich für sinnvoll, weil sich die Ortsnamengebung häufig aus den Personennamen ableiten lassen und somit als Bestimmungswörter für die Ortsnamen fungieren, daher soll dieser Bereich auch ein Schwerpunkt dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Personennamenforschung
- Die Bildung germanischer Rufnamen
- Übergang zur Zweinamigkeit
- Die Entstehung der Familiennamen
- Semantische Klassen von Familiennamen
- Familiennamen aus Rufnamen
- Familiennamen nach der Herkunft
- Familiennamen nach der Wohnstädte
- Familiennamen aus Berufs-, Amts- und Standesbezeichnungen
- Familiennamen aus Übernamen
- Das Bild der Familiennamen in der Gegenwart
- Ortsnamenforschung
- Entstehung und Veränderung der Ortsnamen
- Entstehung von Ortsnamen aus Personennamen
- Personenamen als Bestimmungswörter für Ortsnamen auf -leben
- Peiss und (Ober-) Stimm als Beispiele der Ortsnamengebung durch Personennamen
- Peiss
- (Ober-) stimm
- Nichtüberlieferte Rufnamen als Erstglieder von Ortsnamen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Erforschung von Personennamen und Ortsnamen, wobei der Schwerpunkt auf der Entstehung von Ortsnamen aus Personennamen liegt. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung von Rufnamen, die Entstehung von Familiennamen und die Bedeutung der Zweinamigkeit im historischen Kontext.
- Die Entwicklung von Rufnamen in der germanischen Sprache
- Der Übergang von der Einnamigkeit zur Zweinamigkeit und die Entstehung von Familiennamen
- Die verschiedenen semantischen Klassen von Familiennamen
- Die Entstehung von Ortsnamen aus Personennamen
- Die Bedeutung von Personen- und Ortsnamen in der Namensforschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Personennamenforschung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung von Personennamen, insbesondere den germanischen Rufnamen, dem Übergang zur Zweinamigkeit und der Entstehung von Familiennamen. Es werden die unterschiedlichen Motive der Namengebung, die Bildung von Rufnamen und die verschiedenen semantischen Klassen von Familiennamen beleuchtet.
- Kapitel 1.1: Die Bildung germanischer Rufnamen: Dieses Unterkapitel behandelt die Merkmale der germanischen Rufnamen, insbesondere deren zweigliedrige Struktur und die Motive der Namengebung.
- Kapitel 1.2: Übergang zur Zweinamigkeit: Dieses Unterkapitel beschreibt den Übergang von der Einnamigkeit zur Zweinamigkeit, der durch die zunehmende Namensähnlichkeit und das Stadtwachstum ausgelöst wurde.
- Kapitel 1.3: Die Entstehung der Familiennamen: Dieses Unterkapitel untersucht die Entstehung von Familiennamen, die aus Beinamen entstanden und im Laufe der Zeit zur festen Familienbezeichnung wurden. Es wird die Ausbreitung der Familiennamen von Ost nach West und die Rolle von Adligen, Knechten und Städten bei der Entwicklung von Familiennamen erläutert.
- Kapitel 2: Ortsnamenforschung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Veränderung von Ortsnamen. Es wird der Fokus auf die Entstehung von Ortsnamen aus Personennamen gelegt, wobei verschiedene Beispiele wie die Bestimmungswörter für Ortsnamen auf -leben und die Ortsnamengebung durch Personennamen, wie z.B. Peiss und (Ober-) Stimm, behandelt werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen der Namensforschung (Onomastik), Rufnamen, Familiennamen, Ortsnamenforschung (Topomastik), Zweinamigkeit, semantische Klassen von Familiennamen, Personen- und Ortsnamen, Etymologie und Genealogie.
Häufig gestellte Fragen
Wie sind germanische Rufnamen ursprünglich entstanden?
Germanische Rufnamen waren meist zweigliedrig und basierten auf bestimmten Motiven und Wortkombinationen innerhalb der Gemeinschaft.
Warum kam es zum Übergang zur Zweinamigkeit?
Durch das Stadtwachstum und die zunehmende Namensähnlichkeit wurde es notwendig, Personen durch einen zusätzlichen Familiennamen eindeutig zu identifizieren.
Welche Klassen von Familiennamen gibt es?
Die Arbeit unterscheidet Namen nach Herkunft, Wohnstätte, Beruf/Amt, Übernamen sowie Familiennamen, die direkt aus Rufnamen entstanden sind.
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Personen- und Ortsnamen?
Viele Ortsnamen leiten sich von Personennamen ab, die als Bestimmungswörter fungieren (z. B. Orte auf -leben oder Beispiele wie Peiss).
Was ist Topomastik?
Topomastik ist der Fachbegriff für die Ortsnamenforschung, die sich mit der Entstehung und Bedeutung von geographischen Namen befasst.
- Arbeit zitieren
- Angelina Schulz (Autor:in), 2009, Der Beginn der Personennamengebung mittels Rufnamen und die Entwicklung der Familiennamen im Zusammenhang mit der Entstehung der Ortsnamen aus Personennamen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166007