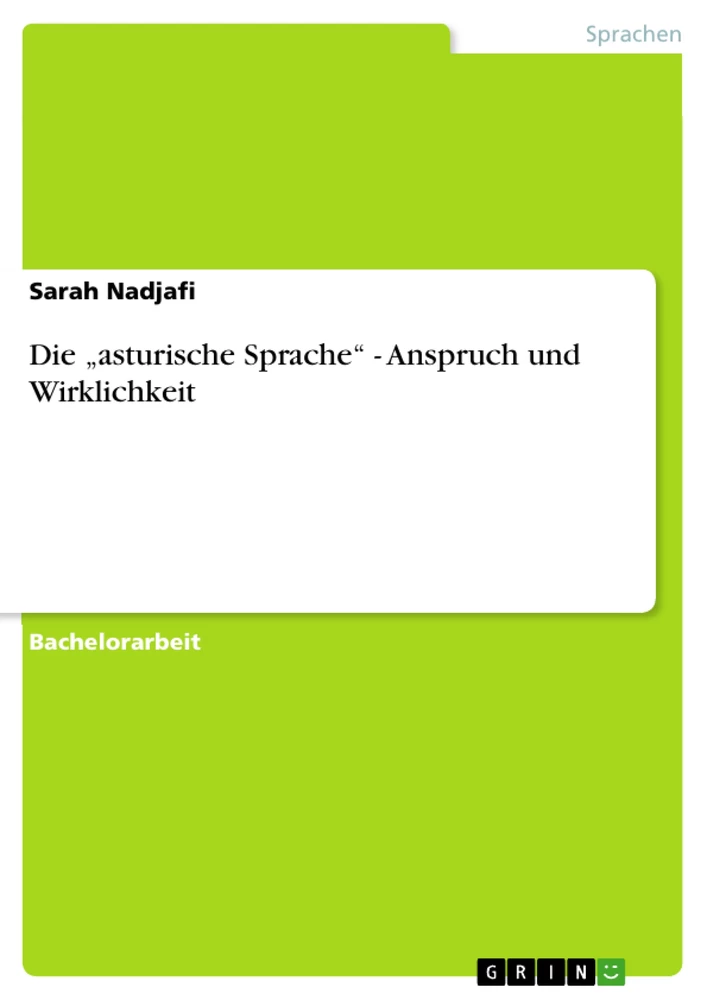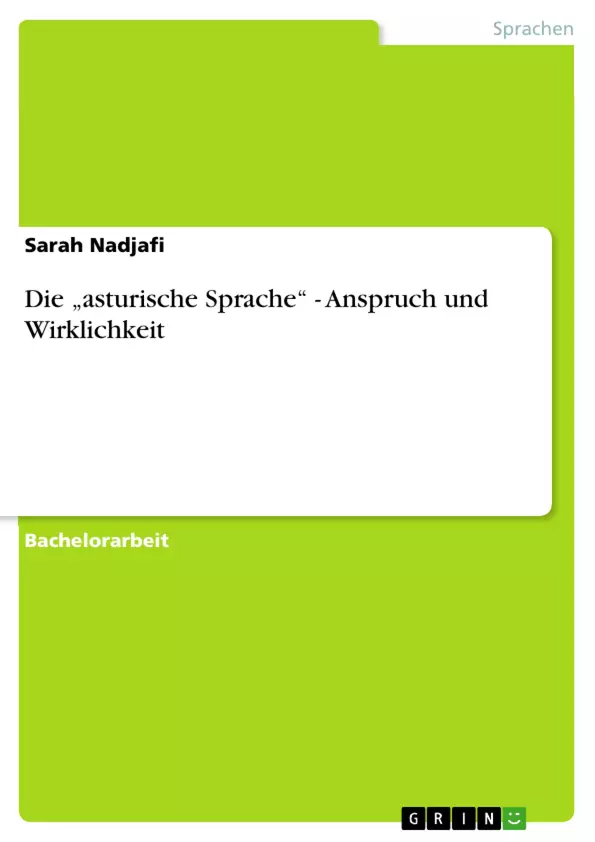In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob bzw. inwieweit der Anspruch auf Anerkennung als eigenständige und offizielle Sprache berechtigt ist. In diesem Zusammenhang ist zunächst die Klärung der Bedeutung verschiedener Bezeichnungen für das Asturische vorzunehmen.
Die proasturische Bewegung ist das Thema des nächsten Teils der Arbeit. Es werden die verschiedenen Organisationen und ihre Ziele vorgestellt. Besonders soll auf die Academia de la Llingua Asturiana gelegt werden, da sich diese stark für den offiziellen Status des Asturischen einsetzt.
Im folgenden Teil der Arbeit werden die sprachlichen Charakteristika thematisiert. Das Asturische soll auf phonetische, morphologische und lexikale Aspekte untersucht werden. Die Beschreibung der asturischen Sprache erfolgt im Vergleich mit der kastilischen (spanischen). So lassen sich Gemeinsamkeiten erkennen, aber v. a. Besonderheiten und Eigentümlichkeiten des Asturischen darstellen. Auch hieraus lassen sich Antworten ableiten im Hinblick auf die Eigenständigkeit des Asturianischen und damit auf den Anspruch auf Offizialität.
Von großer Bedeutung für die Frage der Offizialität sind auch soziolinguistische Zusammenhänge. Hier wird hier auf das Modell von Rodríguez zurückgegriffen, der die Unterscheidung von Dialekt und Sprache nach soziologischen Gesichtspunkten vornimmt. Anhand dieser Kriterien wird dann untersucht, ob das Asturische eher als Dialekt einzustufen ist oder als eigenständige Sprache mit dem berechtigten Anspruch auf Offizialität. Im Rahmen dieser Überprüfung werden die Gesetzeslage und der aktuelle Status des Asturischen beschrieben. Wichtig ist hier auch zu untersuchen, welche Bedeutung das Asturische im Bildungswesen und in den Medien einnimmt, da dies Hinweise gibt auf die kulturelle Bedeutung des Asturischen. Darüber wird die aktuelle sprachliche Situation sowie die Einstellung der Bevölkerung zur asturischen Sprache thematisiert.
Im Folgenden wird auf die Ergebnisse einer selbst durchgeführten Umfrage eingegangen. Diese erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität, soll allerdings in diesem Zusammenhang einen Eindruck über die Meinung der asturischen Bevölkerung im Bezug auf die Offizialität, liefern. Abschließend werden die im Laufe der Arbeit ermittelten Pro- und Kontraargumente im Hinblick auf die Frage nach der Offizialität einander gegenüber gestellt, um die Frage nach dem berechtigten Anspruch des offiziellen Status zu klären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte des Asturianischen
- Von der Entstehung bis zum Königreich León
- Vom Königreich Kastilien bis zur Diktatur Francos
- Transición und pro-asturianische Bewegung
- Aufkommen der pro-asturianischen Bewegung
- Gegner und Probleme der pro-asturianischen Bewegung
- Neuer Schwung in der pro-asturianischen Bewegung
- Gesetzlicher Rahmen des Asturianischen
- Verfassung des Königreichs Spanien
- Autonomiestatut des Fürstentums Asturien
- Ley de uso y promoción del Bable/Asturiano
- European Charter for Regional or Minority Languages
- Aktuelle Situation des Asturianischen
- Soziolinguistische Situation
- Akteure im Kampf um die offizielle Anerkennung
- Offizieller Gebrauch des Asturianischen
- Asturianisch im Schulwesen
- Wiedereinführung der traditionellen Ortsnamen
- Medienpräsenz des Asturianischen und asturianischsprachige Literatur
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Geschichte und der aktuellen Situation des Asturianischen, einer Sprache, die in Spanien nicht offiziell anerkannt ist. Sie untersucht, welche Fortschritte die Verfechter der Sprache im Kampf für deren Anerkennung erzielt haben und welche Herausforderungen bestehen.
- Die Geschichte der Asturianischen Sprache, von ihren Anfängen bis zur Diktatur Francos
- Die Entstehung und Entwicklung der pro-asturianischen Bewegung
- Der aktuelle rechtliche Rahmen für die Asturianische Sprache und seine Auswirkungen auf deren Nutzung
- Die soziolinguistische Situation des Asturianischen, einschließlich seiner Verbreitung und der Akzeptanz durch die Bevölkerung
- Die Rolle des Asturianischen in Bildung, Medien und Kultur.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und beleuchtet die Bedeutung des Asturianischen für die Kultur und Identität der Region Asturien. Kapitel zwei zeichnet einen Abriss der Geschichte der Sprache, von ihren Ursprüngen bis zur Diktatur Francos. Kapitel drei behandelt die Entwicklung der pro-asturianischen Bewegung, die sich für die Erhaltung und Anerkennung der Sprache einsetzt. Kapitel vier untersucht den aktuellen rechtlichen Rahmen, der die Nutzung und Förderung des Asturianischen regelt. Kapitel fünf beleuchtet die aktuelle Situation des Asturianischen in der Gesellschaft, in der Bildung, in den Medien und in der Kultur.
Schlüsselwörter
Asturianisch, Bable, Astur-Leonesisch, pro-asturianische Bewegung, Sprachpolitik, Sprachrechte, Soziolinguistik, kulturelle Identität, offizielle Anerkennung, Spanien, Asturien, UNESCO, Europäische Charta für regionale Minderheitensprachen.
Häufig gestellte Fragen
Ist Asturianisch eine anerkannte offizielle Sprache?
Nein, das Asturianische (auch Bable genannt) besitzt in Spanien keinen offiziellen Status, obwohl Bewegungen wie die Academia de la Llingua Asturiana dafür kämpfen.
Was unterscheidet Asturianisch vom Kastilischen (Spanischen)?
Die Arbeit untersucht phonetische, morphologische und lexikale Unterschiede, die die Eigenständigkeit des Astur-Leonesischen belegen.
Welche Rolle spielt die pro-asturianische Bewegung?
Verschiedene Organisationen setzen sich für Sprachrechte, die Förderung im Bildungswesen und die mediale Präsenz der Sprache ein.
Wie ist die aktuelle Gesetzeslage für das Asturianische?
Die Nutzung wird durch das Autonomiestatut von Asturien und das „Ley de uso y promoción“ geregelt, bietet jedoch keinen vollen offiziellen Schutz wie andere Regionalsprachen.
Wird Asturianisch in Schulen unterrichtet?
Ja, es gibt Bestrebungen und Regelungen zur Einbindung in das Schulwesen, allerdings variiert die Umsetzung stark.
- Arbeit zitieren
- Sarah Nadjafi (Autor:in), 2010, Die „asturische Sprache“ - Anspruch und Wirklichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166026