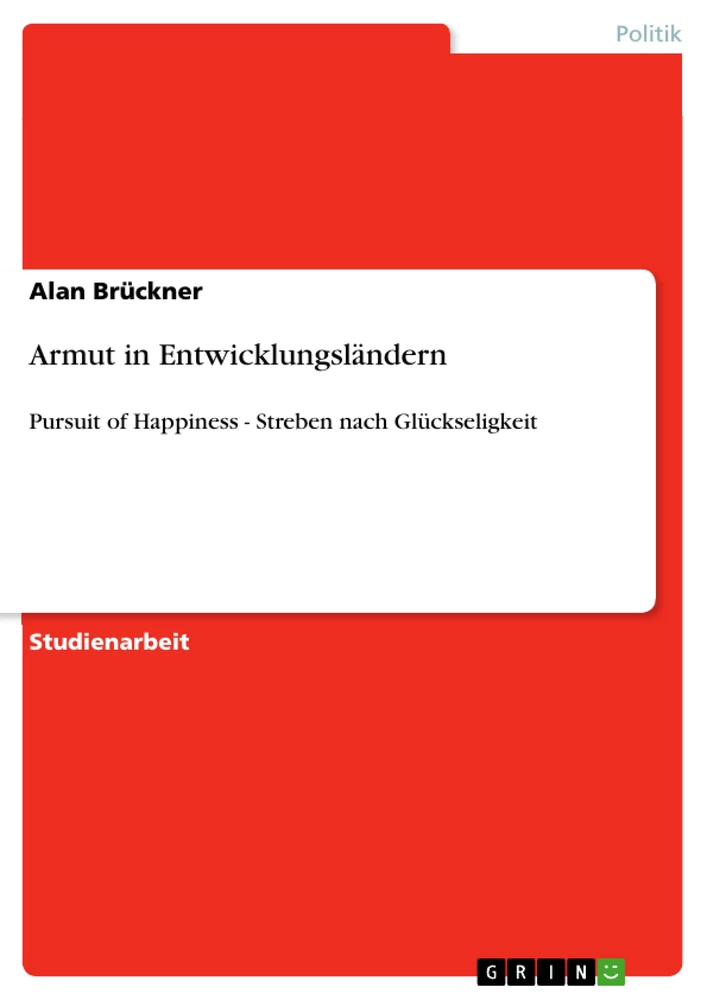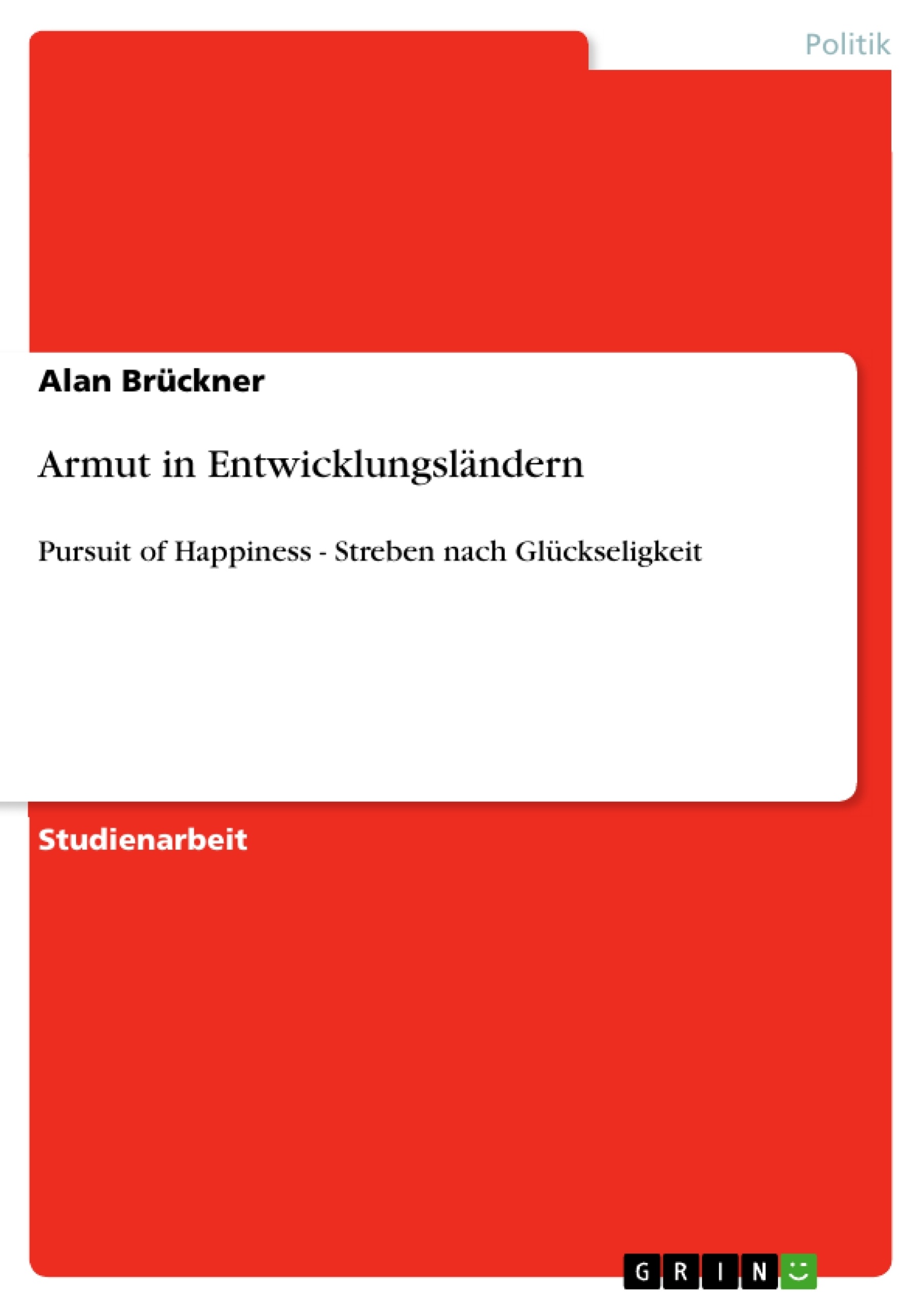Im Jahr 2006, also neun Jahre vor dem geplanten Erreichen der Millenniumsziele (den Hunger auf der Welt zu halbieren, den Basisunterricht für alle Kinder dieser Welt u.a.), sieht es auf der Südhalbkugel unserer Erde ganz anders aus. Nach Angaben der Welthungerhilfe stieg die Zahl der Hungernden innerhalb eines Jahres von 848 Millionen auf 923 Millionen Menschen weltweit. Der größte Teil, nämlich 907 Millionen, lebt in Entwicklungsländern. Nachdem die Zahl der Hungernden seit 1990 um jährlich 1% sank, nahm sie 2007 um etwa 75 Millionen zu. Für das Jahr 2008 wird aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise ein weiterer Zuwachs von mindestens 75 Millionen Menschen erwartet. Etwa 969 Millionen Menschen leben von weniger als einem Dollar pro Tag, 17% von ihnen haben nicht einmal 50 Cent zur Verfügung. Der Preis für Reis ist derzeit (2008) viermal so hoch wie 2003. Mais und Butter kosten mehr als dreimal so viel wie 2003.
Was sind die Ursachen des Entwicklungsdefizits zwischen den Industriestaaten, die überwiegend im nördlichen Teil der Erde liegen und den Ländern der Dritten Welt, die überwiegend in der südlichen Hemisphäre zu finden sind? Welche Folgen ergeben sich aus diesen Ursachen für die dort lebenden Menschen? Auf diese Fragen möchte ich im weiteren Verlauf dieses Textes eingehen. Meine Aussagen werde ich an plausiblen und teilweise erschreckenden Beispielen verdeutlichen. Mein Ziel ist es auf die ungerechten und teilweise unmenschlichen Bedingungen, unter denen die arme Bevölkerung der Dritten Welt zu leiden hat, aufmerksam zu machen und so, auch wenn es nur ein kleiner ist, meinen Beitrag zu leisten. Ich bitte um Verständnis, wenn ich aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die Bezeichnung beider Geschlechter verzichte. Ich mache aber deutlich, dass sich die Bezeichnung, sofern es sich nicht speziell um eines der beiden Geschlechter handelt, auf weibliche als auch auf männliche Personen bezieht. Dies bedeutet aber keineswegs eine Abwertung oder Diskriminierung des weiblichen Geschlechts, sondern dient der Übersichtlichkeit und dem vorrangigen Inhalt meines Textes.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsdefinitionen
2.1 Armut
2.2 Globalisierung
3. Ursachen für Armut
3.1 Ursachen allgemein
3.2 Ursachen speziell - Verschuldung
4. Folgen der Armut
4.1 Unterernährung
4.2 Wassermangel
4.3 Seuchen
5. Fazit und Möglichkeiten
Quellenverzeichnis
1. Einleitung
In der folgenden Arbeit geht es um mögliche Ursachen, Folgen und Verantwortliche des Phänomens Armut in der Dritten Welt. Am Beispiel einer Favela in Brasilien leite ich das Thema ein.
Die Landschaft Brasiliens besteht hauptsächlich aus zwei Großlandschaften: den ausgedehnten Regenwäldern des Amazonas-Tieflands im Norden und dem brasilianischen Bergland im Süden. Während die landwirtschaftliche Basis des Landes in den Savannengebieten des Mittelwestens liegt, lebt der Großteil der Bevölkerung in der Nähe der Atlantikküste, wo sich auch fast alle Großstädte befinden. Eine dieser Großstädte ist die 2,2 Millionen Einwohner fassende Stadt Brasília. Brasília ist seit 1960 anstelle von Rio de Janeiro die Bundeshauptstadt Brasiliens. Die Stadt wurde hochmodern geplant und ab 1957 im zentralen Hochland gebaut, um die Erschließung Innerbrasiliens anzuregen.
Am östlichen Rand von Brasília, zwischen den letzten Hochhäusern und mehreren in den Himmel ragenden Bergen von Unrat der stadtzugehörigen Mülldeponie, liegt ein Hüttenviertel, worin etwa 20.000 Familien zusammengepfercht auf engstem Raum leben. In den Gassen laufen viele fröhliche, aber sichtlich unterernährte Kinder umher. Mütter tragen ihre Säuglinge, deren Mund, Nase und Augen von dicken violetten Fliegen bedeckt sind, welche noch vor wenigen Augenblicken auf den überall herumliegenden Exkrementen gesessen haben. Die Menschen klettern halb nackt auf den riesigen Müllbergen, Ratten in der Größe von Katzen schlängeln sich durch die Beine und konkurrieren um das wenig Nutzbare. Das ganze Viertel lebt vom Lixo, vom Abfall, den in der angrenzenden Großstadt niemand mehr haben will. Alles was brauchbar scheint, wird für sehr wenig, aber besser als nichts, an die Zwischenhändler, die hinter den Schranken warten, verkauft. Die Lebensmittelabfälle, das Obst, das Gemüse und die tierischen Abfälle werden zu Mahlzeiten verarbeitet und das, was selbst die Ärmsten der Armen nicht mehr wollen, wird an die Schweine verfüttert. Die einfachen Behausungen der Bewohner bestehen aus Pappkartons, aus Wellblechen, aus Holzbrettern, aus Pflanzenteilen oder ähnliche nutzbare Materialien, die zusammengebaut so etwas wie ein zu Hause bieten. Die Menschen, die dort leben, sind Hungerflüchtlinge, Opfer des Latifundiums und Opfer der Lebensmittelkonzerne, die den fruchtbaren Boden monopolisieren und die Pächter und deren Familien verjagten (vgl. Ziegler 2005a, S.106ff).
Dieses Viertel in Brasília ist allerdings kein Einzelfall. An den Rändern der brasilianischen Großstädte befinden sich viele solcher Elendsviertel, in denen bis zu 250.000 Menschen leben. Diese Viertel in den Randlagen der großen brasilianischen Städte heißen “Favela” (vgl. ebd.). Der Begriff stammt von der gleichnamigen brasilianischen Kletterpflanze, denn ähnlich wie die Pflanze siedeln sich die Armenviertel an den Bergen an und “klettern diese hoch”. Leben in einer Favela bedeutet ein Leben am untersten Existenzminimum, Unterernährung, Vitaminmangel und Aussichtslosigkeit. Aber diese Menschen haben Bedürfnisse, sie haben Würde, sie haben Scham. Die einheimische Soziologin Maria do Carmo Soares de Freitas und ihre Mitarbeiter an der Bundesuniversität Bahia in Brasilien führten eine Studie in einem Viertel in Salvador durch, um zu begreifen, wie diese Menschen selbst ihre Lage erleben. Laut ihrem noch nicht veröffentlichten Buch “Os textos dos famintos” verbergen diese unterernährten Menschen ihre Scham mit Sätzen wie “A fome vem de fora do corpo.” (“Der Hunger kommt von außerhalb des Körpers”). Die, die nicht anders können, als sich von Abfällen anderer zu ernähren, die sie in den Mülltonnen finden, sagen: “Preciso tirar a vergonha de catar no lixo, porque pior e roubar.” (“Ich muss meine Scham überwinden, in den Abfällen zu wühlen, weil das Stehlen schlimmer wäre”). Sie nennen den Hunger “a coisa” (“das Ding”), ”a coisa bater na porta.” (“Das Ding klopft an meine Tür”)(vgl. Ziegler 2005a, S.110f).
Es gibt Menschen in Deutschland, die Scham empfinden, wenn sie Sozialleistungen vom Staat entgegennehmen, um ihre Existenz zu sichern. Eine Scham, welche verständlich und nachempfindbar ist, denn die Würde eines Menschen konkurriert u.a. mit der Inanspruchnahme der Hilfe anderer Menschen oder Institutionen. Die Menschen in den armen Regionen unserer Erde, die auf Müllkippen herumkriechen, um das Allernötigste zu haben, was sie zum Überleben brauchen, bekommen keine Sozialleistungen und haben keine Existenzsicherung. Kein Platz für Würde, kein Platz für Scham. Im ersten Artikel des deutschen Grundgesetzes steht: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Wird das Arbeitslosengeld II auch als noch so wenig empfunden, ist es auch noch so umstritten, sind diese Leistungen auch noch so unangenehm, seiner Pflicht des 1.Artikels im Grundgesetz ist der Staat in diesem Sinne nachgekommen. Niemand in Deutschland muss sich so erniedrigen wie die Menschen in den Favelas in Brasília, Sao Paulo oder Rio de Janeiro, in den Calampas in Lima oder in den dreckigen Slums der Smoky Mountains in Manila, um dem Trieb zu folgen, denen fast jeder von den mehr als 6 Milliarden menschlichen Bewohnern unseres Planeten nachgeht: Dem Trieb zu überleben.
Im Jahr 2006, also neun Jahre vor dem geplanten Erreichen der Millenniumsziele (den Hunger auf der Welt zu halbieren, den Basisunterricht für alle Kinder dieser Welt u.a.), sieht es auf der Südhalbkugel unserer Erde ganz anders aus. Nach Angaben der Welthungerhilfe stieg die Zahl der Hungernden innerhalb eines Jahres von 848 Millionen auf 923 Millionen Menschen weltweit. Der größte Teil, nämlich 907 Millionen, lebt in Entwicklungsländern (vgl. von Grebmer 2008, S.5). Nachdem die Zahl der Hungernden seit 1990 um jährlich 1% sank, nahm sie 2007 um etwa 75 Millionen zu. Für das Jahr 2008 wird aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise ein weiterer Zuwachs von mindestens 75 Millionen Menschen erwartet. Etwa 969 Millionen Menschen leben von weniger als einem Dollar pro Tag, 17% von ihnen haben nicht einmal 50 Cent zur Verfügung (vgl. von Grebmer 2008,S.18). Der Preis für Reis ist derzeit (2008) viermal so hoch wie 2003. Mais und Butter kosten mehr als dreimal so viel wie 2003 (vgl. von Grebmer 2008,S.23).
Was sind die Ursachen des Entwicklungsdefizits zwischen den Industriestaaten, die überwiegend im nördlichen Teil der Erde liegen und den Ländern der Dritten Welt, die überwiegend in der südlichen Hemisphäre zu finden sind? Welche Folgen ergeben sich aus diesen Ursachen für die dort lebenden Menschen? Auf diese Fragen möchte ich im weiteren Verlauf dieses Textes eingehen. Ich habe mich bei meiner Recherche auf Bücher, Zeitschriften, Daten, Fakten usw. verschiedener Organisationen, Institutionen und Autoren berufen. Meine Aussagen werde ich an plausiblen und teilweise erschreckenden Beispielen verdeutlichen. Mein Ziel ist es auf die ungerechten und teilweise unmenschlichen Bedingungen, unter denen die arme Bevölkerung der Dritten Welt zu leiden hat, aufmerksam zu machen und so, auch wenn es nur ein kleiner ist, meinen Beitrag zu leisten. Ich bitte um Verständnis, wenn ich aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die Bezeichnung beider Geschlechter verzichte. Ich mache aber deutlich, dass sich die Bezeichnung, sofern es sich nicht speziell um eines der beiden Geschlechter handelt, auf weibliche als auch auf männliche Personen bezieht. Dies bedeutet aber keineswegs eine Abwertung oder Diskriminierung des weiblichen Geschlechts, sondern dient der Übersichtlichkeit und dem vorrangigen Inhalt meines Textes.
2. Begriffsdefinitionen
Um über die Ursachen, die Folgen oder die Verantwortlichen des Phänomens Armut schreiben oder sprechen zu können, sollten einige Begriffe geklärt sein, die direkt oder indirekt mit der existentiellen Bedrohung vieler Menschen weltweit zu tun haben und seit einiger Zeit auch in diesem Zusammenhang in aller Öffentlichkeit debattiert werden. Zum einen der Begriff Armut, der nicht so einfach zu erläutern ist, da viele unterschiedliche Faktoren zu berücksichtigen sind. Und zum anderen der Begriff Globalisierung.
2.1 Armut
Der ehemalige Präsident der Weltbank Robert Strange McNamara definierte den Begriff Armut in einer wegweisenden Rede 1973 in Nairobi so: “Absolute A.(...) ist durch einen Zustand solch entwürdigender Lebensbedingungen wie Krankheit, Analphabetentum, Unterernährung und Verwahrlosung charakterisiert, daß (!) die Opfer dieser Armut nicht einmal die grundlegendsten menschlichen Existenzbedürfnisse befriedigen können” (Nohlen 2000, S.62).
Grundsätzlich kann man sagen, dass Arme ein Leben ohne Grundfreiheiten wie Handlungs- und Entscheidungsfreiheit führen. Häufig mangelt es an angemessener Nahrung, Obdach, Bildung und oder Gesundheit. Außerdem werden Arme oft Opfer der Willkür staatlicher und gesellschaftlicher Institutionen, und haben nicht die Macht, wichtige Entscheidungen, welche sich auf ihr Leben auswirken, zu beeinflussen (vgl. Weltentwicklungsbericht 2001,S.1). Armut ist die Folge wirtschaftlicher, politischer und sozialer Prozesse, die miteinander im Verhältnis stehen und sich oft gegeneinander verstärken, so dass der Mangel der Armen verschärft wird. Laut einer Zusammenfassung des Weltentwicklungsberichts der Weltbank (2001, S.3) leben 2,8 Mrd. Menschen von weniger als 2 US-Dollar am Tag. 1,2 Mrd. Menschen leben sogar von weniger als 1 US-Dollar pro Tag. 44% von diesen Menschen leben in Südasien (vgl.ebd.). Der prozentuale Anteil in den afrikanischen Ländern, vor allem südlich der Sahara, ist allerdings wesentlich höher. 220 Mio. Menschen leben dort von weniger als 1 US-Dollar in lokaler Kaufkraft pro Tag. Das sind etwa 40% der afrikanischen Bevölkerung (vgl. Achinger 2007,S.180). Die Maßstäbe für diese Standards und die Vorstellungen über die Ursachen von Armut sind allerdings örtlich und zeitlich sehr verschieden. Der Begriff Armut entzieht sich wegen seiner Vielschichtigkeit einer allgemeingültigen Definition. Wenn in wohlhabenden Ländern wie in Deutschland von Armut gesprochen wird, dann ist dies nicht das Gleiche wie die Armut in Äthiopien oder Swasiland, denn eine Grundsicherung an Essen, Obdach oder Kleidung ist für alle Menschen in Deutschland möglich. Daher ist zwischen absoluter und relativer Armut zu unterscheiden. “Die Weltbank bezeichnet Armut als den Mangel an Chancen, ein Leben zu führen, das gewissen Minimalstandards entspricht. Menschen gelten als absolut oder extrem arm, wenn sie weniger als 1 US - Dollar pro Tag zur Verfügung haben” (Achinger 2007,S.180). Dies trifft überwiegend für Länder der Dritten Welt zu. In Wohlstandsgesellschaften wird Armut häufig als relative Armut definiert. Als relativ arm wird eine Person bezeichnet, deren Einkommen weniger als einen bestimmten Prozentsatz (meistens 50% oder 60%) des Durchschnittseinkommens seines Landes beträgt. So wird seit 2001 in den Mitgliedsländern der EU derjenige als relativ arm bezeichnet, der weniger als 60% des Nettoäquivalenzeinkommens hat (2. Armut- und Reichtumsbericht 2003,S.19). Das Pro-Kopf-Äquivalenzeinkommen wird ermittelt, indem das Haushaltseinkommen durch die Zahl der im Haushalt lebenden Personen dividiert wird. Jedoch wird hier eine Gewichtung der Personen vorgenommen (z.B. nach der OECD-Äquivalenz-Skala: Erster Erwachsener: 1; jede weitere Person über 14 Jahren: 0,5; Kinder unter 14: 0,3). Die relative Armut kann objektiver Natur sein, also unabhängig davon, ob sie vom Betroffenen als solche empfunden wird. Von subjektiver relativer Armut spricht wird gesprochen, wenn der Betroffene sich arm fühlt, unabhängig von der objektiven Feststellung. Hauptursache von relativer Armut sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung, stark ungleiche Einkommensverteilung und Bildungsmangel. Eine hohe Kinderzahl scheint auch ein Risikofaktor zu sein. In Deutschland lebten im Januar 2003 13,5% der Bevölkerung nach dieser Definition in relativer Armut (vgl. Armut- und Reichtumsbericht 2003,S.19f). Wird die Armutsgrenze auf weniger als 40% des Durchschnittseinkommens des jeweiligen Landes berechnet, läge der prozentuale Anteil der Bevölkerung in Deutschland, die als relativ arm gelte, bei unter 2% (vgl. ebd.).
2.2 Globalisierung
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
In dieser Arbeit geht es um mögliche Ursachen, Folgen und Verantwortliche des Phänomens Armut in der Dritten Welt, illustriert am Beispiel einer Favela in Brasilien.
Was ist eine Favela?
Favela ist der Name für Elendsviertel an den Rändern brasilianischer Großstädte, in denen Menschen unter extremen Bedingungen leben.
Wie definierte Robert Strange McNamara Armut?
McNamara definierte Armut als einen Zustand entwürdigender Lebensbedingungen wie Krankheit, Analphabetentum, Unterernährung und Verwahrlosung, in dem die grundlegendsten menschlichen Existenzbedürfnisse nicht befriedigt werden können.
Was sind die Folgen von Armut?
Armut führt häufig zu Unterernährung, Wassermangel, Seuchen und einem Leben ohne Grundfreiheiten.
Was ist der Unterschied zwischen absoluter und relativer Armut?
Absolute Armut bedeutet, dass Menschen weniger als 1 US-Dollar pro Tag zur Verfügung haben. Relative Armut bezieht sich auf Personen, deren Einkommen unter einem bestimmten Prozentsatz (meist 50% oder 60%) des Durchschnittseinkommens ihres Landes liegt.
Wie definiert die Weltbank Armut?
Die Weltbank bezeichnet Armut als den Mangel an Chancen, ein Leben zu führen, das gewissen Minimalstandards entspricht.
Was ist Globalisierung?
Globalisierung ist die zunehmende wirtschaftliche, kulturelle und soziale Verflechtung, die sich in einem stärker werdenden Austausch von Gütern, Kapital, Wissen und Arbeitskräften zwischen den Ländern zeigt.
Welche Auswirkungen hat die Globalisierung auf die Armut?
Die Globalisierung hat sowohl positive als auch negative Auswirkungen. Börsenkrisen können weltweite Wirbelstürme auslösen, und Veränderungen in Ernährungsgewohnheiten in einem Land können zu mehr Hungersnot in einem anderen Land führen.
Wie viele Menschen leben von weniger als einem Dollar pro Tag?
Etwa 969 Millionen Menschen leben von weniger als einem Dollar pro Tag.
Wie hat sich die Zahl der Hungernden weltweit entwickelt?
Nachdem die Zahl der Hungernden seit 1990 sank, stieg sie 2007 um etwa 75 Millionen und wird für 2008 aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise weiter steigen.
- Quote paper
- Alan Brückner (Author), 2008, Armut in Entwicklungsländern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166104