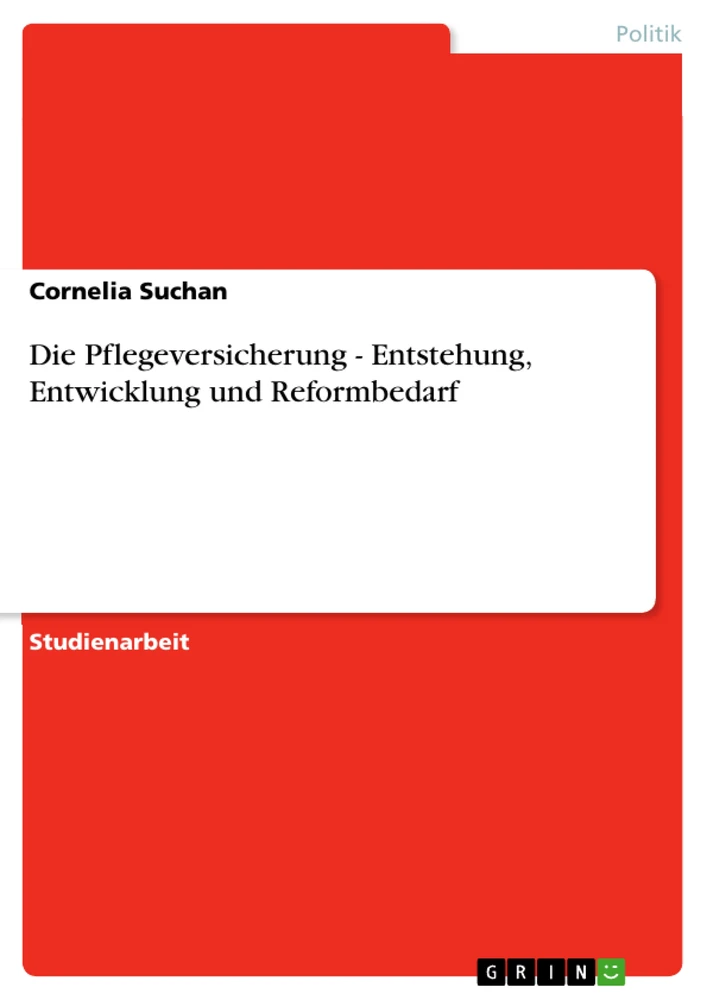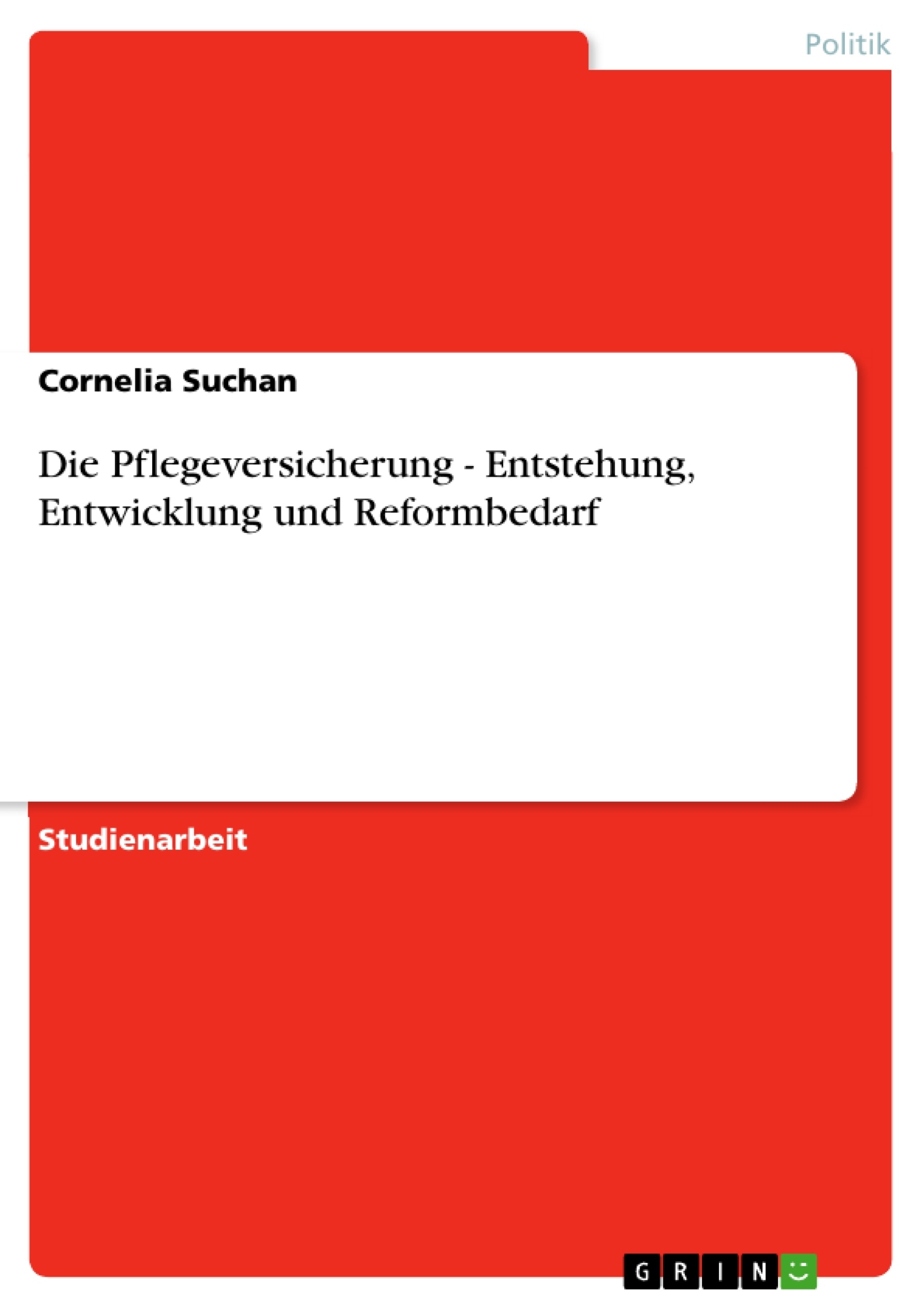Die Einführung der sozialen Pflegeversicherung als fünfte Säule der Sozialversicherung in Deutschland erfolgte nach einer fast zwanzigjährigen „Beratungsphase“. Wohl kaum ein politisches Großprojekt hat von der Problemerkennung bis zur letztendlichen gesetzlichen Normierung so lange gebraucht wie die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung. Im Jahre 1994 wurde schließlich das Gesetz verabschiedet, so dass es am 01.01.1995 in Kraft treten konnte. Die soziale Pflegeversicherung galt als der einzig realistische Weg für eine umfassende und sofortige Absicherung des Pflegerisikos.
Heute, keine zehn Jahre nach der Einführung, steht Deutschland, so scheint es, am Scheideweg: Neben der Renten- und Krankenversicherung ist auch die Pflegeversicherung offenbar an die Grenze der Finanzierbarkeit gestoßen. Durch die demografische Entwicklung und weitere gesellschaftlichen Veränderungen steht die Pflegeversicherung vor großen Problemen und Herausforderungen, auf die der Gesetzgeber umgehend reagieren muss, um auch weiterhin Leistungen für Pflegebedürftige vorhalten zu können.
Es stellt sich die Frage, wie es denn nun allgemein um die Zukunftsfähigkeit der sozialen Pflegeversicherung in Deutschland steht.
Inhaltsverzeichnis
- A) Allgemeiner Teil
- 1. Einleitung
- 2. Die Entstehung der Pflegeversicherung
- 3. Ziele und Grundabsichten der Pflegeversicherung
- 4. Merkmale und Leistungen
- B) Zukunftsfähigkeit der Pflegeversicherung in Deutschland
- 1. Der Status Quo
- 1.1. Leistungsempfänger
- 1.2. Auswirkungen der Pflegeversicherung im Bereich der Sozialhilfe
- 1.3. Einnahmen / Ausgaben
- 1.4. Wirkungen der Pflegeversicherung
- 2. Prognose künftiger Entwicklungen
- 2.1. Demografische Entwicklung
- 2.2. Entwicklung der Pflegebedürftigkeit
- 2.3. Verschärfungen im veränderten Pflegesystem
- C) Reformvorschläge
- 1. Vorschläge der Rürup-Kommission
- 2. Vorschläge der Herzog-Kommission
- 3. Vorschläge des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe
- 4. Aktuelle Bestrebungen in der Politik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der deutschen Pflegeversicherung. Es werden die Entstehung und Entwicklung des Sozialversicherungssystems beleuchtet sowie die Notwendigkeit von Reformen untersucht. Die Arbeit analysiert den Status Quo der Pflegeversicherung, untersucht die Folgen der demografischen Entwicklung auf die Pflegebedürftigkeit und beleuchtet verschiedene Reformvorschläge.
- Entstehung und Entwicklung der Pflegeversicherung
- Ziele und Grundabsichten der Pflegeversicherung
- Zukunftsfähigkeit der Pflegeversicherung in Deutschland
- Reformvorschläge für die Pflegeversicherung
- Aktuelle Bestrebungen der Politik zur Reform der Pflegeversicherung
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Hausarbeit bietet eine Übersicht über die Entstehung der Pflegeversicherung in Deutschland. Es werden die wichtigsten Phasen der Debatte, die Ziele und Grundabsichten sowie Merkmale und Leistungen der Pflegeversicherung dargestellt.
Der zweite Teil widmet sich der Zukunftsfähigkeit der Pflegeversicherung. Dabei werden die Folgen der demografischen Entwicklung und die Zunahme der Pflegebedürftigkeit für die Finanzierbarkeit der Pflegeversicherung untersucht.
Der dritte Teil präsentiert verschiedene Reformvorschläge zur Verbesserung des Pflegeversicherungssystems. Es werden die Vorschläge der Rürup-Kommission, der Herzog-Kommission und des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe vorgestellt.
Der vierte Teil beleuchtet die aktuellen Bestrebungen der Politik zur Reform der Pflegeversicherung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Hausarbeit sind: Pflegeversicherung, Entstehung, Entwicklung, Reformbedarf, Zukunftsfähigkeit, Demografische Entwicklung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilfe, Einnahmen, Ausgaben, Reformvorschläge, Rürup-Kommission, Herzog-Kommission, Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe, Aktuelle Politik.
- Quote paper
- Diplom-Pädagogin Cornelia Suchan (Author), 2006, Die Pflegeversicherung - Entstehung, Entwicklung und Reformbedarf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166133