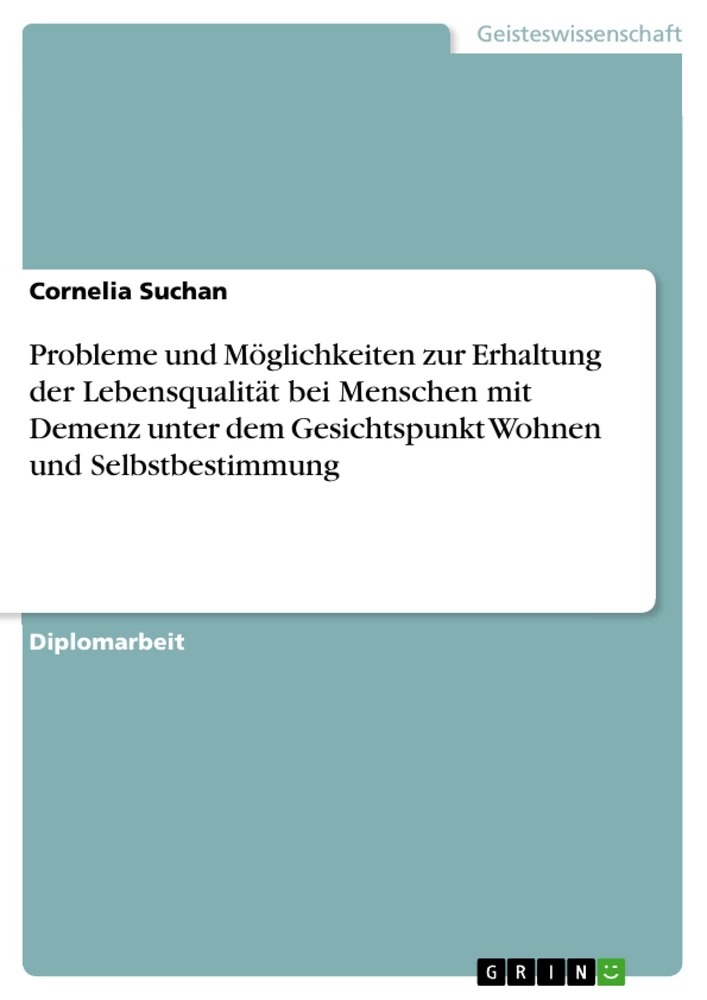Eine Demenz ist die im Alter am häufigsten auftretende psychische Erkrankung. Werden in der medizinischen Forschung in nächster Zeit keine durchschlagenden Erfolge bei der Therapie oder Prävention erreicht, so wird die Zahl der an Demenz erkrankten Menschen aufgrund der prognostizierten demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Demenzerkrankungen sind dabei aber nicht nur ein medizinisches Problem sondern reichen mit ihren Wirkungen weit in familiale, soziale und gesellschaftliche Strukturen hinein.
Demenzerkrankungen bringen für alle Betroffenen, den Kranken selbst wie für sein soziales Umfeld, viele Einschränkungen, Belastungen und Probleme mit sich. Die Erkrankung führt bei den Betroffenen allmählich zu starken kognitiven Einbußen, Hilflosigkeit in der Alltagsbewältigung sowie zu einer Behinderung der selbständigen Lebensführung. Somit haben die Beeinträchtigungen einen gravierenden Einfluss auf alle Bereiche des Lebens und werden zu einem bestimmenden Element von Lebensgestaltung und Lebensqualität. Oft wird erwähnt, dass eine Demenzerkrankung eine Minderung der Lebensqualität darstellt bzw. dass Demenzkranke gar keine Lebensqualität mehr besitzen würden. Auch stellt sich die Frage, ob durch die zunehmende Abhängigkeit der Demenzkranken es nicht verfehlt ist, im Umgang mit dementiell erkrankten Menschen von Selbstbestimmung und Selbständigkeit zu reden. Oft wird dementiell erkrankten Menschen abgesprochen eigene Entscheidungen treffen zu können bzw. sie werden in vielen Dingen gar nicht erst gefragt.
Die meisten dementiell erkrankten Menschen werden zu Hause versorgt, was zu erheblichen Belastungen bei den pflegenden Angehörigen führt. Aber auch innerhalb stationärer Einrichtungen nehmen Demenzkranke mittlerweile eine dominierende Rolle ein während ein Großteil der Heime für diese Personengruppe keine optimale Versorgung sichern kann. Das Anliegen meiner Arbeit ist es aufzuzeigen, welche Probleme aus diesen vielfältigen Beeinträchtigungen einer Demenzerkrankung bei der Erhaltung von Lebensqualität und Selbstbestimmung im stationären wie im häuslichen Bereich entstehen können und wie Lebensqualität und Selbstbestimmung gefördert werden kann. Gleichzeitig gewinnt die Frage an Bedeutung, wie die Versorgungsstrukturen in den Einrichtungen beschaffen sein müssen, um den wachsenden Versorgungs- und Betreuungsansprüchen der Erkrankten bedarfsgerecht zu entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff Demenz
- Historische Entwicklung des Demenzbegriffs
- Krankheitsbild Demenz
- Formen der Demenz
- Demenz vom Alzheimer-Typ (DAT)
- Andere spezifische Demenzen
- Sekundäre Demenzsymptome / Verhaltensstörungen
- Demografische Aspekte und Prävalenz
- Risikofaktoren
- Medikamentöse Therapie
- Antidementiva / Nootropika
- Psychopharmaka
- Erfolge der medikamentösen Therapie
- Demenzsymptome und deren Konsequenzen für das Umfeld
- Die Welt der Demenzkranken
- Folgen einer Demenz
- Lebensqualität und Wohlbefinden bei Demenz
- Probleme bei der Erfassung von Lebensqualität bei Demenzkranken
- Wohlbefinden / Wünsche und Bedürfnisse von Menschen mit Demenz
- Selbstbestimmung
- Selbständigkeit
- Individualität
- Wohnen
- Wohn- und Versorgungssituation von Menschen mit Demenz
- Alleinlebende verwirrte Menschen
- Situation dementer Menschen und deren pflegenden Angehörigen in Privathaushalten
- Ambulante Pflege
- Kurzzeitpflege
- Tagespflegeeinrichtungen
- Stationäre Einrichtungen
- Die Entwicklung des Altenpflegeheims im 20. Jh.
- Situation dementer Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen
- Hausgemeinschaften - 4. Generation des Altenpflegeheimbaus?
- Funktionspflege vs. Bezugspflege
- Selbstbestimmung in stationären Einrichtungen
- Integrative vs. segregative Versorgungsansätze
- Pflegeversicherung und die Ungleichbehandlung Demenzkranker
- Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebensqualität bei Menschen mit Demenz
- Interventionsmethoden
- Validation
- Biografiearbeit und biografische Grundhaltung
- Reminiszenz-Therapie
- Personenzentrierter Ansatz/Pflege
- Realitäts-Orientierungs-Training
- Selbst-Erhaltungs-Therapie
- Milieutherapie
- Psychobiografisches Pflegemodell
- Basale Stimulation
- Entlastung pflegender Angehöriger
- Möglichkeiten zur Verbesserung in stationären Einrichtungen
- Empirische Untersuchung zur Lebensqualität anhand des Dementia Care Mappings
- Beschreibung der eigenen Motivation zur Durchführung der Beobachtung
- Erläuterungen zu den Einrichtungen
- Hausgemeinschaft in Wetter
- Altenpflegeheim St. Hildegard in Offenbach
- Die Methode - Das Dementia Care Mapping
- Beschreibung der Beobachtungskriterien
- Kodieren von Verhaltenskategorien
- Kodieren personaler Detraktionen
- Besonderheiten bei der Beobachtung der Verhaltenskategorien
- Auswertung der Beobachtung
- Individuelle WIB Punktzahl
- Die gruppenbezogene WIB-Punktzahl
- Individuelles WIB- Wert- Profil
- Gruppenbezogenes WIB-Wert Profil
- Individuelles Verhaltensprofil
- Gruppenbezogenes Verhaltensprofil
- Übergreifende Pflege-Kennziffern
- Personale Detraktionen
- Zusammenfassende Bewertung
- Anmerkungen zur Methode
- Fazit
- Vorschläge zur Verbesserung der Lebensqualität bei Menschen mit Demenz
- Stationäre Einrichtungen
- Häusliche Versorgung
- Politische Forderungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema der Lebensqualität von Menschen mit Demenz und analysiert die Möglichkeiten, diese im Kontext von Wohnen und Selbstbestimmung zu erhalten. Die Arbeit widmet sich den Problemen und Herausforderungen, die mit der Demenz einhergehen, und untersucht die verschiedenen Aspekte der Lebensqualität von Betroffenen, darunter die Wahrnehmung ihrer Welt, die Bewältigung von Folgen der Krankheit und die Gestaltung ihres Alltags.
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten der Lebensqualität von Menschen mit Demenz
- Die Rolle von Wohnen und Selbstbestimmung für die Lebensqualität
- Die Auswirkungen der Demenz auf das Umfeld und die sozialen Beziehungen
- Interventionsmethoden zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz
- Empirische Untersuchung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz in verschiedenen Wohneinrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Diplomarbeit ein und stellt die Relevanz der Thematik vor dem Hintergrund der steigenden Demenzrate heraus. Es erläutert die Ziele der Arbeit und den Aufbau der einzelnen Kapitel.
- Der Begriff Demenz: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Demenz, seiner historischen Entwicklung und den verschiedenen Formen der Demenz. Es werden die Symptome und Folgen der Erkrankung erläutert und die Aspekte der Demografischen Entwicklung und Prävalenz der Demenz dargestellt.
- Demenzsymptome und deren Konsequenzen für das Umfeld: Dieses Kapitel behandelt die Auswirkungen der Demenz auf das Umfeld der Betroffenen. Es werden die Perspektiven der Demenzkranken beleuchtet und die Folgen der Erkrankung für die sozialen Beziehungen und die Alltagsgestaltung diskutiert.
- Lebensqualität und Wohlbefinden bei Demenz: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen bei der Erfassung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz und stellt verschiedene Ansätze zur Beurteilung des Wohlbefindens vor. Es beleuchtet die Wünsche und Bedürfnisse von Demenzkranken und die Faktoren, die ihre Lebensqualität beeinflussen.
- Selbstbestimmung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema der Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz. Es werden die Bedeutung von Selbständigkeit und Individualität für die Lebensqualität der Betroffenen dargestellt und die Möglichkeiten zur Förderung der Selbstbestimmung in verschiedenen Lebensbereichen untersucht.
- Wohnen: Dieses Kapitel behandelt die Wohn- und Versorgungssituation von Menschen mit Demenz. Es werden die verschiedenen Wohnformen, wie z.B. das Leben in Privathaushalten, ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, sowie deren Vor- und Nachteile im Hinblick auf die Lebensqualität von Demenzkranken diskutiert.
- Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebensqualität bei Menschen mit Demenz: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Interventionsmethoden und Ansätze zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz. Es werden die Prinzipien und Methoden von Validation, Biografiearbeit, Reminiszenz-Therapie, personenzentrierter Pflege und anderen Interventionen vorgestellt.
- Empirische Untersuchung zur Lebensqualität anhand des Dementia Care Mappings: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz in zwei verschiedenen Einrichtungen, einer Hausgemeinschaft und einem Altenpflegeheim. Es werden die Methode des Dementia Care Mappings, die Beobachtungskriterien und die Ergebnisse der Auswertung dargestellt.
Schlüsselwörter
Demenz, Lebensqualität, Selbstbestimmung, Wohnen, Versorgungssituation, Interventionen, Validation, Biografiearbeit, Reminiszenz-Therapie, Personenzentrierte Pflege, Dementia Care Mapping, Empirische Untersuchung, Pflegeeinrichtungen, Hausgemeinschaft, Altenpflegeheim
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptanliegen bei der Pflege von Menschen mit Demenz?
Das Hauptanliegen ist die Erhaltung der Lebensqualität und die Förderung der Selbstbestimmung trotz kognitiver Einschränkungen.
Was versteht man unter „Dementia Care Mapping“ (DCM)?
DCM ist eine Beobachtungsmethode zur Bewertung des Wohlbefindens und der Pflegequalität von Menschen mit Demenz in institutionalisierten Settings.
Welche Interventionsmethoden verbessern die Lebensqualität?
Methoden wie Validation, Biografiearbeit, Reminiszenz-Therapie und der personenzentrierte Ansatz nach Tom Kitwood sind besonders effektiv.
Wie unterscheiden sich stationäre Hausgemeinschaften von klassischen Pflegeheimen?
Hausgemeinschaften setzen auf kleinere Gruppen, Alltagsnormalität und eine stärkere Einbeziehung der Bewohner in häusliche Tätigkeiten.
Können Menschen mit Demenz noch selbstbestimmt leben?
Ja, Selbstbestimmung ist möglich, wenn das Umfeld individuelle Wünsche respektiert und Wahlmöglichkeiten im Alltag schafft, statt über die Betroffenen zu entscheiden.
- Quote paper
- Diplom-Pädagogin Cornelia Suchan (Author), 2004, Probleme und Möglichkeiten zur Erhaltung der Lebensqualität bei Menschen mit Demenz unter dem Gesichtspunkt Wohnen und Selbstbestimmung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166134