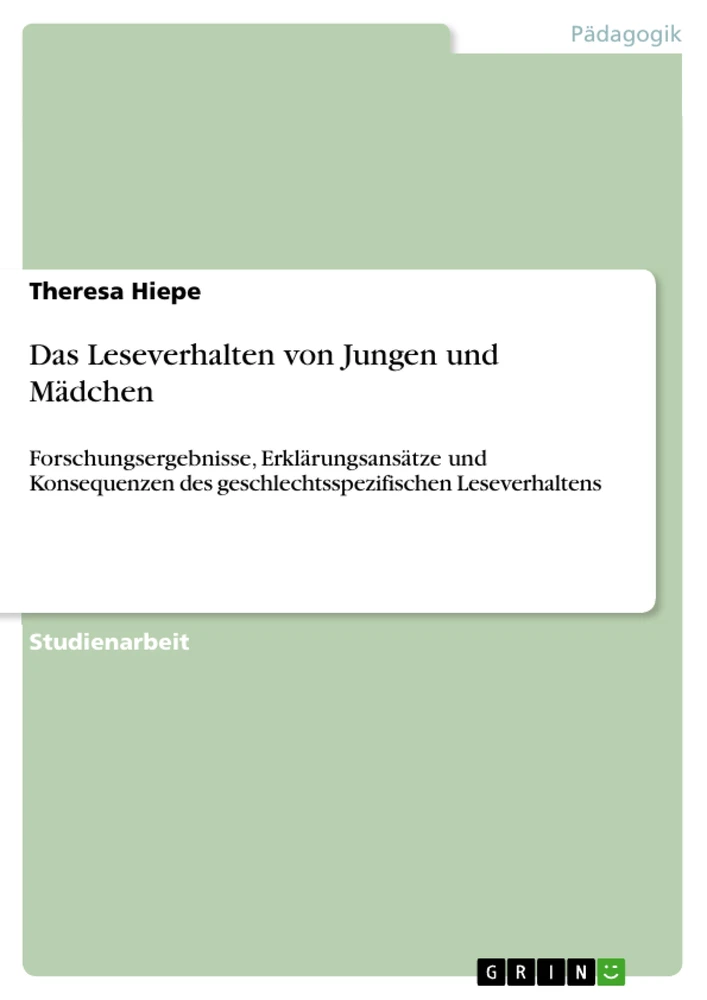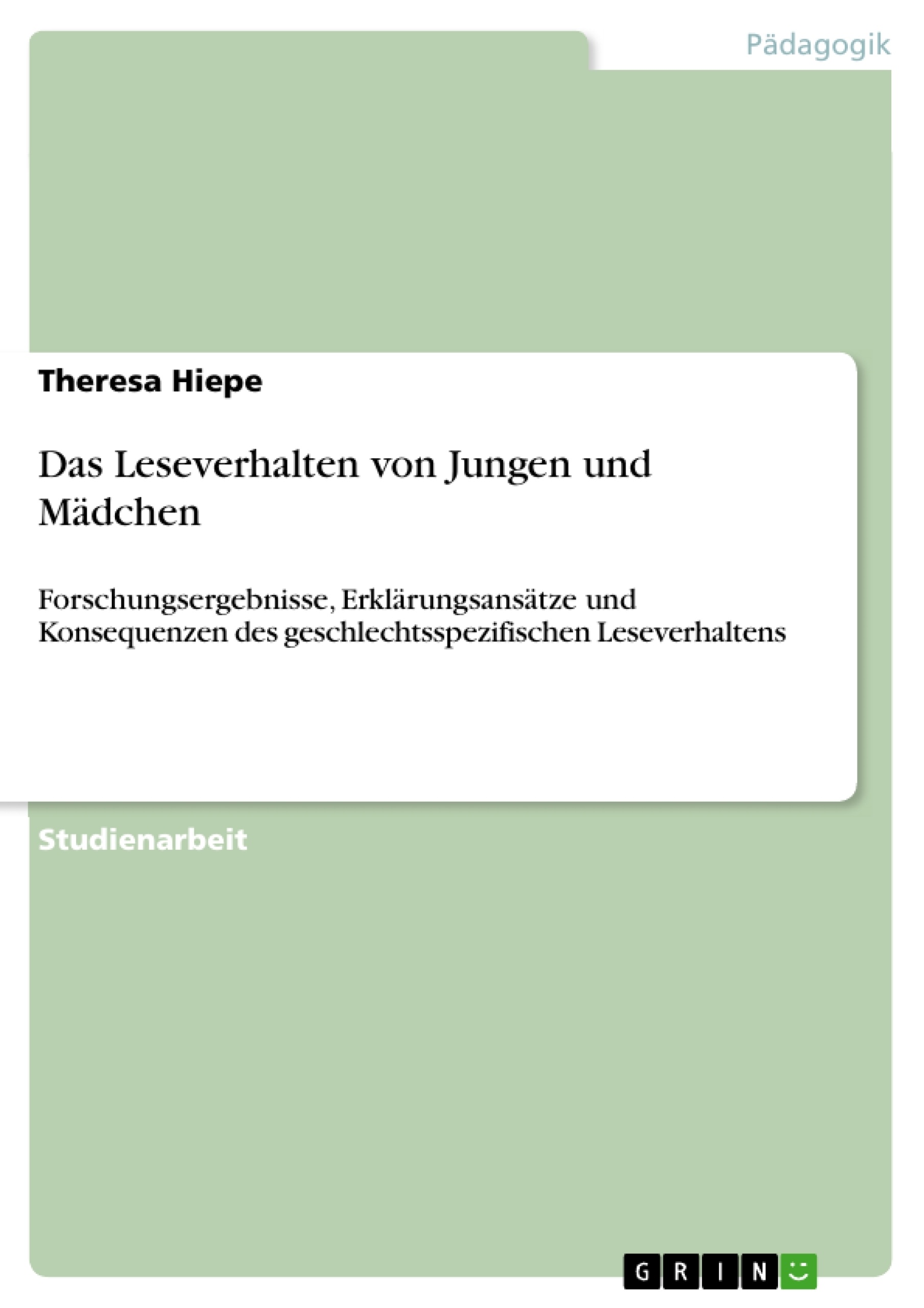Jahrzehntelang appellierten Experten aus verschiedenen Richtungen, dass Mädchen hinsichtlich ihrer naturwissenschaftlichen Fähigkeiten und Ausrichtungen gefördert werden müssten. Spätestens seit PISA besteht nun auch auf Seiten der männlichen Schüler dringender Handlungsbedarf, denn 80% der Schüler mit Lese- und Rechtschreibschwäche sind männliche Jugendliche!
Im Verlauf meiner Hausarbeit gehe ich über die Klärung von Begrifflichkeiten zunächst auf das Allgemeine Leseverhalten ein, um im Anschluss mit Hilfe von verschiedenen Studien das unterschiedliche Leseverhalten von Jungen und Mädchen darzustellen. Darauf aufbauend werde ich Theorien bzw. Erklärungsansätze vorstellen, die diese Differenzen im Leseverhalten begründen. Inwiefern der Deutschunterricht auf diese Entwicklung reagieren und das Lesen gesamtgeschlechtlich fördern kann, thematisiere ich im letzten Punkt meiner Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Leseverhalten
- Allgemeines Leseverhalten
- Forschungsergebnisse zum Leseverhaltens von Jungen und Mädchen
- Theoretische Erklärungsansätze für das geschlechtsspezifische Leseverhalten
- Konsequenzen für den Deutschunterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem unterschiedlichen Leseverhalten von Jungen und Mädchen. Zunächst werden Begrifflichkeiten geklärt und das allgemeine Leseverhalten beleuchtet. Anschließend werden verschiedene Studien betrachtet, die das Leseverhalten beider Geschlechter untersuchen und die wichtigsten Ergebnisse werden zusammengefasst. Darauf aufbauend werden verschiedene theoretische Erklärungsansätze für die Unterschiede im Leseverhalten von Jungen und Mädchen vorgestellt, insbesondere die soziologischen Ansätze, die Umweltbedingungen als den Hauptfaktor für geschlechtsspezifisches Verhalten sehen.
- Unterschiede in der Lesequalität: Mädchen bevorzugen eher fiktive Genres und realistische Geschichten, während Jungen Spannung und Action bevorzugen.
- Unterschiede in der Lesestrategie: Mädchen lesen eher empathisch und emotional involviert, während Jungen eher sachbezogen und distanziert lesen.
- Unterschiede in der Lesequantität und -häufigkeit: Mädchen lesen länger und häufiger als Jungen.
- Unterschiede in der Leseerfahrung und -motivation: Mädchen erleben das Lesen als emotionale und befriedigende Erfahrung, während Jungen eher durch Action und Spannung motiviert werden.
- Sozialisationsperspektive: Mädchen werden in der Familie, im Kindergarten und in der Schule eher mit dem Lesen vertraut gemacht, während Jungen in dieser Phase eher mit männlichen Interessen konfrontiert werden und das Lesen als weiblich wahrnehmen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach den Ursachen für das unterschiedliche Leseverhalten von Jungen und Mädchen. Das zweite Kapitel beleuchtet das allgemeine Leseverhalten und stellt verschiedene Studien vor, die empirische Daten zum geschlechtsspezifischen Leseverhalten liefern. Die Kapitel analysieren verschiedene Dimensionen des Leseverhaltens: Lesequalität, Lesestrategie, Lesequantität, Lesehäufigkeit sowie Leseerfahrung und -motivation. Das zweite Kapitel schließt mit einer Betrachtung soziologischer Erklärungsansätze für das geschlechtsspezifische Leseverhalten, die die Rolle der Sozialisation und der Umweltbedingungen hervorheben.
Schlüsselwörter
Geschlechtsspezifisches Leseverhalten, Lesequalität, Lesestrategie, Lesequantität, Lesehäufigkeit, Leseerfahrung, Lesemotivation, Sozialisation, Umweltbedingungen, Feminisierung des Lesens, Leseunlust von Jungen, Leseförderung.
Häufig gestellte Fragen
Warum besteht laut PISA-Studie Handlungsbedarf beim Leseverhalten von Jungen?
Studien zeigen, dass 80% der Schüler mit Lese- und Rechtschreibschwäche männlich sind, was einen dringenden Förderbedarf signalisiert.
Wie unterscheidet sich die Genrewahl zwischen Jungen und Mädchen?
Mädchen bevorzugen oft fiktive Genres und realistische Geschichten, während Jungen eher zu Texten mit viel Spannung, Action und Sachinformationen neigen.
Was sind die Unterschiede in der Lesestrategie?
Mädchen lesen tendenziell empathischer und emotional involvierter, während Jungen oft eine eher sachbezogene und distanzierte Lesestrategie verfolgen.
Welchen Einfluss hat die Sozialisation auf das Leseverhalten?
Soziologische Ansätze erklären Unterschiede durch Umweltbedingungen: Mädchen werden früher an das Lesen herangeführt, während Jungen Lesen oft als "weibliches" Interesse wahrnehmen.
Was wird unter der "Feminisierung des Lesens" verstanden?
Der Begriff beschreibt den Umstand, dass Lesen in Familie und Schule oft durch Frauen vermittelt wird, wodurch Jungen die Identifikation mit männlichen Lesevorbildern fehlt.
Wie kann der Deutschunterricht auf diese Unterschiede reagieren?
Durch eine gezielte Auswahl von Lektüren, die auch Jungen ansprechen (z. B. spannungsorientiert), und die Förderung geschlechtsspezifischer Lesemotivation.
- Arbeit zitieren
- Theresa Hiepe (Autor:in), 2010, Das Leseverhalten von Jungen und Mädchen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166155