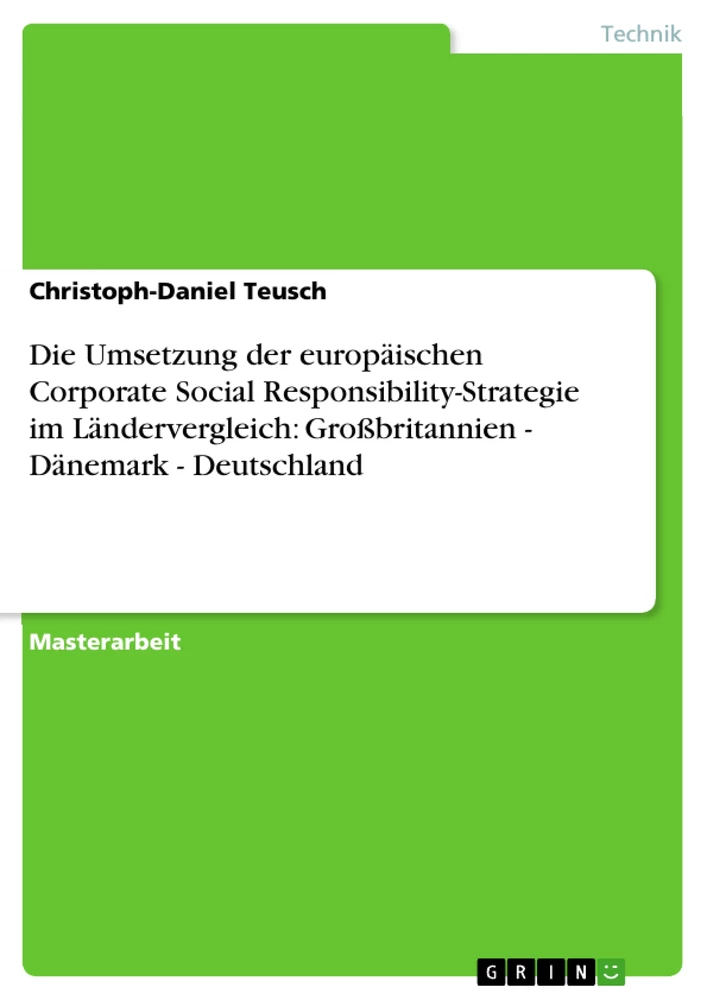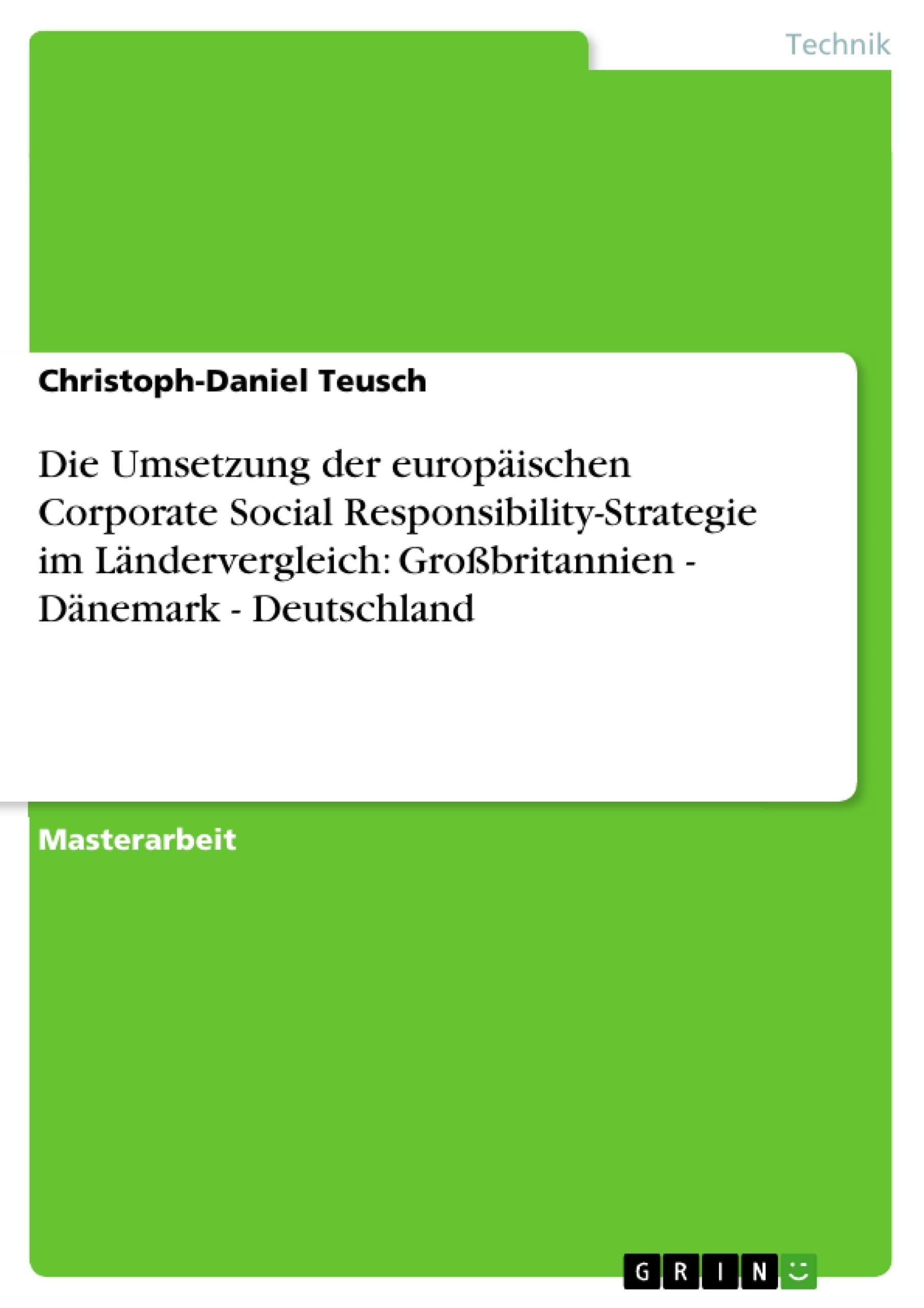„Sozial verantwortliches Handeln von Unternehmen hat eine lange Tradition in Europa. Was das heutige CSR-Verständnis von den Initiativen der Ver-gangenheit unterscheidet ist das Bemühen, CSR strategisch einzusetzen (…).“
(Europäische Kommission 2002:6)
Um ein strategisches Verständnis für Corporate Social Responsibility (CSR), der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen zu erhalten, darf der Blick nicht nur auf die Unternehmen selbst gelenkt werden.
Unternehmen sind zunehmend von den Megatrends wie Rohstoffknappheit, globalisierte Arbeitsteilung, Klimawandel, Armut und Bevölkerungsentwicklung betroffen, womit auch die Dimension der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen stark wächst. Die positive und langfristige Gestaltung der Megatrends ist nicht nur Aufgabenbereich der Unternehmen, sondern erfordert die Beteiligung sämtlicher gesellschaftlicher Akteure.
Vor allem die Politik ist gefordert, globale Bedingungen und Rahmenordnungen zu schaffen, in denen Unternehmen verantwortlich agieren können.
Dabei zeigt es sich, dass grade durch die globalisierten und somit staatenübergreifenden Wertschöpfungsprozesse von Unternehmen die politische Reichweite einzelner Nationalstaaten begrenzt ist. Es bestehen zwar eine Reihe von internationalen Abkommen und Initiativen, welche aber eine staatliche Rahmenordnung nicht ersetzen können.
Die Europäische Union (EU) hat an den weltweiten Ein- und Ausfuhren einen Anteil von 20 % und ist somit als weltgrößte Handelsmacht ein Akteur mit globalen Auswirkungen. Zusätzlich besitzt die EU geeignete Strukturen, wodurch europapolitische Entscheidungen und Initiativen staatenübergreifend in allen 27 Mitgliedsländern Relevanz erhalten.
Diese beiden Gesichtspunkte sind ausschlaggebend, um die europäische CSR-Politik näher zu betrachten und folgende Fragen aufzuwerfen.
Wie sehen die Bemühungen der Europäischen Union aus, CSR strategisch einzusetzen? Welchen Beitrag leistet die Politik um positive Rahmenbedingungen zu gestalten, in denen Unternehmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden können? Wird die europäische CSR-Strategie in den Mitgliedsstaaten einheitlich umgesetzt?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ausgangssituation
- 1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit
- 2 Das Konzept Corporate Social Responisibility (CSR)
- 2.1 CSR Neuerfindung der Unternehmensethik?
- 2.1.1 CSR eine Modeerscheinung?
- 2.1.2 Ebenen der Unternehmens- und Wirtschaftsethik
- 2.1.2.1 Ordnungsethik - Ort der Moral?
- 2.1.2.2 Unternehmensethik - die Ebene der CSR?
- 2.1.2.3 Individualethik - Verantwortung des Einzelnen
- 2.2 Babylon der Begrifflichkeiten um CSR
- 2.2.1 Begriffsursprung und Idee der CSR
- 2.2.2 Unschärfen bei der Begriffsabgrenzung
- 2.2.3 Corporate Social Responsibility (CSR)
- 2.2.4 Stakeholder Management
- 2.2.5 Corporate Citizenship (CC)
- 2.2.6 Nachhaltigkeit
- 2.3 Strategische Integration von Geschäft und Gesellschaft
- 2.3.1 Vergeudung von Potenzial
- 2.3.2 CSR entlang der Wertschöpfungskette
- 2.3.3 CSR im Wettbewerbsumfeld
- 2.3.4 Auswahl der Handlungsfelder
- 2.4 Kritische Einwände am CSR Konzept
- 2.5 Zusammenfassung
- 3 Die Europäische CSR-Strategie
- 3.1 Möglichkeiten und Grenzen der Politik im Wandel der Gesellschaft
- 3.2 Internationale Initiativen mit CSR-Bezug
- 3.3 Panorama der Europäischen Union
- 3.3.1 Idee und Grundsätze
- 3.3.2 Funktionsweise der politischen Organe
- 3.4 Meilensteine der europäischen CSR-Strategie
- 3.5 Lissabon-Strategie - Weichenstellung für CSR?
- 3.5.1 Zielsetzungen im Jahr 2000
- 3.5.2 Halbzeitprüfung 2005 - Auf dem richtigen Weg?
- 3.5.3 EU-Strategie 2020 - Weckruf durch die Krise?
- 3.6 Die Nachhaltigkeitsstrategie mit Blick auf CSR
- 3.6.1 Mitteilung 2001 zur Nachhaltigkeitsstrategie
- 3.6.2 Mitteilung 2002 zur globalen Partnerschaft
- 3.6.3 Revision der Strategie mit Abschlussmitteilung 2005
- 3.6.4 Die neue EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung 2006
- 3.6.5 1. Fortschrittsbericht 2007 und 2. Fortschrittsbericht 2009
- 3.7 Die CSR-Strategie - oder die CSR-Debatte?
- 3.7.1 Das CSR Grünbuch 2001 - Fundament der Strategie
- 3.7.2 CSR-Mitteilung 2002 - Unternehmensbeitrag zur Nachhaltigkeit
- 3.7.3 European Multistakeholder-Forum 2002-2004
- 3.7.4 CSR-Mitteilung 2006 - Europäisches Bündnis für CSR
- 3.7.5 European Multistakeholder-Forum 2009 mit Zwischenbericht 2010
- 3.7.5.1 Wirtschaft und Menschenrechte
- 3.7.5.2 Berichterstattung und Transparenz aus Sicht der Politik
- 3.8 Integrierte Produktpolitik (IPP) - Ein neues Wachstumsparadigma?
- 3.8.1 Grünbuch zur IPP 2001
- 3.8.2 Mitteilung zum Lebenszyklus-Ansatz 2003
- 3.8.3 IPP-Sitzungen und Arbeitsgruppen
- 3.9 Zusammenfassung
- 4 Umsetzung der europäischen CSR-Strategie in Mitgliedsstaaten
- 4.1 Vorgehensweise
- 4.1.1 Gegenstand des Vergleichs
- 4.1.2 Auswahl der Vergleichskriterien
- 4.2 Großbritannien (UK)
- 4.2.1 Nationale Sichtweise auf CSR
- 4.2.1.1 Gesellschaftlicher Kontext
- 4.2.1.2 Strategie und Ziele der CSR-Politik
- 4.2.2 CSR-Akteure
- 4.2.2.1 Staatliche Akteure
- 4.2.2.2 Nichtstaatliche Akteure
- 4.2.3 CSR-Instrumente
- 4.2.3.1 Gesetze und Verpflichtungen
- 4.2.3.2 Soft Laws
- 4.2.3.3 Initiativen und Zusammenarbeit
- 4.2.3.4 Bewusstseinsbildung
- 4.3 Dänemark (DK)
- 4.3.1 Nationale Sichtweise auf CSR
- 4.3.1.1 Gesellschaftlicher Kontext
- 4.3.1.2 Strategie und Ziele der CSR-Politik
- 4.3.2 CSR-Akteure
- 4.3.2.1 Staatliche Akteure
- 4.3.2.2 Nichtstaatliche Akteure
- 4.3.3 CSR-Instrumente
- 4.3.3.1 Gesetze und Verpflichtungen
- 4.3.3.2 Soft Laws
- 4.3.3.3 Initiativen und Zusammenarbeit
- 4.3.3.4 Bewusstseinsbildung
- 4.4 Deutschland (DE)
- 4.4.1 Nationale Sichtweise auf CSR
- 4.4.1.1 Gesellschaftlicher Kontext
- 4.4.1.2 Strategie und Ziele der CSR-Politik
- 4.4.2 CSR-Akteure
- Nationale CSR-Strategien und -ziele
- Rolle von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren in der CSR-Umsetzung
- CSR-Instrumente und -mechanismen
- Herausforderungen und Chancen der CSR-Umsetzung in den Vergleichsländern
- Länderübergreifende Erkenntnisse und Vergleichbarkeit von CSR-Initiativen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Umsetzung der europäischen Corporate Social Responsibility-Strategie (CSR) in einem Ländervergleich zwischen Großbritannien, Dänemark und Deutschland. Ziel ist es, die verschiedenen nationalen Ansätze und die konkrete Umsetzung von CSR-Instrumenten in den jeweiligen Ländern zu analysieren und zu vergleichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der CSR-Strategie ein und erläutert die Ausgangssituation sowie Zielsetzung und Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet das Konzept der Corporate Social Responsibility (CSR) und seine unterschiedlichen Begriffsdefinitionen. Es werden verschiedene CSR-Ebenen, -Instrumente und -Modelle vorgestellt sowie kritische Einwände zum CSR-Konzept diskutiert. Kapitel 3 analysiert die europäische CSR-Strategie, ihre Meilensteine, Initiativen und Akteure. Es werden die wichtigsten Dokumente und Entwicklungen der europäischen CSR-Politik dargestellt.
Schlüsselwörter
Corporate Social Responsibility (CSR), Nachhaltige Entwicklung, Ländervergleich, Europa, Großbritannien, Dänemark, Deutschland, Staatliche Akteure, Nichtstaatliche Akteure, CSR-Instrumente, CSR-Strategie, CSR-Politik, CSR-Initiativen, Nachhaltigkeit, Wirtschaftsethik, Unternehmensethik, Stakeholder Management, Corporate Citizenship
Häufig gestellte Fragen
Was ist Corporate Social Responsibility (CSR)?
CSR bezeichnet die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, die über gesetzliche Anforderungen hinausgeht und soziale sowie ökologische Aspekte in die Strategie einbezieht.
Wie unterscheidet sich die CSR-Umsetzung in Deutschland, Dänemark und Großbritannien?
Die Arbeit analysiert nationale Unterschiede in Bezug auf politische Rahmenbedingungen, die Rolle staatlicher Akteure und die Tradition der Unternehmensethik.
Welche Rolle spielt die EU bei der CSR-Strategie?
Die EU versucht, durch Mitteilungen und Foren (z.B. das CSR-Grünbuch) staatenübergreifende Rahmenbedingungen für verantwortungsvolles Handeln zu schaffen.
Was ist der Unterschied zwischen CSR und Corporate Citizenship?
CSR ist der umfassende Begriff für die strategische Verantwortung, während Corporate Citizenship meist das bürgerschaftliche Engagement (Sponsoring, Spenden) meint.
Ist CSR nur eine Modeerscheinung oder strategisch notwendig?
Die Arbeit argumentiert, dass CSR aufgrund von Megatrends wie Klimawandel und Ressourcenknappheit für den langfristigen Unternehmenserfolg unumgänglich ist.
- Quote paper
- M.Sc. Christoph-Daniel Teusch (Author), 2010, Die Umsetzung der europäischen Corporate Social Responsibility-Strategie im Ländervergleich: Großbritannien - Dänemark - Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166201