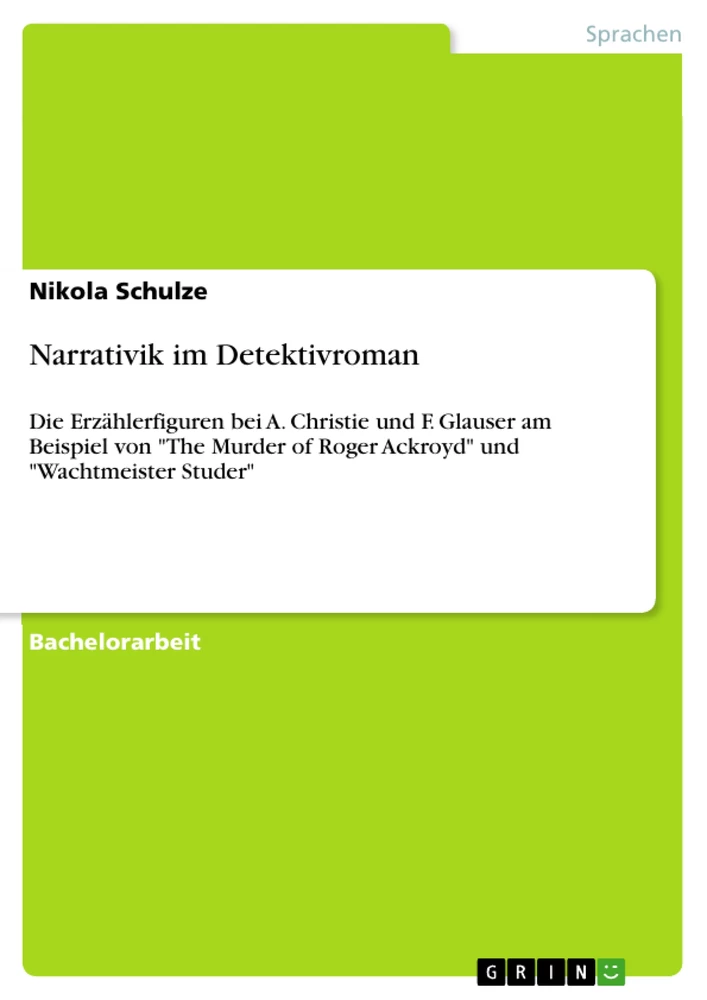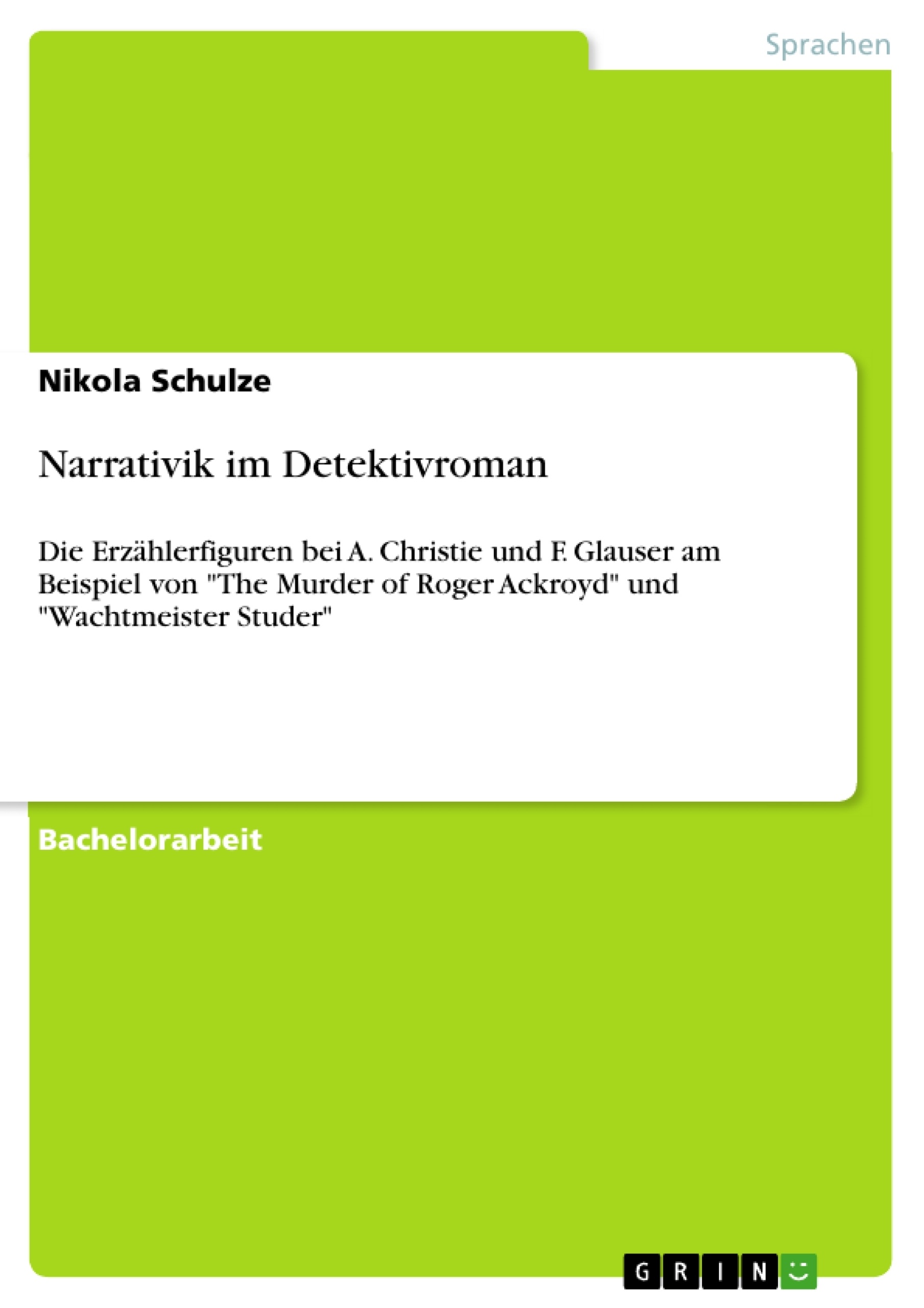„Ein Kriminalroman ist nicht eine Geschichte von Opfer, Täter, Detektiv, Verdächtigen; das sind Materialien, mit denen er arbeitet. Ein Kriminalroman entsteht einzig durch die Art und Weise, wie er erzählt wird.“
Die Kriminalliteratur wird bei vielen Literaturwissenschaftlern immer noch als niedere Gattung bezeichnet, weil sie als nicht anspruchsvoll und trivial gilt und die Bedürfnisse der Massen befriedigt. Deshalb wird dieses Genre erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit ernsthaft wissenschaftlich untersucht und auch eine einheitliche Definition des Begriffs steht noch immer aus.
In dieser Arbeit soll es darum gehen, die Erzählperspektiven zweier sehr unterschiedlicher Detektivromane gegenüberzustellen. Der bekanntere von Agatha Christie beinhaltet die am häufigsten auftretende Form des Erzählens im Detektivroman, die Perspektive der sogenannten Watson-Figur, betitelt nach dem gleichnamigen Freund und Helfer von Sherlock Holmes. Der unbekanntere von Friedrich Glauser zeigt eine ebenso vielseitige wie interessante Form des Erzählens anhand eines außerhalb des Geschehens stehenden Er-Erzählers. Ziel dieser Arbeit ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Erzählweisen herauszustellen und ihre Wirkung auf den Leser zu erörtern.
Bei der Definition des Begriffs Detektivroman halte ich mich an Peter Nusser, da dessen Ausführungen mir schlüssig erscheinen. Das bedeutet, dass ich Kriminalliteratur bzw. Kriminalroman als Oberbegriff der Gattung sehe, der die Untergattungen Detektivroman und Thriller beinhaltet. In beiden Formen des Kriminalromans kann der Protagonist ein Amateur- oder Profi-Detektiv sein, jedoch ist der Detektivroman vom Thriller insofern zu unterscheiden, als dass dort der Schwerpunkt auf der Verfolgung des meist bekannten Täters liegt und nicht auf der Lösung eines Rätsels.
Wenn im Folgenden also vom (klassischen) Detektivroman gesprochen wird, ist damit eine spezielle Art von Kriminalroman gemeint, in welchem die zentrale Gestalt ein Detektiv ist, der ein Verbrechen aufklärt. In der Forschungsliteratur wird dies auch häufig als „Whodunit“ bezeichnet.
Genauer könnte man einen Detektivroman in Aufklärungs- und Verbrechensgeschichte aufteilen. Die Aufklärungsgeschichte wird in chronologischer Reihenfolge anhand der Aktivitäten des Detektivs erzählt und die Verbrechensgeschichte in umgekehrter Reihenfolge, also retrospektiv.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die typischen Erzählerfiguren im Detektivroman
- Allgemeines
- Der auktoriale Erzähler
- Der neutrale Erzähler
- Die Watson-Figur
- Die Täter-Perspektive
- Die Detektiv-Perspektive
- Die Opfer-Perspektive
- Die Multiperspektive
- Die Erzählerfigur in The Murder of Roger Ackroyd
- Die Watson-Figur
- Die Watson-Figur als Sonderfall
- Die Wirkung dieser Perspektive
- Die Erzählerfigur in Wachtmeister Studer
- Der auktoriale Er-Erzähler
- Die Wirkung dieser Perspektive
- Der Vergleich der Erzählerfiguren
- Ich- und Er-Erzähler
- Die Wirkung der unterschiedlichen Erzählperspektiven
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Erzählperspektiven in zwei unterschiedlichen Detektivromanen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Erzählweisen herauszustellen und deren Wirkung auf den Leser zu erörtern. Dabei werden insbesondere die Unterschiede zwischen der "Watson-Figur" in Agatha Christies "The Murder of Roger Ackroyd" und dem auktorialen Er-Erzähler in Friedrich Glausers "Wachtmeister Studer" untersucht.
- Die verschiedenen Arten von Erzählerfiguren im Detektivroman
- Die Rolle der Erzählperspektive in der Gestaltung von Spannung und Rätselhaftigkeit
- Der Einfluss der Erzählperspektive auf die Leserinterpretation
- Der Vergleich von Agatha Christies und Friedrich Glausers Erzählstrategien
- Die Wirkung der unterschiedlichen Erzählperspektiven auf den Leser
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Definition des Detektivromans und stellt die beiden zu untersuchenden Werke "The Murder of Roger Ackroyd" und "Wachtmeister Studer" vor.
Das zweite Kapitel präsentiert die verschiedenen typischen Erzählerfiguren im Detektivroman, wobei besonders auf die auktoriale, neutrale und multiperspektivische Erzählsituation sowie auf die Ich-Erzählerperspektiven von Detektiv, Helfer, Täter und Opfer eingegangen wird.
Das dritte Kapitel untersucht die Erzählperspektive in "The Murder of Roger Ackroyd" und analysiert die Besonderheiten der "Watson-Figur" sowie deren Wirkung auf den Leser.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Erzählperspektive in "Wachtmeister Studer" und analysiert den auktorialen Er-Erzähler und dessen Einfluss auf die Erzählung.
Das fünfte Kapitel vergleicht die beiden untersuchten Erzählerfiguren und analysiert die Auswirkungen der unterschiedlichen Erzählperspektiven auf die Leserinterpretation.
Schlüsselwörter
Detektivroman, Erzählperspektive, "Watson-Figur", auktorialer Er-Erzähler, Agatha Christie, Friedrich Glauser, "The Murder of Roger Ackroyd", "Wachtmeister Studer", Spannung, Rätselhaftigkeit, Leserinterpretation, Vergleichende Analyse.
- Quote paper
- Nikola Schulze (Author), 2004, Narrativik im Detektivroman, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166206