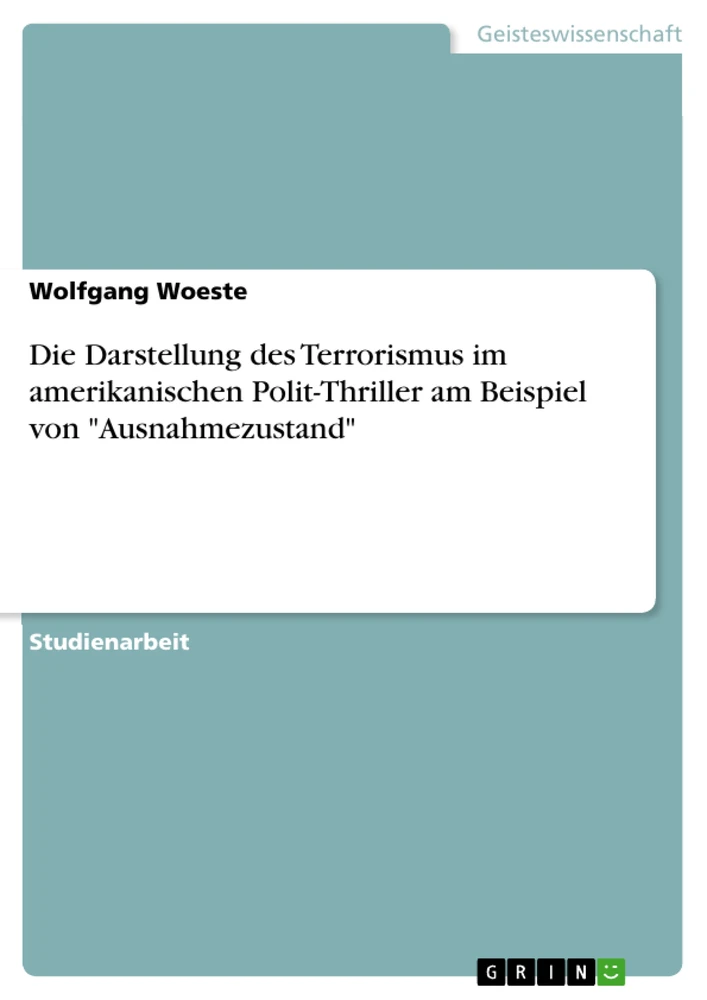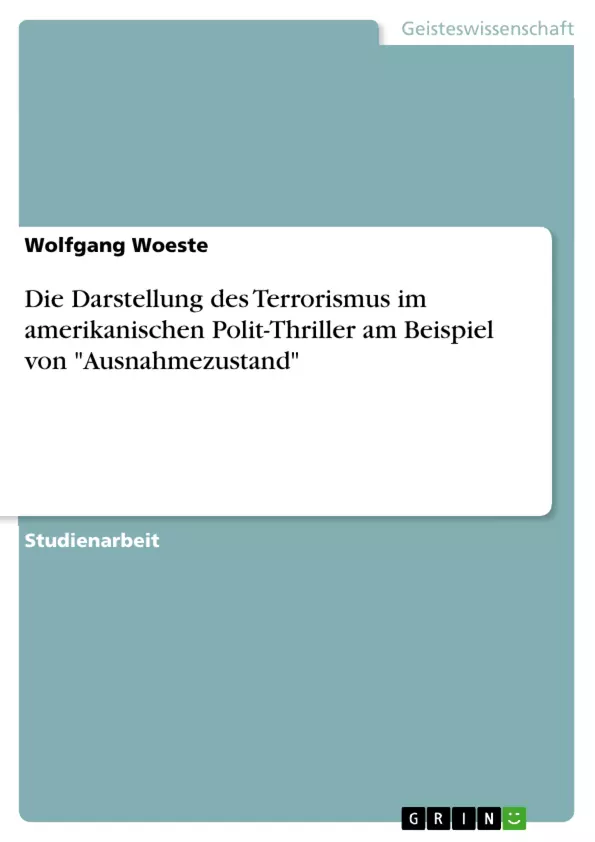Ausnahmezustand – der Titel des 1998 gedrehten Films über Terroranschläge in New York von Edward Zwick. Ausnahmezustand – Nach 9/11 ein häufig verwendeter Begriff um die Situation nach den Anschlägen zu beschreiben. Mit diesem Begriff wird die Meinung ausgedrückt, dass es nie wieder so sein wird wie vor den Anschlägen auf die symbolträchtigen Twin Towers des World Trade Centers.
Aber nicht nur die Darstellung der Anschläge im Film, sondern vor allem die Bekämpfung des Terrorismus haben mich wieder auf den Film aufmerksam werden lassen. Der Titel bezieht sich auf die Ausrufung des Ausnahmezustand durch den Präsidenten und als Folge dessen den Aufmarsch von Militär in New York zur Bekämpfung der Terroristen. Nach dem 9/11 wurde zwar kein Militär zur Terrorismusbekämpfung innerhalb der USA eingesetzt – sehr wohl aber im Ausland. Eine weitere Parallele ist in dem „Patriot Act“ zu sehen, welcher von der US-Regierung zur Terrorbekämpfung beschlossen wurde und unter anderem die systematische Verdächtigung junger Araber beinhaltet, genau wie im Film, wo ebenfalls systematisch alle jungen Araber „überprüft“ werden. Ein menschenrechtlicher Ausnahmezustand?
Aufgrund dessen untersuche ich in dieser Hausarbeit die Darstellung des Terrorismus im amerikanischen Polit-Thriller. Neben der Analyse der Darstellung der Terroristen und der Reaktion seitens des Staates (in Form von FBI, CIA und Militär) wird ein weiterer wichtiger Aspekt die Rolle der Medien im Film, vor allem des Fernsehens in der Darstellung des Films sein.
Zu Beginn werde ich die Mittel, welche ich für die Analyse des Films verwendet habe, kurz vorstellen. Diese werde ich dann an wichtigen Szenen des Films anwenden um oben genannte Aspekte genauer untersuchen zu können.
Ein kurzer Bezug zum historischen Entstehungskontext wird ebenfalls gegeben werden.
Am Ende der Analyse stehen Einsichten in die Darstellung von islamischen Terrorismus und dessen Bekämpfung im populären Hollywood Polit-Thriller. Denn auch wenn der Film bereits 9 Jahre alt ist, hat die behandelte Thematik in einer Zeit, in der Folterungen im Rahmen der Terrorismusbekämpfung geschehen und sogar die Diskussion diese zu legalisieren stattfindet, an Brisanz und Aktualität gewonnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die filmischen Analysemittel
- Montage
- Dramaturgie
- Der Ton im Spielfilm
- Der Film
- Inhaltsangabe
- Entstehungskontext
- Analyse
- Die Darstellung der Terroristen
- Terrorismusbekämpfung und Rechtsstaatlichkeitskonflikt
- Die Rolle der Medien im Film
- Die Darstellung des Terrorismus – Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Darstellung des Terrorismus im amerikanischen Polit-Thriller am Beispiel von "Ausnahmezustand". Der Fokus liegt auf der Analyse der Darstellung der Terroristen, der Reaktion des Staates und der Rolle der Medien im Film. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Darstellung von islamischem Terrorismus und dessen Bekämpfung im populären Hollywood-Kino zu gewinnen.
- Darstellung von Terrorismus und Terroristen im Film
- Reaktionen des Staates auf den Terrorismus (FBI, CIA, Militär)
- Rolle der Medien, insbesondere des Fernsehens, in der Darstellung des Terrorismus
- Zusammenspiel von Terrorismus, Staat und Medien im Film
- Bewertung der filmischen Darstellung im Kontext der realen Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Terrorismus im amerikanischen Polit-Thriller und den Film "Ausnahmezustand" ein. Kapitel 2 erläutert die filmischen Analysemittel, die in der Arbeit angewendet werden, insbesondere die Montage und Dramaturgie. Kapitel 3 gibt eine Inhaltsangabe des Films und beleuchtet den Entstehungskontext. Die Analyse in Kapitel 4 konzentriert sich auf die Darstellung der Terroristen, die Reaktion des Staates auf den Terrorismus und die Rolle der Medien im Film.
Schlüsselwörter
Terrorismus, Polit-Thriller, "Ausnahmezustand", Edward Zwick, Medien, Staat, Reaktion, Darstellung, Film, Analyse, Montage, Dramaturgie, islamischer Terrorismus, Hollywood-Kino, Rechtsstaatlichkeitskonflikt, Medienwirkung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Film "Ausnahmezustand"?
Der Film von 1998 thematisiert fiktive Terroranschläge in New York und die darauf folgende Reaktion des Staates, bis hin zur Ausrufung des militärischen Ausnahmezustands.
Welche Parallelen gibt es zwischen dem Film und den Ereignissen von 9/11?
Der Film antizipierte die Bedrohung durch islamistischen Terrorismus, die systematische Verdächtigung bestimmter Bevölkerungsgruppen und den Konflikt zwischen Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit.
Welche Rolle spielen die Medien im Film?
Die Medien, insbesondere das Fernsehen, fungieren als Multiplikatoren von Angst, prägen das Bild der Terroristen und beeinflussen die öffentliche Wahrnehmung der staatlichen Gegenmaßnahmen.
Wie werden die staatlichen Reaktionen dargestellt?
Der Film zeigt das Spannungsfeld und die Kompetenzstreitigkeiten zwischen FBI (Polizei/Ermittlung), CIA (Geheimdienst) und dem Militär (Gewaltanwendung).
Was ist der zentrale Rechtsstaatlichkeitskonflikt im Film?
Es geht um die Frage, wie weit ein demokratischer Staat bei der Terrorbekämpfung gehen darf, ohne seine eigenen Werte und Bürgerrechte (z.B. durch Folter oder Internierung) aufzugeben.
- Arbeit zitieren
- Wolfgang Woeste (Autor:in), 2007, Die Darstellung des Terrorismus im amerikanischen Polit-Thriller am Beispiel von "Ausnahmezustand", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166253