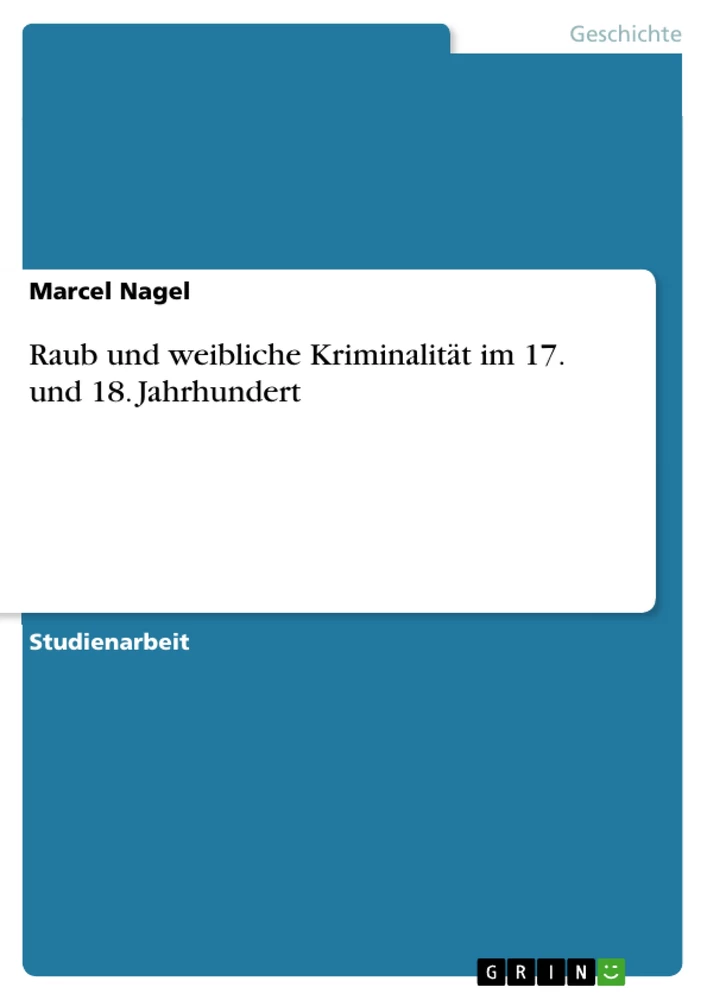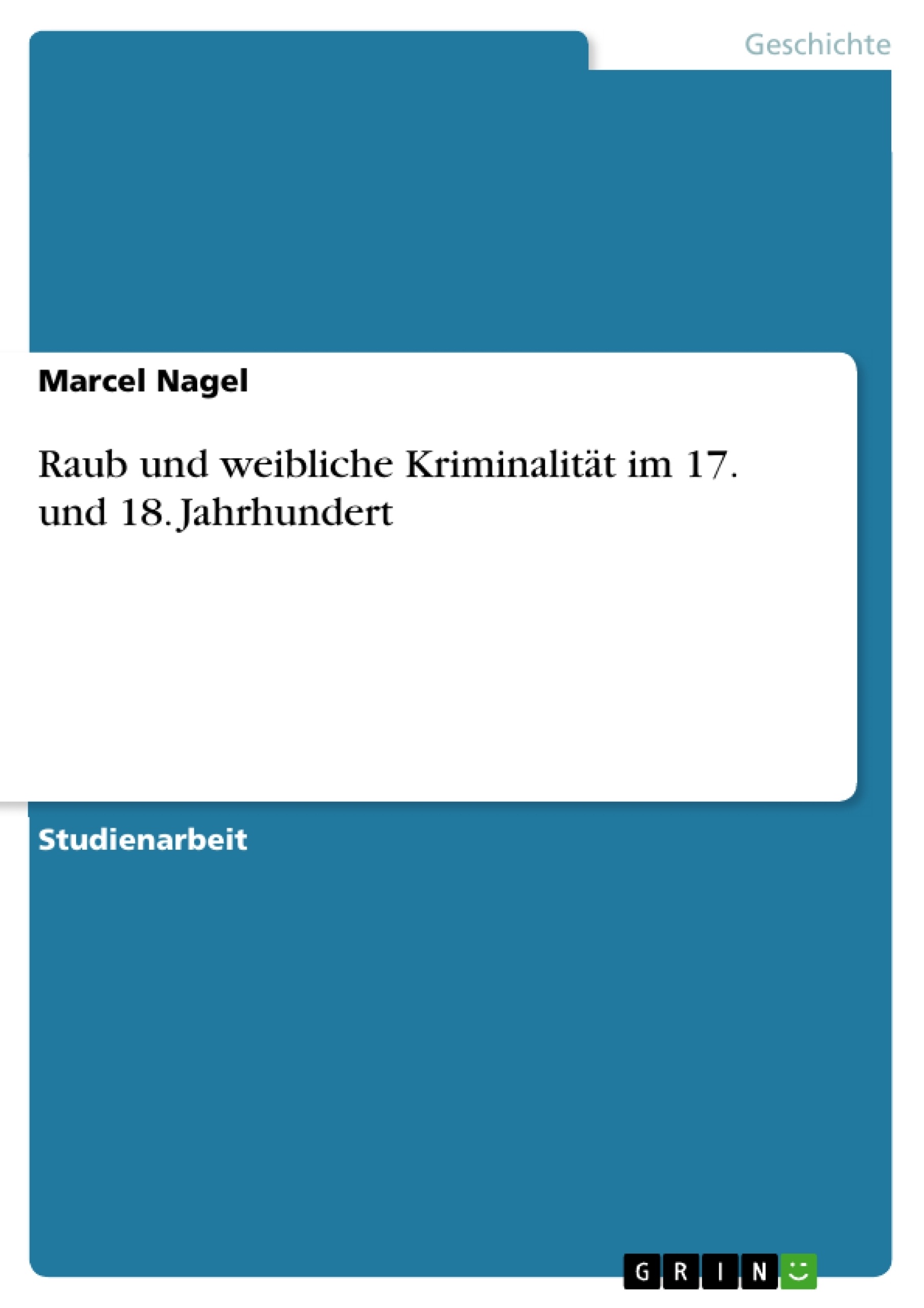Einleitung
Zunächst hauptsächlich im Rahmen der Rechtsgeschichte behandelt, bildete sich, mit Fokus auf die rechtlichen Grundlagen und die sozial- und kulturgeschichtlichen Aspekte, um das Thema der Devianz und Delinquenz von den Achtziger Jahren bis in die Neunziger Jahre ein eigenständiges Forschungsfeld der historischen Kriminalitäts- und Strafrechtsforschung aus. Im Zuge dessen erfuhren im Detail zunächst kleinere Randruppen wie Arme und Bettler, oder rechtliche Vorgänge wie die strafrechtliche Sanktionierung, das Interesse der Forschung.1 Eine geschlechtsspezifische Betrachtung von Devianz und Delinquenz in der Frühen Neuzeit wurde erst mit verstärkt aufkommendem Interesse an der Genderforschung seit Mitte der Neunziger Jahre in Angriff genommen. Anhand von Gerichtsakten und Verhörprotokollen konnten zum einen Statistiken über Vergehen und deren Verurteilung nach Geschlechtern aufgeschlüsselt erstellt werden. Zum anderen konnte aber auch anhand privater und offizieller Schriftstücke die zeitgemäße Bewertung devianten Verhaltens beider Geschlechter erarbeitet und in zumeist regionalen Studien zusammengefaßt werden.
Ebenso existieren diverse Regionalstudien zu dem Räuber- und Bandenwesen der Frühen Neuzeit, die auch besonders Bezug auf die Rolle der Frauen im kriminellen Milieu nehmen. Fallstudien über besonders herausstechende kriminelle Frauen belegen eine durchaus aktive weibliche Teilnahme im Bereich der Raub- oder Diebstahlsdelikte. Diese Regional- und Fallstudien können verständlicherweise nur der exemplarischen Darstellung der Verhältnisse dienen, von einer überregionalen Gesamtdarstellung ist die Forschung noch weit entfernt. Im Folgenden werde ich der Frage nachgehen, in welchem Maße das weibliche Geschlecht Anteil an dem Delikt des Raubs hat und es soll sich herausstellen, daß Frauen keineswegs eine Randerscheinung waren. Dabei ist eine Betrachtung des Frauenbildes jener Zeit und des sozial und rechtlich normativen Rahmens unumgänglich, denn diese bilden die Voraussetzung für die hohe Zahl krimineller Frauen. Darüber hinaus wird sich zeigen, daß die Definition von Raub und Diebstahl in den Rechtsvorschriften der Constitutio Criminalis Carolina die Annahme einer weitaus höheren Dunkelziffer delinquenter Frauen begründet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die sozialen Bedingungen als Voraussetzung für Delinquenz
- Das Problem der Definition von „Raub“ und „Diebstahl“
- Schluß
- Diebstahlsdelikte
- Frauen und Räuberbanden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle von Frauen im Räuber- und Bandenwesen der Frühen Neuzeit in Deutschland. Sie untersucht, in welchem Maße Frauen an Raubdelikten beteiligt waren und analysiert die sozialen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die zu dieser Beteiligung führten. Dabei wird die Bedeutung der sozialen Bedingungen, die Definition von Raub und Diebstahl in der Constitutio Criminalis Carolina sowie die Darstellung des Frauenbildes jener Zeit beleuchtet.
- Die Rolle von Frauen im Räuber- und Bandenwesen der Frühen Neuzeit
- Soziale und rechtliche Rahmenbedingungen für die Beteiligung von Frauen an Raubdelikten
- Die Definition von Raub und Diebstahl in der Constitutio Criminalis Carolina
- Das Frauenbild der Frühen Neuzeit
- Die Auswirkungen von Armut und Mangel auf die Kriminalität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz der Untersuchung von Devianz und Delinquenz in der Frühen Neuzeit unter verschiedenen soziokulturellen Aspekten dar. Sie beleuchtet die Entwicklung des rechtlichen Rahmens und die Reaktion des Menschen auf gesellschaftliche Normen in dieser Zeit. Die Einleitung verweist auch auf die Entstehung eines eigenständigen Forschungsfelds der historischen Kriminalitäts- und Strafrechtsforschung und die verstärkte Bedeutung der Genderforschung im Bereich der Devianz- und Delinquenzforschung.
Die sozialen Bedingungen als Voraussetzung für Delinquenz
Dieses Kapitel untersucht die soziale Komponente als Voraussetzung für Kriminalität in der Frühen Neuzeit. Es beleuchtet die Auswirkungen von Bevölkerungswachstum, Teuerungen, dem Dreißigjährigen Krieg und klimatischen Veränderungen auf die Lebensbedingungen der Bevölkerung, insbesondere der Unterschichten. Der Text verdeutlicht die schlechtere Arbeitsmarktsituation und die geringeren Einkommen von Frauen im Vergleich zu Männern, wodurch sie besonders anfällig für kriminelle Handlungen waren. Darüber hinaus wird die gesellschaftliche Ausgrenzung von Vagierenden, die sich am Rande der Gesellschaft bewegten, und deren Kriminalisierung durch die Obrigkeit analysiert.
Das Problem der Definition von „Raub“ und „Diebstahl“
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Raub und Diebstahl in der Constitutio Criminalis Carolina. Es argumentiert, dass die rechtliche Definition dieser Delikte eine höhere Dunkelziffer delinquenter Frauen begründet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Devianz und Delinquenz in der Frühen Neuzeit, insbesondere die Rolle von Frauen im Räuber- und Bandenwesen. Schlüsselwörter sind: Frauen, Kriminalität, Raub, Diebstahl, soziale Bedingungen, Vagantentum, Constitutio Criminalis Carolina, Frühe Neuzeit, Genderforschung, Devianz, Delinquenz, Dunkelziffer.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Frauen in der Kriminalität des 17. und 18. Jahrhunderts?
Frauen waren keineswegs nur eine Randerscheinung, sondern nahmen aktiv an Raub- und Diebstahlsdelikten teil, oft innerhalb von Räuberbanden.
Was war die „Constitutio Criminalis Carolina“?
Es handelt sich um eine wichtige Peinliche Gerichtsordnung, deren Definitionen von Raub und Diebstahl entscheidend für die Verfolgung krimineller Frauen waren.
Welche sozialen Faktoren führten Frauen in die Delinquenz?
Bevölkerungswachstum, die Folgen des Dreißigjährigen Krieges, Teuerungen und eine schlechtere Arbeitsmarktsituation für Frauen waren wesentliche Ursachen.
Warum gibt es eine hohe Dunkelziffer bei weiblicher Kriminalität?
Aufgrund rechtlicher Definitionen und gesellschaftlicher Normen wurden viele Vergehen von Frauen nicht statistisch erfasst oder anders bewertet.
Wann begann das Forschungsinteresse an geschlechtsspezifischer Kriminalität?
Ein verstärktes Interesse an der Genderforschung im Bereich der historischen Kriminalitätsforschung entwickelte sich erst ab Mitte der neunziger Jahre.
- Citar trabajo
- Marcel Nagel (Autor), 2009, Raub und weibliche Kriminalität im 17. und 18. Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166276