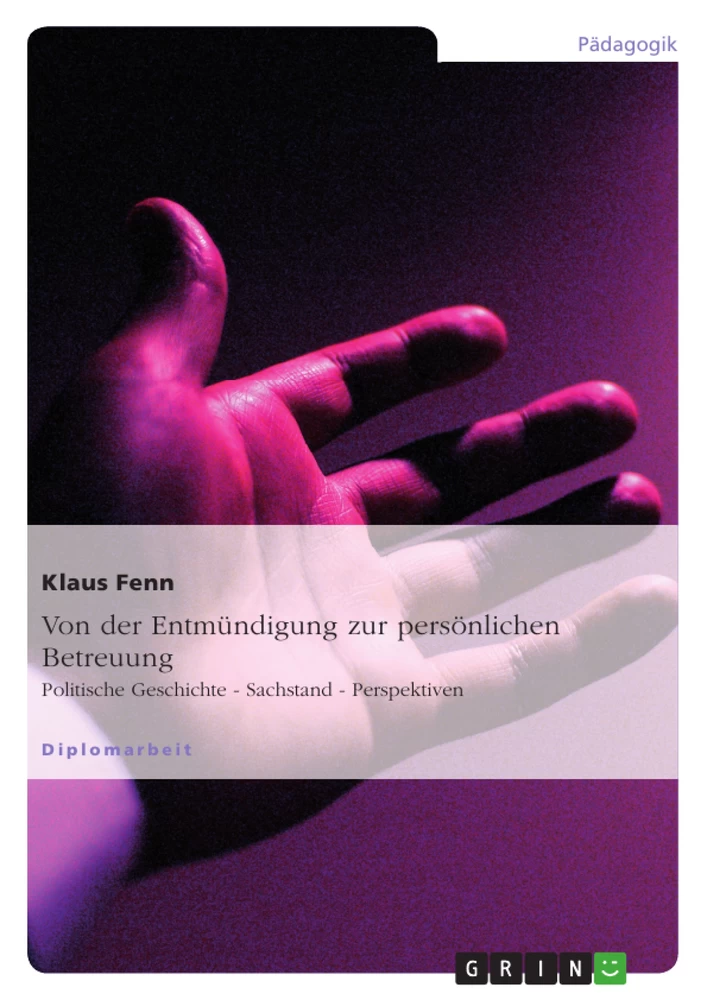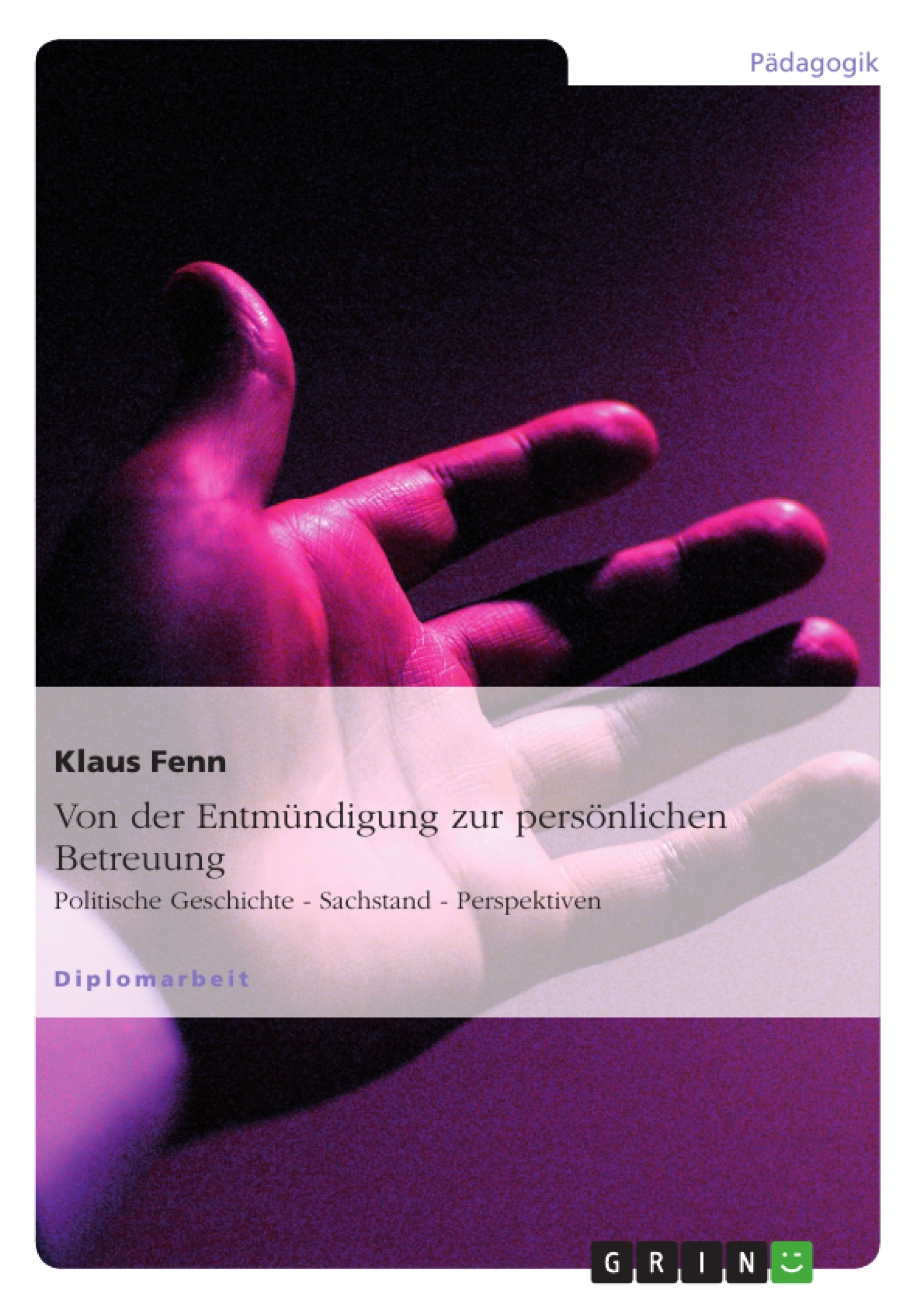Das früher geltende Entmündigungs-, Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht brachte für die betroffenen Menschen weitreichende Folgen der Entrechtung und Bevormundung mit sich. Durch Amtsvormünder/-pfleger und Berufsvormünder/-pfleger wurden die Betroffenen zudem in den meisten Fällen nur anonym verwaltet. Mit einem Sachverständigenbericht über die "Lage der Psychiatrie in Deutschland" wurde Anfang der 70er Jahre erstmals eine breite Öffentlichkeit auf diese Missstände aufmerksam. Dennoch dauerte es fast zwanzig Jahre, bis schließlich eine Reform der alten Rechtslage durchgesetzt werden konnte.
Das neue Betreuungsgesetz wurde in der Fachwelt mit einer großen Erwartungshaltung aufgenommen. Es stärkt deutlich die Rechte des Betroffenen im Verfahren und zudem wird eine Betreuung nur in den Bereichen eingerichtet, wo eine Hilfe notwendig ist. Der Betreute soll soweit wie möglich sein Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten können. Anders als zu Beginn befürchtet, konnte das Betreuungsgesetz in der Praxis gut umgesetzt werden.
Regeln für den Umgang mit hilflosen Menschen sind wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Es spricht vielen dafür, dass die zentrale Problematik dieses Rechtsgebietes, nämlich das Spannungsfeld zwischen Fürsorge und Entrechtung, genauso alt ist. Religiöse, kulturelle und soziale Wertvorstellungen, die einem ständigen Wandel unterliegen, bestimmen maßgeblich politische Entscheidungen, welche letztlich das mitmenschliche Verhalten vorschreiben. Die politische Gesellschaftsordnung bestimmt aber nicht nur die Regeln im Umgang mit kranken und hilfsbedürftigen Menschen, sondern sie definiert in entscheidendem Ausmaß auch, wer oder was als krank oder normal zu gelten hat. So gibt es noch heute viele Länder auf der Erde, in denen zahllose politisch andersdenkende Menschen in Gefängnisse oder psychiatrische Kliniken gesperrt werden. Erinnert sei auch an das finstere Kapitel des Nationalsozialismus, in dem der Gedanke des Sozialdarwinismus und der Vernichtung "lebensunwerten Lebens" zu Zwangssterilisationen und massenhafter Tötung von kranken und behinderten Menschen führte.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Politische Geschichte
- Historische Vorbemerkungen
- Altertum und Mittelalter
- Zeit der Aufklärung
- Rechtslage nach dem BGB ab dem 1.1.1900
- Vormundschaft und Entmündigung
- Gebrechlichkeitspflegschaft
- Daten zur Vormundschafts- und Pflegschaftspraxis
- Der Vormund/Pfleger
- Werdegang der Reform
- Die Psychiatrie - Enquete
- Kritik der alten Rechtslage
- Reformziele
- Vorbild Österreich
- Das Gesetzgebungsverfahren
- Übergangsvorschriften
- Sachstand
- Kernpunkte des Betreuungsrechts
- Das Verfahren zur Betreuerbestellung, dargestellt anhand eines Beispielfalles
- Vorgeschichte
- Der Antrag zur Betreuerbestellung
- Der Erforderlichkeitsgrundsatz
- Anhörung des Betroffenen
- Das Sachverständigengutachten
- Der Verfahrenspfleger
- Die Betreuungsbehörde
- Der Sozialbericht der Betreuungsstelle
- Auswahl des Betreuers
- Die Betreuerarten
- Einzelbetreuer
- Ehrenamtlicher Betreuer
- Berufsbetreuer
- Vereinsbetreuer
- Behördenbetreuer
- Institutionen als Betreuer
- Betreuungsverein
- Betreuungsbehörde (Betreuungsstelle)
- Einzelbetreuer
- Gesetzliche Vertretung durch den Betreuer
- Personensorge
- Aufenthaltsbestimmung
- Ärztliche Maßnahmen
- Sterilisation
- Unterbringung
- Wohnungsauflösung
- Vermögenssorge
- Der Einwilligungsvorbehalt
- Personensorge
- Aufsicht durch das Gericht
- Ende der Betreuung
- Betreuerwechsel
- Wegfall der Voraussetzungen
- Tod des Betreuten
- Perspektiven
- Zunahme der Betreuerbestellungen
- Finanzieller Aspekt
- Probleme in der Betreuungspraxis
- Bürokratisierung
- Vergütung für Berufsbetreuer
- Abrechnungsbestimmungen
- Mittellosigkeit
- Mangelhafte Unterstützung der Betreuungsvereine
- Zwangsmaßnahmen gegen den Betreuten
- Ausblick und Schlußbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Entwicklung des Betreuungsrechts in Deutschland, ausgehend von der historischen Entmündigung bis hin zum aktuellen Sachstand. Ziel ist es, die Reform des Betreuungsrechts zu beleuchten und zukünftige Herausforderungen zu identifizieren.
- Historische Entwicklung der Vormundschaft und Pflegschaft
- Reform des Betreuungsrechts und seine Kernpunkte
- Praxis des Betreuungsrechts und auftretende Probleme
- Finanzielle Aspekte der Betreuung
- Zukünftige Perspektiven und Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Der Autor beschreibt seine persönlichen Erfahrungen als ehrenamtlicher Betreuer, die sein Interesse an diesem Thema geweckt und zur Erstellung der Arbeit geführt haben. Die Schilderung des überraschenden und wenig strukturierten Weges zu seiner Bestellung als Betreuer unterstreicht den Bedarf an einer genaueren Betrachtung der bestehenden Strukturen und Prozesse.
Politische Geschichte: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden historischen Überblick über die Entwicklung der Fürsorge für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Es beleuchtet die Rechtslage im Altertum und Mittelalter, die Veränderungen während der Aufklärung und die entscheidenden juristischen Entwicklungen mit der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) im Jahr 1900. Der Fokus liegt auf der Analyse von Vormundschaft und Pflegschaft, inklusive der Kritikpunkte an diesem System. Die Darstellung des Reformweges und des Einflusses der Psychiatrie-Enquete ist zentral für das Verständnis der heutigen Rechtslage. Die Kapitelteile untersuchen kritische Punkte wie die Praxis der Vormundschaft und Pflegschaft, die Rolle des Vormunds/Pflegers, und den Prozess der Reform mit seinen Zielen und Herausforderungen.
Sachstand: Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Darstellung des aktuellen Betreuungsrechts in Deutschland. Es erklärt detailliert die Kernpunkte des Gesetzes und beschreibt anhand eines Beispiels das Verfahren zur Betreuerbestellung. Die verschiedenen Betreuerarten (ehrenamtlich, beruflich, institutionell) werden differenziert dargestellt, ebenso wie die Aufgaben und die rechtliche Vertretung des Betreuers (Personensorge, Vermögenssorge). Der Einwilligungsvorbehalt und die gerichtliche Aufsicht werden erläutert, zusammen mit den verschiedenen Möglichkeiten für ein Ende der Betreuung.
Perspektiven: Dieses Kapitel befasst sich mit den zukünftigen Herausforderungen des Betreuungsrechts. Es analysiert die steigende Anzahl von Betreuungsfällen und deren finanzielle Auswirkungen, hebt Probleme in der Betreuungspraxis wie Bürokratie und die Vergütung von Berufsbetreuern hervor. Ein wichtiger Aspekt ist die Diskussion um die Unterstützung der Betreuungsvereine und die Problematik von Zwangsmaßnahmen gegen Betreute. Der Ausblick gibt einen umfassenden Eindruck der Herausforderungen, die eine Weiterentwicklung und Optimierung des Systems notwendig machen.
Schlüsselwörter
Betreuungsrecht, Vormundschaft, Pflegschaft, Entmündigung, Reform, Betreuer, Ehrenamt, Berufsbetreuung, Betreuungsverein, Betreuungsbehörde, Personensorge, Vermögenssorge, Zwangsmaßnahmen, Finanzierung, Bürokratie, Perspektiven, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Entwicklung des Betreuungsrechts in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Entwicklung des Betreuungsrechts in Deutschland, von der historischen Entmündigung bis zum aktuellen Stand. Sie beleuchtet die Reform des Betreuungsrechts, analysiert die Praxis und identifiziert zukünftige Herausforderungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die historische Entwicklung der Vormundschaft und Pflegschaft, die Reform des Betreuungsrechts und seine Kernpunkte, die Praxis des Betreuungsrechts inklusive auftretender Probleme, finanzielle Aspekte der Betreuung und zukünftige Perspektiven und Herausforderungen.
Welche historischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die Rechtslage im Altertum und Mittelalter, die Veränderungen während der Aufklärung und die Entwicklungen nach Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 1900. Sie analysiert die Vormundschaft und Pflegschaft vor der Reform und die Kritikpunkte an diesem System, inklusive der Rolle des Vormunds/Pflegers.
Wie wird die Reform des Betreuungsrechts dargestellt?
Die Arbeit beschreibt den Reformweg, den Einfluss der Psychiatrie-Enquete, die Reformziele und die Herausforderungen während des Gesetzgebungsverfahrens. Sie analysiert den Übergang von Vormundschaft und Pflegschaft zur Betreuung.
Welche Aspekte des aktuellen Betreuungsrechts werden erklärt?
Die Arbeit erklärt detailliert die Kernpunkte des aktuellen Betreuungsrechts, das Verfahren zur Betreuerbestellung anhand eines Beispiels, die verschiedenen Betreuerarten (ehrenamtlich, beruflich, institutionell), die Aufgaben und die rechtliche Vertretung des Betreuers (Personensorge, Vermögenssorge), den Einwilligungsvorbehalt, die gerichtliche Aufsicht und die Möglichkeiten des Betreuungsendes.
Welche Probleme der Betreuungspraxis werden angesprochen?
Die Arbeit analysiert Probleme wie Bürokratie, die Vergütung von Berufsbetreuern und Abrechnungsbestimmungen, die finanzielle Situation von Betreuten und die Unterstützung der Betreuungsvereine. Die Problematik von Zwangsmaßnahmen gegen Betreute wird ebenfalls diskutiert.
Welche zukünftigen Herausforderungen werden identifiziert?
Die Arbeit analysiert die steigende Anzahl von Betreuungsfällen und deren finanzielle Auswirkungen, und beleuchtet die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung und Optimierung des Systems angesichts der bestehenden Herausforderungen.
Welche Arten von Betreuern werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen ehrenamtlichen, beruflichen und institutionellen Betreuern (Betreuungsvereine, Behörden). Im Detail werden Einzelbetreuer und Institutionen als Betreuer differenziert betrachtet.
Welche Aspekte der Personensorge und Vermögenssorge werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt die Aufgaben des Betreuers in Bezug auf Personensorge (Aufenthaltsbestimmung, ärztliche Maßnahmen, Sterilisation, Unterbringung, Wohnungsauflösung) und Vermögenssorge. Der Einwilligungsvorbehalt wird ebenfalls erläutert.
Wo finde ich Schlüsselwörter zum Thema?
Schlüsselwörter sind: Betreuungsrecht, Vormundschaft, Pflegschaft, Entmündigung, Reform, Betreuer, Ehrenamt, Berufsbetreuung, Betreuungsverein, Betreuungsbehörde, Personensorge, Vermögenssorge, Zwangsmaßnahmen, Finanzierung, Bürokratie, Perspektiven, Herausforderungen.
- Arbeit zitieren
- Klaus Fenn (Autor:in), 1997, Von der Entmündigung zur persönlichen Betreuung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166298