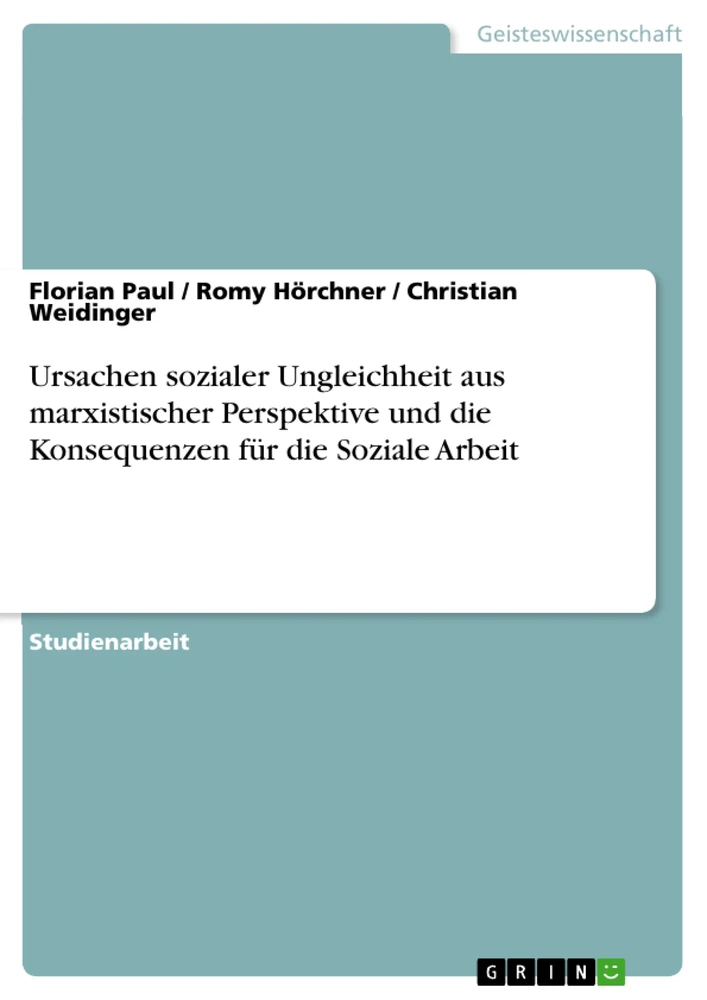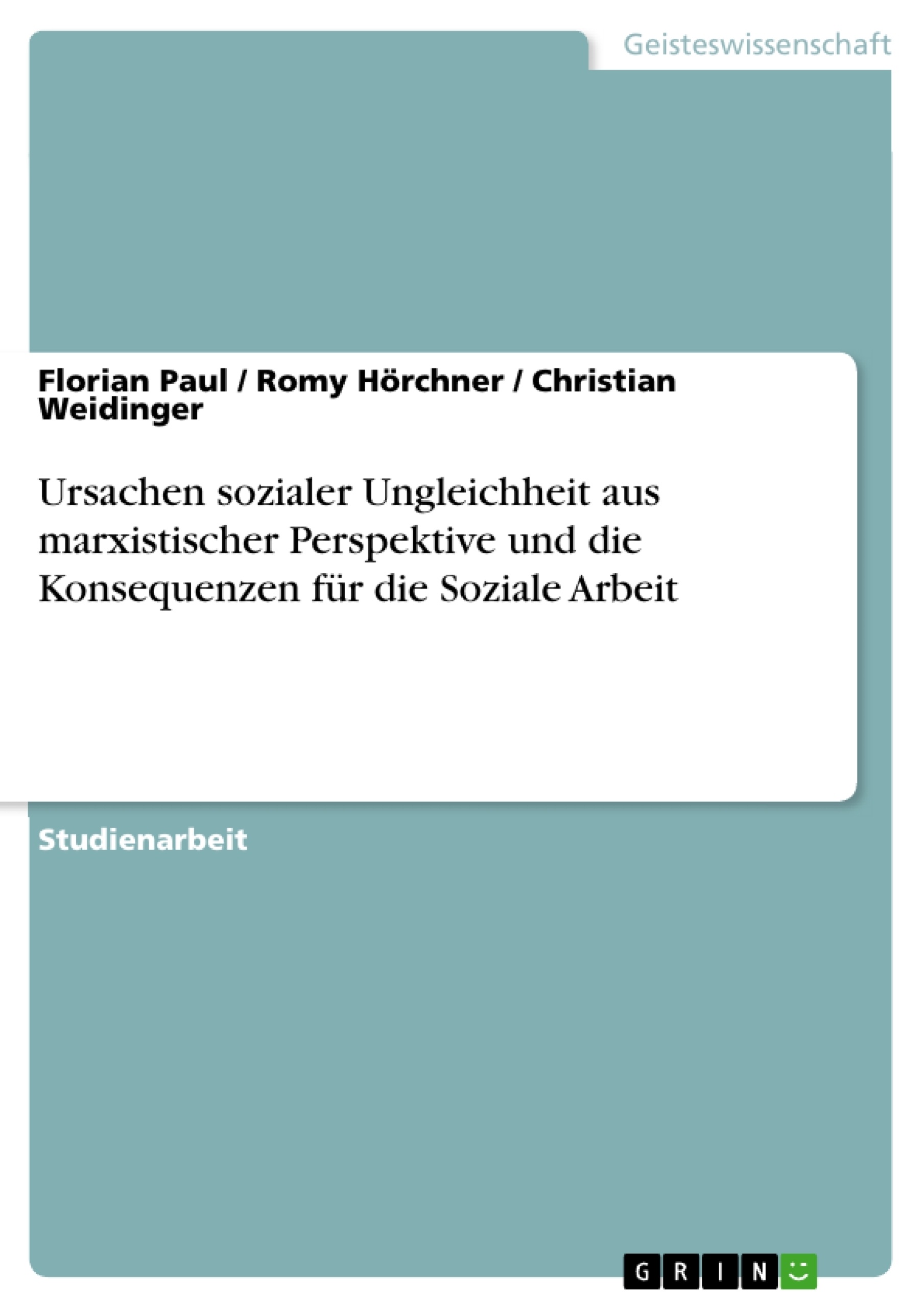Da Marxismus in Lehre, im Studium und in der alltäglichen Praxis faktisch nicht behandelt wird, haben wir uns für das Thema „Ursachen sozialer Ungleichheit aus marxistischer Perspektive und die Konsequenzen für die Soziale Arbeit“ entschieden.
Wir werden die allgemein gültige Definition der sozialen Ungleichheit, die marxistische Vorstellung und die Widersprüche darstellen. Ein weiteres Kapitel befasst sich mit der Akkumulation und Konzentration des Kapitals als zentralem Erklärungsmodell. Es wird auf den Widerspruch zwischen „Lohnarbeit und Kapital“ eingegangen und die daraus entstehenden gesellschaftlichen Folgen erklärt. Im dritten Gliederungspunkt wird ein aktueller gesellschaftlicher Lösungsansatz am Beispiel der Mindestlohndebatte erläutert und der letzte Abschnitt handelt von den Konsequenzen für die soziale Arbeit. Hierbei wird konkret auf die Kritik an dem gängigen Verständnis und der Praxis von Sozialer Arbeit und weiterhin auf die Theorie der „Sozialarbeit von unten“ eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Verantwortlichkeiten
- 0. Einleitung
- 1. Entstehung von Armut und sozialer Ungleichheit aus marxistischer Perspektive
- 1.1. Allgemeingültige Definitionen von Armut und sozialer Ungleichheit
- 1.2. Die marxistische Vorstellung von Armut und sozialer Ungleichheit
- 1.3. Darlegung der Widersprüche
- 2. Akkumulation und Konzentration des Kapitals als zentrales Erklärungsmodell für Armut und soziale Ungleichheit
- 2.1. Der Akkumulationsprozess des Kapitals
- 2.2. Das Gesetz der allgemeinen Akkumulation
- 2.3. Die gesellschaftlichen Folgen der kapitalistischen Produktionsweise
- 3. Aktuelle gesellschaftliche Lösungsversuche am Beispiel der Mindestlohndebatte
- 3.1 Definition und Geschichte des Mindestlohns
- 3.2 Mögliche Auswirkungen des Mindestlohnes
- 3.3 Was sagen Gewerkschaften und Parteien zum Thema Mindestlohn?
- 4. Konsequenzen für die Soziale Arbeit
- 4.1 Kritik an dem gängigen Praxisverständnis in der Sozialen Arbeit
- 4.2 Theorie der „Sozialarbeit von unten“ als Beispiel für marxistisch orientierte Soziale Arbeit
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Entstehung von sozialer Ungleichheit aus marxistischer Perspektive und untersucht die Konsequenzen für die Soziale Arbeit. Die Arbeit beleuchtet die Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise und deren Auswirkungen auf die Entstehung von Armut und sozialer Ungleichheit. Sie beleuchtet auch die Rolle der Akkumulation und Konzentration des Kapitals in diesem Prozess. Die Seminararbeit befasst sich mit aktuellen gesellschaftlichen Lösungsversuchen, wie der Mindestlohndebatte, und analysiert die Kritik an dem gängigen Praxisverständnis der Sozialen Arbeit. Zudem werden die Potenziale der „Sozialarbeit von unten“ als marxistisch orientierte Praxisform untersucht.
- Die Entstehung sozialer Ungleichheit aus marxistischer Perspektive
- Die Rolle der Akkumulation und Konzentration des Kapitals
- Aktuelle gesellschaftliche Lösungsversuche (z.B. Mindestlohn)
- Kritik an der gängigen Praxis in der Sozialen Arbeit
- Das Potenzial der „Sozialarbeit von unten“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erklärt den Marxismus als Ausgangspunkt der Analyse. Kapitel 1 beleuchtet die Definition von Armut und sozialer Ungleichheit aus marxistischer Perspektive und zeigt die Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise auf. Kapitel 2 untersucht die Akkumulation und Konzentration des Kapitals als zentrales Erklärungsmodell für Armut und soziale Ungleichheit. Dabei werden die gesellschaftlichen Folgen der kapitalistischen Produktionsweise erläutert. Kapitel 3 befasst sich mit aktuellen gesellschaftlichen Lösungsversuchen, insbesondere der Mindestlohndebatte, und analysiert deren Auswirkungen. Schließlich widmet sich Kapitel 4 den Konsequenzen für die Soziale Arbeit, wobei die Kritik am gängigen Praxisverständnis und die Theorie der „Sozialarbeit von unten“ im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen soziale Ungleichheit, Armut, Kapitalismus, Akkumulation, Konzentration des Kapitals, Mindestlohn, Soziale Arbeit, Praxisverständnis, „Sozialarbeit von unten“. Der Fokus liegt auf der kritischen Analyse der kapitalistischen Produktionsweise, ihren Auswirkungen auf soziale Ungleichheit und Armut sowie den daraus resultierenden Herausforderungen für die Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie erklärt der Marxismus soziale Ungleichheit?
Soziale Ungleichheit wird als zwangsläufige Folge des Widerspruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital gesehen, bei dem die Akkumulation von Reichtum bei wenigen zur Verarmung der Massen führt.
Was bedeutet „Akkumulation des Kapitals“?
Es beschreibt den Prozess, in dem Kapitalisten Gewinne reinvestieren, um noch mehr Kapital anzuhäufen, was zu einer Konzentration der Produktionsmittel führt.
Was ist „Sozialarbeit von unten“?
Dies ist ein marxistisch orientierter Ansatz der Sozialen Arbeit, der sich nicht nur als Reparaturbetrieb des Systems versteht, sondern gemeinsam mit den Betroffenen gegen die strukturellen Ursachen von Armut kämpft.
Wie wird die Mindestlohndebatte aus marxistischer Sicht bewertet?
Ein Mindestlohn wird oft als notwendiger Lösungsversuch innerhalb des Systems gesehen, der jedoch den grundlegenden Widerspruch der kapitalistischen Ausbeutung nicht auflösen kann.
Warum wird Marxismus in der heutigen Sozialen Arbeit kritisiert?
Kritiker bemängeln oft das gängige Praxisverständnis, das soziale Probleme individualisiert, anstatt sie als Resultat ökonomischer Machtverhältnisse zu begreifen.
- Quote paper
- Florian Paul (Author), Romy Hörchner (Author), Christian Weidinger (Author), 2011, Ursachen sozialer Ungleichheit aus marxistischer Perspektive und die Konsequenzen für die Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166373