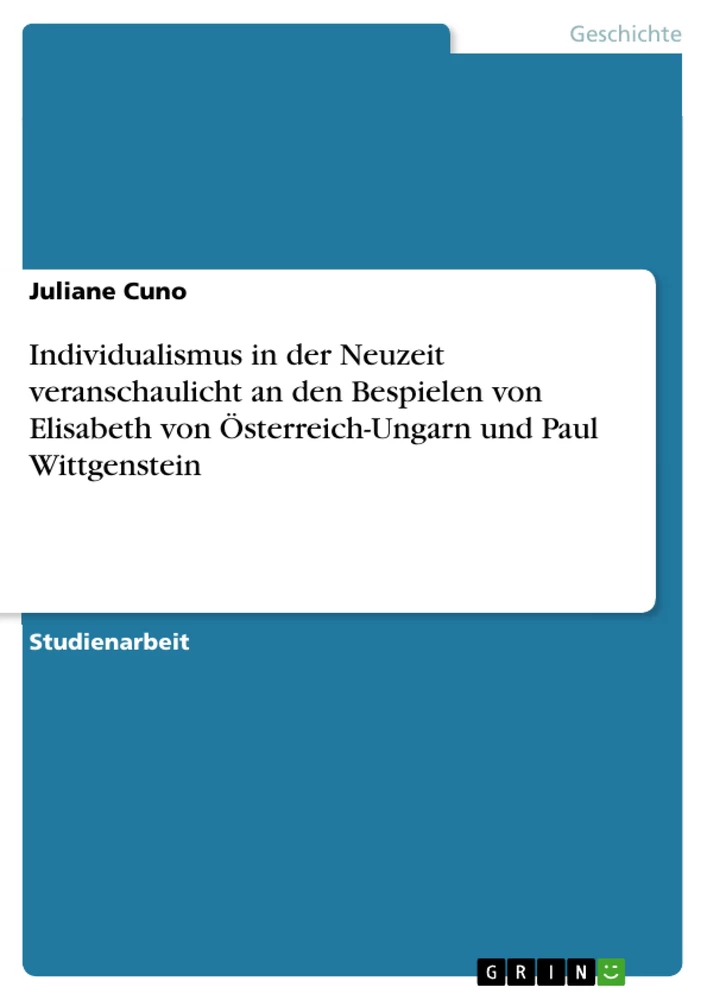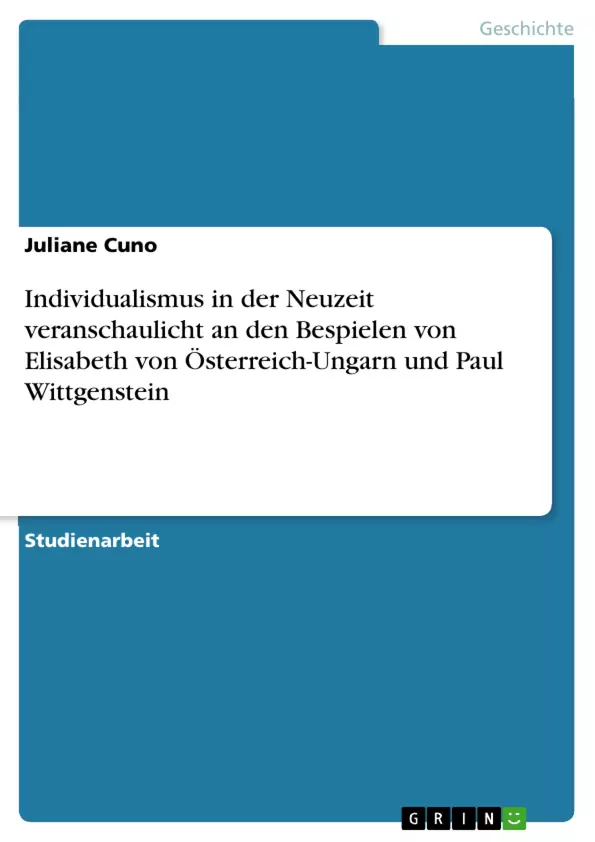In dem folgenden Abriss soll dargelegt werden, dass es einen absoluten
Normallebenslauf in den oberen Schichten der Wiener Gesellchaft bereits in den
Anfängen der Individualisierung nicht gegeben hat und individuelle Lebensläufe
bereits im 19. Jahrhundert vorhanden waren. Gerade in der Neuzeit1 gab es feste
Werte und Normen, die allgemeine Gültigkeit erlangten. So kommt es zu einer
eindeutigen Ausprägung von Geschlechterrollen – die Frau ist für die Kinder da.
Auch wenn bereits mit der Französischen Revolution Frauen für ihre Rechte und
Gleichstellung eintraten2, blieb dies meistens jedoch gerade im Alltag meist nicht
umgesetzt.
Frauen brachen jedoch immer mehr aus der typischen Rollenverteilung aus und
die im 19. Jahrhundert aufkommenden Frauenbewegung trug gewiss eine Teil
dazu bei. Die politischen Veränderungen wie die Industrielle Revolution halfen,
jedoch blieb die Debatte um diese Themen meist auf Randbereiche beschränkt.3
Auch in der Frauenbewegung zeigt sich, dass es sich vor allem um ein Phänomen
der Oberschichten handelt, in denen solche Themen diskutiert wurden. Gerade in
den Salons Europas und somit auch in der Wiener Oberschicht kamen die Fragen
zu Gleichheit von Mann und Frau auf.4
Aber auch die jungen Männer hatten es in der Wiener Gesellschaft nicht leicht.
Wien war gegenüber Neuerungen eine eher schwierige Stadt. Stefan Zweig
beschrieb die Stadt als konservativ und sehr im alten Kaiserreich verwurzelt.5 Im
Normalfall gingen die Söhne dem Beruf des Vaters nach und waren somit auch für
die Zukunft abgesichert.
Viele brachen aber aus diesem Bild aus und gingen ihren eigenen Weg. Zwei
Beispiele werden in dieser Arbeit aufgegriffen. So ist Elisabeth von Österreich
ihren eigenen Weg gegangen und Paul Wittgenstein entschied sich für ein Leben
als Konzertpianist, entgegen dem Willen seiner Familie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Elisabeth von Österreich-Ungarn
- I. Ein Leben mit stetiger Todessehnsucht
- II. Unglück einer Kaiserin
- Paul Wittgenstein
- 1. Leben in einer eher ungewöhnlichen Familie
- II. Einarmiger Pianist und Jude
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob es in der Wiener Gesellschaft des 19. Jahrhunderts einen festen „Normallebenslauf“ gab, oder ob bereits im frühen Stadium der Individualisierung individuelle Lebenswege existierten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Zeit von 1800 bis 1930, ein Zeitraum, der durch die Herausbildung fester Werte und Normen sowie durch die Debatte um Geschlechterrollen geprägt war.
- Die Rolle von Frauen und die Herausforderungen der traditionellen Geschlechterrollen
- Die Auswirkungen der Französischen und der Industriellen Revolution auf die gesellschaftliche Entwicklung
- Das Aufkommen der Frauenbewegung und die Diskussion um Gleichheit in den Oberschichten
- Die Herausforderungen, denen junge Männer in der Wiener Gesellschaft begegneten
- Individuelle Lebensläufe und die Abkehr von traditionellen Normen
Zusammenfassung der Kapitel
Elisabeth von Österreich-Ungarn
Das Kapitel beleuchtet das Leben von Kaiserin Elisabeth, bekannt als „Sissi“, und zeichnet ein Bild von ihrer Persönlichkeit, ihren Erfahrungen und ihrer Rolle im österreichischen Kaiserreich. Es geht auf die Verklärung ihres Lebens durch die Medien ein und analysiert die Faktoren, die zu diesem Mythos geführt haben.
Ein Leben in stetiger Todessehnsucht
Dieses Kapitel beschreibt Elisabeths Kindheit, Jugend und die ersten Schicksalsschläge, die ihr Leben prägten. Es beleuchtet die Bedeutung ihres frühen Schwarm Richard und den Beginn ihrer Depressionen, die sie ihr Leben lang begleiten werden. Die Verlobung und die Hochzeit mit Kaiser Franz Josef I. werden dargestellt, sowie die Herausforderungen, denen Elisabeth als Kaiserin gegenüberstand.
Paul Wittgenstein
Dieses Kapitel beleuchtet das Leben des Musikers Paul Wittgenstein, der sich trotz der Widrigkeiten seines Lebens für eine Karriere als Konzertpianist entschied.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte dieser Arbeit sind: Individualismus, Neuzeit, Wiener Gesellschaft, Geschlechterrollen, Frauenbewegung, traditionelle Normen, individuelle Lebensläufe, Elisabeth von Österreich, Paul Wittgenstein, Familie, Kunst, Musik, Depression.
Häufig gestellte Fragen
Gab es im 19. Jahrhundert bereits Individualismus?
Ja, die Arbeit zeigt anhand von Beispielen, dass es bereits damals individuelle Lebensläufe abseits der festen gesellschaftlichen Normen gab.
Wie brach Kaiserin Elisabeth aus ihrer Rolle aus?
Elisabeth von Österreich-Ungarn ging eigene Wege, die oft im Widerspruch zu den strengen Erwartungen des Wiener Hofes standen.
Wer war Paul Wittgenstein?
Paul Wittgenstein war ein Konzertpianist, der trotz des Verlusts seines rechten Arms und gegen den Willen seiner Familie seine Karriere fortsetzte.
Welche Rolle spielten die Salons in der Wiener Oberschicht?
In den Salons wurden moderne Fragen zur Gleichheit von Mann und Frau sowie neue gesellschaftliche Werte diskutiert.
Welche Auswirkungen hatte die Industrielle Revolution auf Lebensläufe?
Sie förderte politische Veränderungen und ermöglichte neue berufliche Wege, auch wenn viele Strukturen konservativ blieben.
- Quote paper
- Juliane Cuno (Author), 2010, Individualismus in der Neuzeit veranschaulicht an den Bespielen von Elisabeth von Österreich-Ungarn und Paul Wittgenstein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166394