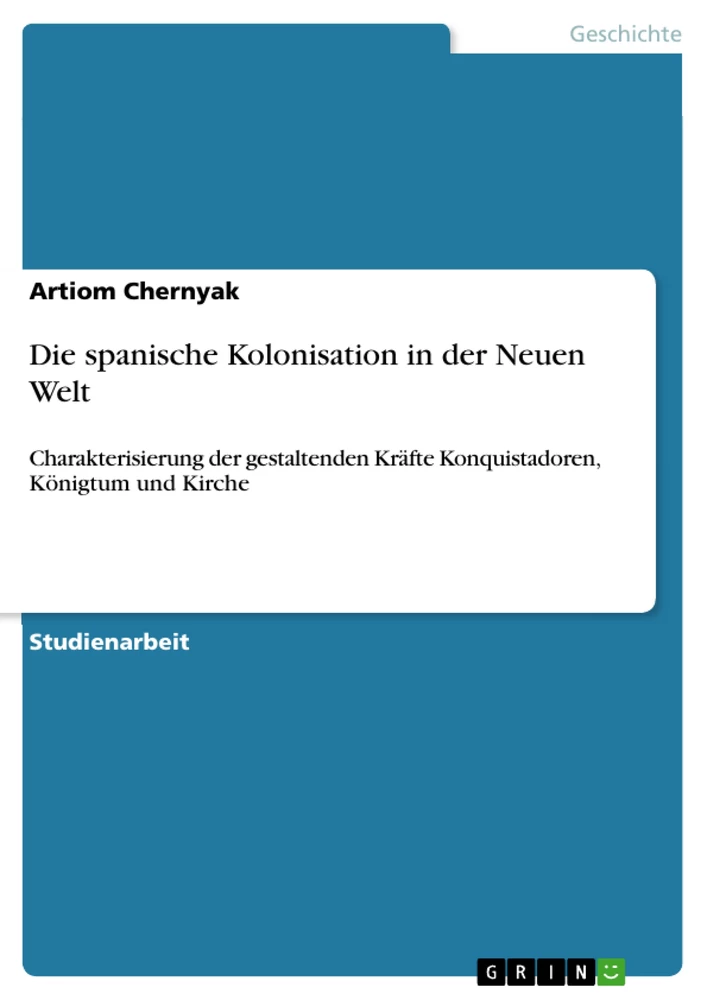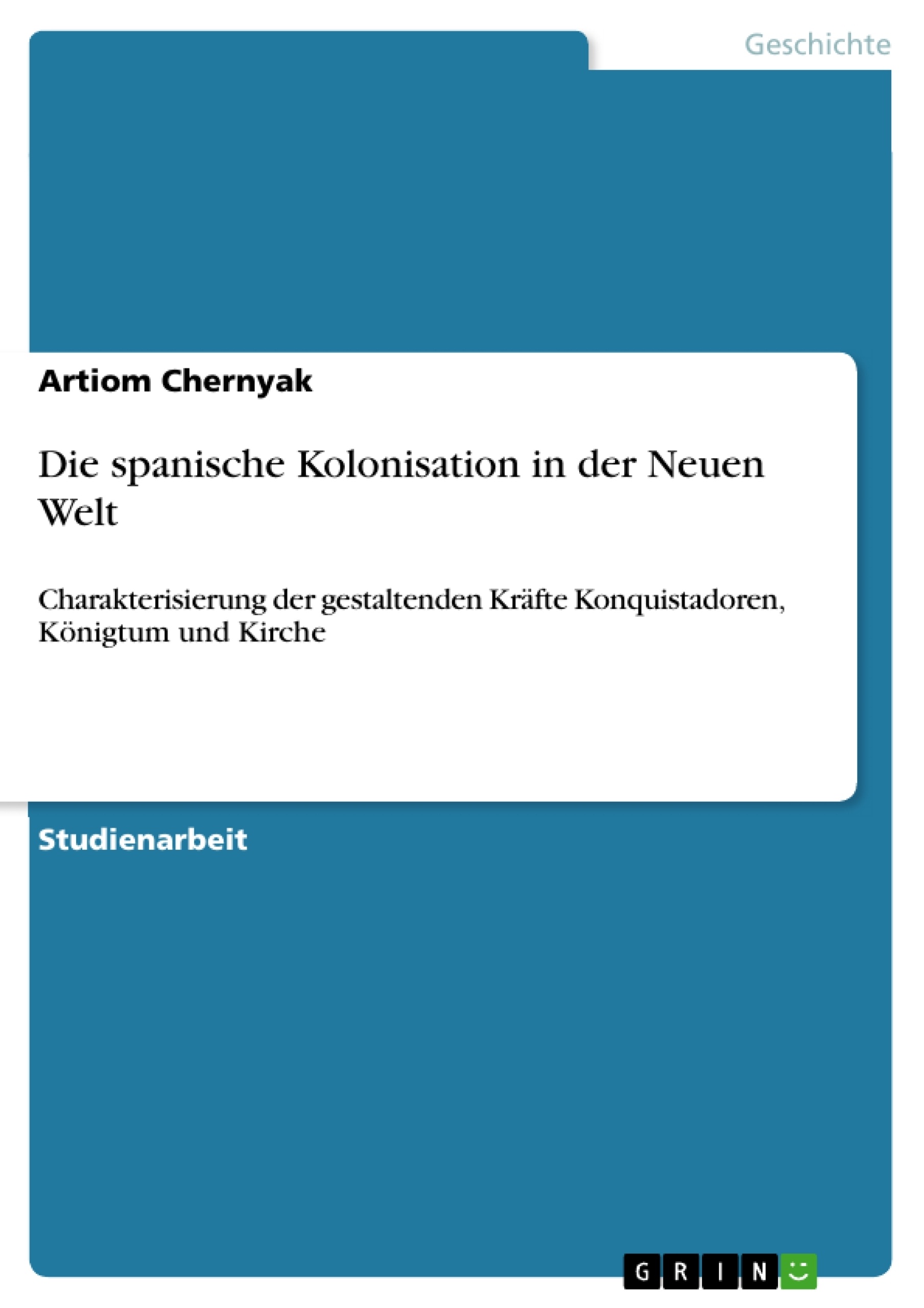Bis zum des Ende 16. Jahrhunderts hatten die Portugiesen in Afrika und Asien und die Spanier in Mittel- und Südamerika Kolonialreiche von gewaltiger räumlicher Ausdehnung geschaffen. Als 1580 der spanische König Philipp II., Sohn Karls V. Und Isabellas von Portugal, auch die portugiesische Krone übernahm und damit die beiden iberischen länder samt ihrer überseeischen Besitztümer vereinte, war das erste weltumspannende Imperium der Geschichte entstanden. Die spanische Krone wollte die Leitlinien der Kolonialpolitik bestimmen und den ökonomischen Nutzen aus den Überseeunternehmungen für sich monopolisieren. Oft fehlte es jedoch an militärischen und finanziellen Mitteln um das Monopol durchzusetzen und weitere Gebietseroberungen zu gewährleisten. In solchen Fällen bediente sich die Krone privater Investoren und Unternehmer, an die sie Lizenzen vertrieb um Eroberungen voranzutreiben und Handelsgeschäfte zu organisieren. Überwiegend Kleinadelige, die sich in der spanischen Reconquista verdient gemacht haben, machten sich, aufgrund verlockender Versprechungen bezüglich sagenhaften Reichtums, auf den Weg in die Neue Welt, wo sie die bestehenden Machtstrukturen, der Inkas und Azteken, zerschlugen. Dieses Bestreben der spanischen Krone, dort Monopole zu errichten, rechtfertigt es, den beschriebenen Sachverhalt zu einem Charakteristikum der Epoche zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Kolonialismus und Imperialismus
- Amerika vor der Kolonisation
- Geschichtlicher Abriss der vorausgegangenen spanischen Geschichte
- Grundlegende Umstände der spanischen Kolonisation
- Konquistadoren
- Königtum
- Religion und Kirche
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den treibenden Kräften hinter der spanischen Kolonisation Amerikas. Sie konzentriert sich auf die Rolle der Konquistadoren, des Königtums und der Kirche und untersucht deren Motive und Einfluss auf die Gestaltung der kolonialen Gesellschaft.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Kolonialismus und Imperialismus
- Die Situation Amerikas vor der europäischen Kolonisation
- Die Rolle der Konquistadoren in der Eroberung und Ausbeutung Amerikas
- Die Einflussnahme des spanischen Königtums auf die Kolonialpolitik
- Der Einfluss der Kirche und des christlichen Glaubens auf die Kolonisation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen kurzen Überblick über das Thema der spanischen Kolonisation in der Neuen Welt und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor: welche Triebkräfte waren maßgeblich an der Kolonisation Amerikas beteiligt? Anschließend wird die Definition und Abgrenzung der Begriffe Kolonialismus und Imperialismus geklärt, um eine Grundlage für die weitere Analyse zu schaffen.
Das Kapitel über Amerika vor der Kolonisation beschreibt die bestehenden Machtstrukturen und Lebensverhältnisse der indigenen Bevölkerung. Es liefert einen Kontext für die spätere Ankunft der Europäer.
Der geschichtliche Abriss der vorausgegangenen spanischen Geschichte gibt Einblicke in die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, die die spanische Kolonialpolitik beeinflussten.
Das Kapitel über die grundlegenden Umstände der spanischen Kolonisation beleuchtet die Motive und Methoden der spanischen Eroberung und Besiedlung Amerikas. Es untersucht die Rolle der Konquistadoren, des Königtums und der Kirche.
Das Kapitel über die Konquistadoren untersucht ihre Rolle in der Eroberung und Ausbeutung Amerikas, ihre Motive und ihre Beziehungen zum spanischen Königtum.
Das Kapitel über das Königtum analysiert die Rolle der spanischen Krone in der Kolonialpolitik, die Gesetze und Verordnungen, die sie erließ, und ihre wirtschaftlichen Interessen in der Neuen Welt.
Das Kapitel über Religion und Kirche untersucht die Rolle der Kirche in der Kolonisation, ihre Missionsarbeit, ihren Einfluss auf die indigene Bevölkerung und ihre Beziehung zum Königtum.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Kolonialismus, Imperialismus, Spanische Kolonisation, Konquistadoren, Königtum, Kirche, Missionsarbeit, indigene Bevölkerung, Neue Welt, Amerika.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Hauptmotive der spanischen Kolonisation Amerikas?
Die Hauptmotive waren wirtschaftlicher Nutzen (Gold, Reichtum), die Errichtung von Monopolen durch die Krone und die christliche Missionierung.
Wer waren die Konquistadoren?
Es waren überwiegend Kleinadelige, die durch Eroberungen in der Neuen Welt Reichtum suchten und die Machtstrukturen der Inkas und Azteken zerschlugen.
Welche Rolle spielte die spanische Krone bei der Eroberung?
Die Krone vergab Lizenzen an private Investoren, da ihr oft die eigenen Mittel fehlten, um das weltumspannende Imperium direkt zu finanzieren.
Wie wirkte sich die Kirche auf die Kolonisation aus?
Die Kirche war für die Missionsarbeit zuständig und legitimierte die Eroberung religiös, stand aber oft in einem komplexen Verhältnis zur Krone und den Konquistadoren.
Was unterschied Kolonialismus von Imperialismus in diesem Kontext?
Die Arbeit klärt diese Begriffe, wobei die Errichtung des ersten weltumspannenden Imperiums unter Philipp II. als charakteristisch für die Epoche gilt.
- Quote paper
- Artiom Chernyak (Author), 2010, Die spanische Kolonisation in der Neuen Welt , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166472