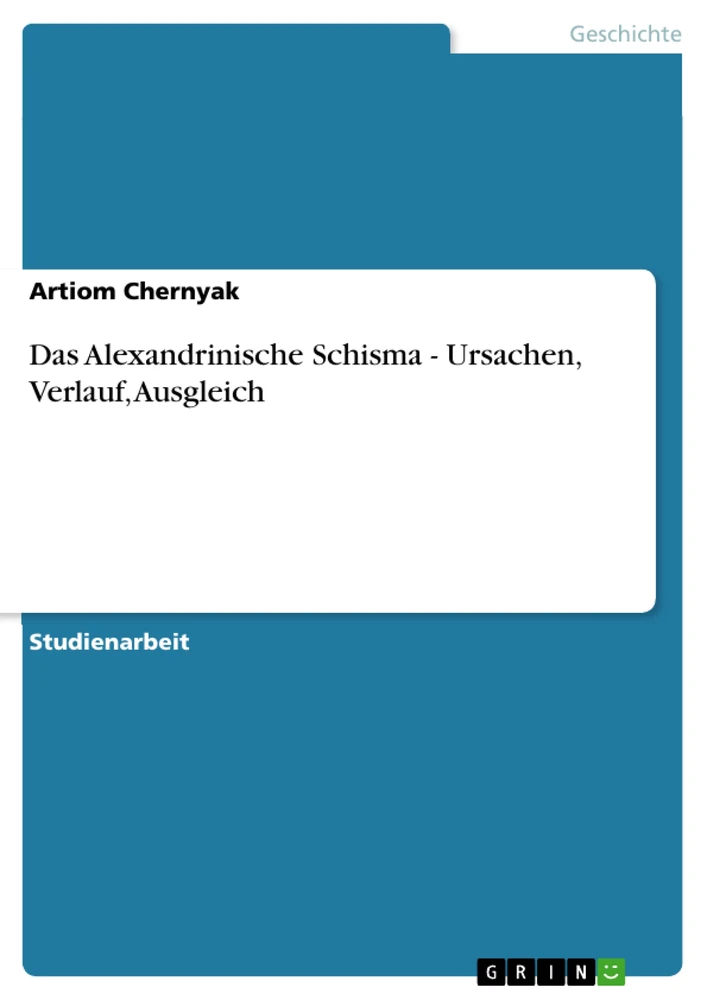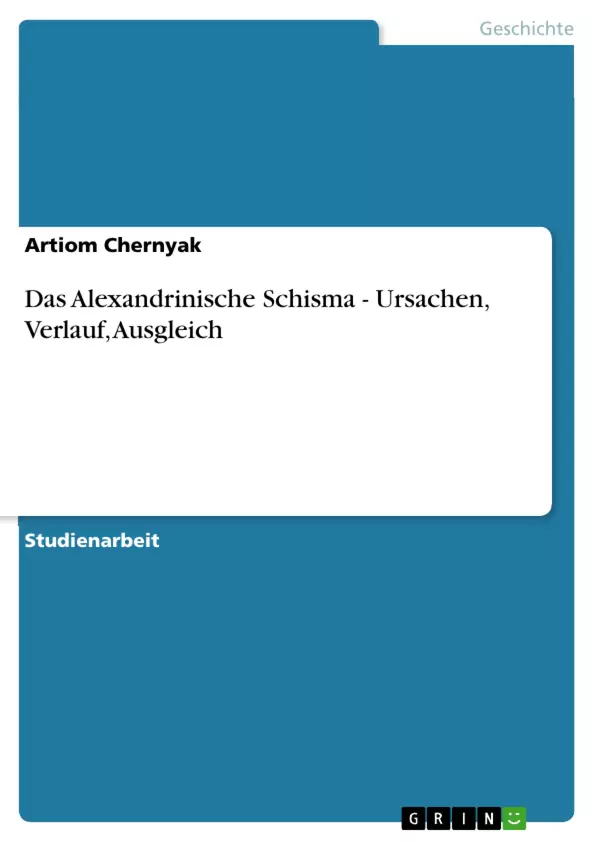Beschäftigt man sich mit der hochmittelalterlichen Geschichte Deutschlands, dann kommt man am Geschlecht der Staufer und ihrer Leitfigur „Friedrich Barbarossa“ nicht vorbei.1 Er war zur Zeit seiner Regentschaft (1152-1190) eine derart bedeutende politische Persönlichkeit, dass er in all seinen Facetten in dieser Seminararbeit nicht behandelt werden kann. So beschränke ich mich in meiner Arbeit auf den Konflikt zwischen Friedrich Barbarossa und Papst Alexander III. und versuche die Frage zu beantworten, wie es zum Alexandrinischen Schisma kam, wie es verlief und zu welchen Ergebnissen und Konsequenzen es nach sich zog.
Die Intention der Arbeit zielt darauf ab, einen kompakten Überblick über den Hergang und die Entwicklung des Konflikts zwischen Friedrich Barbarossa und Alexander III. zu erarbeiten und zum Schluss darzustellen inwieweit die beiden Kontrahenten den abgeschlossenen Frieden von Venedig 1177 zu ihrem Vorteil nutzen konnten beziehungsweise Nachteile hinnehmen mussten. Der Versuch die Auseinandersetzung zu beschreiben muss seinen Ausgang von der Frage nehmen, wie sich die Beziehungen zwischen dem Staufer und der römischen Kurie seit seinem Regierungsantritt entwickelten. Weiterhin muss untersucht werden welches Verständnis und welche Ansichten die Kontrahenten von der eigenen Amtsfunktion und der Funktion des jeweils Anderen hatten. Waren die Zugeständnisse Barbarossas im Frieden von Venedig ein Rückschritt gegenüber seinem Bestreben die Gleichrangigkeit der beiden „Universalgewalten“, in deren Rolle sich Papst und Kaiser sahen, zu postulieren oder stellten die Vereinbarungen eine konsequente und folgerichtige Sicherung seiner Kaiserwürde dar?
Viele Historiker setzten sich bereits wegen der besonderen Bedeutung, die der Konflikt zwischen dem Kaiser- und Papsttum mit sich brachte, mit dem angesprochenen Thema auseinander. Aufgrund der Wichtigkeit, die der Vertrag von Venedig einschließlich seiner Konsequenzen für das Verhältnis zwischen Kirche und Staat hatte, findet sich in der Fachliteratur eine umfassende systematische Darstellung der Ereignisse. Neben dem monographischen Werken von Johannes Laudage und Odilo Engels setzten sich noch zahlreiche Autoren mit dem Konflikt und/oder dessen beiden Hauptakteuren auseinander.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hergang des Konflikts
- Doppelwahl das Alexandrinische Schisma
- Ausgleich
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Konflikt zwischen Friedrich Barbarossa und Papst Alexander III., beleuchtet den Verlauf des Alexandrinischen Schismas und analysiert die Ergebnisse und Konsequenzen des Konflikts. Das Hauptziel ist es, einen umfassenden Überblick über den Konflikt und seine Entwicklung zu liefern und zu bewerten, inwieweit beide Seiten den Frieden von Venedig 1177 zu ihrem Vorteil nutzen konnten.
- Entwicklung des Verhältnisses zwischen Friedrich Barbarossa und der römischen Kurie
- Das Verständnis beider Kontrahenten von ihren jeweiligen Amtsfunktionen
- Der Konstanzer Vertrag von 1153 und seine Bedeutung für den Konflikt
- Die Bedeutung des Reichstags von Besançon 1157
- Der Frieden von Venedig 1177 und seine Konsequenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert den Fokus der Arbeit auf den Konflikt zwischen Friedrich Barbarossa und Papst Alexander III. Sie definiert die Forschungsfrage nach den Ursachen, dem Verlauf und den Konsequenzen des Alexandrinischen Schismas. Das Ziel der Arbeit ist die Erarbeitung eines kompakten Überblicks über den Konflikt und die Bewertung des Friedens von Venedig 1177 für beide Kontrahenten. Die Einleitung verweist auf die umfangreiche Fachliteratur zum Thema und hebt die Bedeutung des Konflikts für das Verhältnis zwischen Kaiser- und Papsttum hervor.
Hergang des Konflikts: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Barbarossa und der römischen Kurie seit dessen Regierungsantritt 1152. Es analysiert den Konstanzer Vertrag von 1153, der die gegenseitige Unterstützung gegen Feinde und die Kaiserkrönung Barbarossas beinhaltete, aber auch die Klausel enthielt, keine Separatfrieden mit den Feinden des jeweils anderen einzugehen – ein Punkt, der später zu Konflikten führen sollte. Das Kapitel beschreibt detailliert den ersten Italienfeldzug Barbarossas und den Vorfall in Sutri, wo Barbarossas Weigerung, den „Marschall- und Stratordienst“ für den Papst zu leisten, einen frühen Eklat verursachte und die Gleichrangigkeit der weltlichen und geistlichen Macht verdeutlichte. Der Konflikt wird als kontinuierlicher Prozess dargestellt, dessen Wurzeln bereits vor dem Reichstag von Besançon liegen.
Schlüsselwörter
Alexandrinisches Schisma, Friedrich Barbarossa, Alexander III., Konstanzer Vertrag, Reichstag von Besancon, Frieden von Venedig, Kaiser, Papst, Investiturstreit, Universalgewalten, Reichsfeinde, Gleichrangigkeit, weltliche und geistliche Macht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Konflikt zwischen Friedrich Barbarossa und Papst Alexander III.
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Konflikt zwischen Kaiser Friedrich Barbarossa und Papst Alexander III., insbesondere den Verlauf des Alexandrinischen Schismas, dessen Ergebnisse und Konsequenzen, und die Nutzung des Friedens von Venedig 1177 durch beide Seiten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Barbarossa und der römischen Kurie, das Verständnis beider Kontrahenten von ihren Amtsfunktionen, die Bedeutung des Konstanzer Vertrages von 1153 und des Reichstags von Besançon 1157, sowie die Folgen des Friedens von Venedig 1177. Die Analyse konzentriert sich auf die Ursachen, den Verlauf und die Konsequenzen des Konflikts.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Hergang des Konflikts, ein Kapitel zum Alexandrinischen Schisma, ein Kapitel zum Ausgleich (Frieden von Venedig) und eine abschließende Betrachtung. Die Einleitung skizziert den Fokus und die Forschungsfrage. Das Kapitel zum Hergang des Konflikts analysiert die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Barbarossa und der Kurie, beginnend mit dem Konstanzer Vertrag.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, einen umfassenden Überblick über den Konflikt zwischen Friedrich Barbarossa und Papst Alexander III. zu geben und zu bewerten, inwieweit beide Seiten den Frieden von Venedig 1177 zu ihrem Vorteil nutzen konnten. Die Arbeit zielt auf ein kompaktes Verständnis des Konflikts und seiner Bedeutung für das Verhältnis von Kaiser- und Papsttum ab.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Alexandrinisches Schisma, Friedrich Barbarossa, Alexander III., Konstanzer Vertrag, Reichstag von Besancon, Frieden von Venedig, Kaiser, Papst, Investiturstreit, Universalgewalten, Reichsfeinde, Gleichrangigkeit, weltliche und geistliche Macht.
Wie wird der Konflikt im Detail dargestellt?
Der Konflikt wird als kontinuierlicher Prozess dargestellt, dessen Wurzeln bereits vor dem Reichstag von Besançon liegen. Die Arbeit analysiert den Konstanzer Vertrag von 1153 und dessen Klausel bezüglich Separatfrieden, den ersten Italienfeldzug Barbarossas und den Vorfall in Sutri, der die Frage der Gleichrangigkeit weltlicher und geistlicher Macht verdeutlichte.
Welche Bedeutung hat der Frieden von Venedig (1177)?
Der Frieden von Venedig 1177 ist ein zentraler Punkt der Arbeit. Die Analyse bewertet, inwieweit dieser Frieden für beide Kontrahenten von Vorteil war und welche langfristigen Konsequenzen er hatte. Die Einleitung hebt bereits seine Bedeutung für das Verhältnis zwischen Kaiser- und Papsttum hervor.
- Arbeit zitieren
- Artiom Chernyak (Autor:in), 2010, Das Alexandrinische Schisma - Ursachen, Verlauf, Ausgleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166483