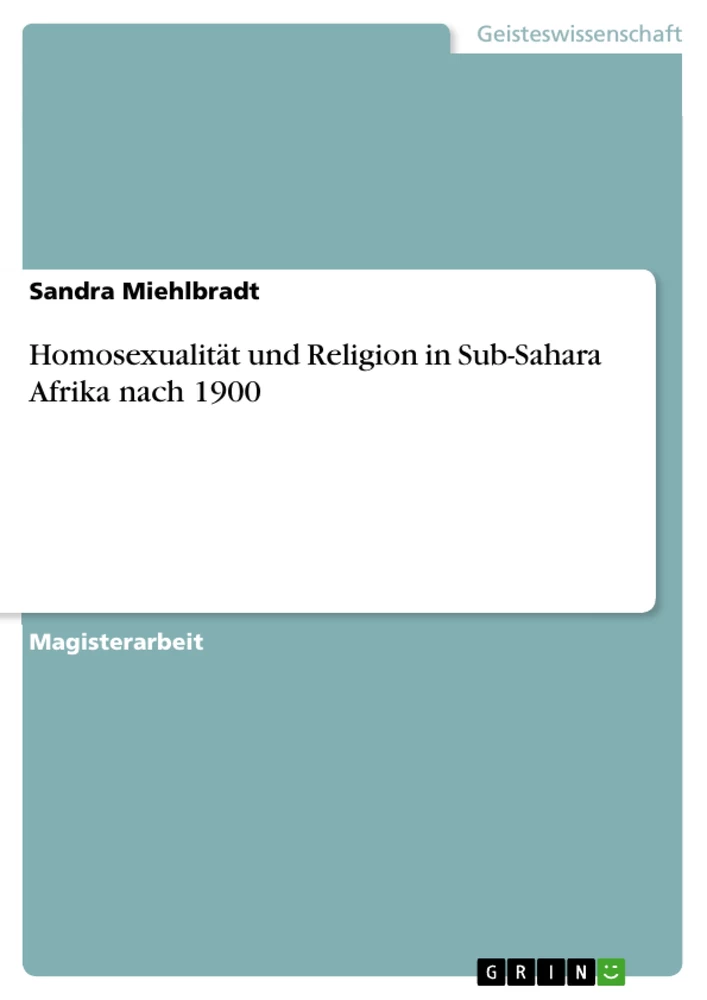„Golden girl oder bad boy?“1, “Weltmeisterin soll ein Zwitter sein”2, solche oder ähnliche Titel ließen sich im Sommer 2009 in jeder Zeitung oder Zeitschrift Deutschlands und Europas finden. Die Rede ist von Caster Semenya, einer 18-jährigen Athletin aus Südafrika. Sie holte überraschend die Goldmedaille im 800-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen in Berlin.
So überraschend, dass Zweifel an ihrem Geschlecht aufkamen und sie sich einem Geschlechtstest unterziehen musste.3 Von ihrem Sieg und ihrer Leistung war nur noch selten die Rede, wichtiger schien die Frage nach ihrem Geschlecht zu sein. Dass die Geschlechtertests allerdings schon seit dem Jahr 2000 vom IOC, dem International Olympic Committee, abgeschafft worden waren, ist weniger bekannt. In einigen Ausnahmefällen dürfen die Tests aber durchgeführt werden und Caster scheint eine solche Ausnahme zu sein.
Dass hier eine Athletin aus dem subsaharischen Afrika im Mittelpunkt steht, verwundert kaum.
Die Neugier am Geschlecht und der Sexualität eines Menschen reiht sich in eine lange Geschichte ein. Das Interesse an der Sexualität, am Geschlecht oder am Sexleben anderer Kulturen oder einzelner Personen war schon immer groß. Diese Sexualisierung, die vor allem Afrika und den Orient betrifft, geht schon auf das Mittelalter zurück. Bilder von unbeschränkter, extrovertierter Sexualität, der einfachen sexuellen Verfügbarkeit afrikanischer Frauen, dem Mangel an sexueller Moral bestimmten lange Zeit das Bild vom Sexleben der „Afrikaner“. Dieses steht in engem Zusammenhang zum Stereotyp des „Wilden“. Dieser steht in ständigem Kampf mit seiner Natur und Sexualität, derer er kaum Herr wird. Dabei schwankten die Darstellungen von der Idealisierung als eine Art Paradies, bis hin zu Ablehnung der vermeintlichen Sexualität der „Anderen“.4
[...]
1 o.V.: Golden girl oder bad boy, 20.08.2009[online: ttp://www.focus.de/sport/mehrsport/leichtathletik-wm-2009/tid-15256/caster-semenya-golden-girl-oder-bad-boy_aid_428054.html, 28.12.09].
2 Schirmer, Andreas/ Ralf Jarkowski: Weltmeisterin soll ein Zwitter sein, 11.09.2009 [online: http://www.stern.de/sport/sportwelt/caster-semenya-weltmeisterin-soll-ein-zwitter-sein-1508423.html, 28.12.09].
3 Die Ergebnisse desselben sind bis heute nicht vom IOC veröffentlich worden.
4 Pieterse, Jan Nederveen: White on black: Images of Africa and Blacks in Western popular culture. New Haven/ London 1992. S. 172.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thema und Fragestellung
- Vorhaben
- Literaturlage
- Homosexualität
- Definition
- Theorien zur Sexualität/ Homosexualität
- Essentialismus vs. Konstruktivismus?
- Adams vierfache Typologie der Homosexualität
- Homosexualität in Sub-Sahara-Afrika
- Gleichgeschlechtliche Praktiken, die durch Gender definiert werden
- Gleichgeschlechtliche Praktiken, die durch Alter strukturiert werden
- Egalitäre Beziehungen
- Religion: Definition
- Die traditionellen afrikanischen Religionen
- Formen und Inhalte
- Traditionelle afrikanischen Religionen und Homosexualität
- Androgyne Gottheiten und ihre menschlichen Vermittler
- Fallbeispiele
- Die Wächter der Dagara
- Besessenheitskulte
- Der Bori-Kult
- Der Ukuthwasa-Kult & Izangoma
- Der Islam
- Formen und Inhalte
- Der Qur'ān und Homosexualität
- Ahadīth und Homosexualität
- Die Sharia und Homosexualität
- Die Sharia in Afrika
- Gesetzliche Grundlagen
- Fallbeispiele
- Nigeria
- Somalia
- Sharia: International
- Die Stimmen muslimischer,,Homosexueller“ in afrikanischen Ländern
- Südafrika
- Nigeria
- Kenia
- Das Christentum
- Formen und Inhalte
- Ein frühes Beispiel: Der Kabaka in Buganda
- Die Bibel und Homosexualität
- Das Alte Testament
- Das Neue Testament
- Inklusive Lesarten der Bibel
- Haltung afrikanischer Kirchen: Die Missionskirchen
- Die anglikanische Kirche
- Ausgangspunkte der Debatte
- Afrikanische Stimmen
- Nigeria
- Uganda
- Positionen anderer afrikanischer Länder
- Südafrika
- Haltung afrikanischer Kirchen: Charismatische Kirchen & Pfingstbewegung
- Die Metropolitan Community Churches
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit befasst sich mit der komplexen Beziehung zwischen Homosexualität und Religion im subsaharischen Afrika nach 1900. Sie untersucht die Positionen der traditionellen afrikanischen Religionen, des Islam und des Christentums gegenüber Homosexualität und analysiert, wie sich diese Positionen in der Praxis niederschlagen. Dabei werden die verschiedenen Formen und Inhalte der jeweiligen Religionen berücksichtigt, sowie die spezifischen Herausforderungen und Diskurse, die sich im afrikanischen Kontext ergeben.
- Die verschiedenen Formen und Inhalte der traditionellen afrikanischen Religionen, des Islam und des Christentums im subsaharischen Afrika.
- Die unterschiedlichen Positionen dieser Religionen gegenüber Homosexualität, sowohl in der Lehre als auch in der Praxis.
- Die Auswirkungen der globalen Diskurse über Homosexualität auf die afrikanischen Gesellschaften und Religionen.
- Die Lebensrealitäten von Menschen mit gleichgeschlechtlicher Orientierung in religiös geprägten afrikanischen Gesellschaften.
- Die Rolle von Religion und Kultur im Umgang mit Homosexualität in Afrika.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und definiert die Fragestellung. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext der aktuellen Debatten um Homosexualität in Afrika beleuchtet.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Begriff der Homosexualität und beleuchtet verschiedene Theorien zur Entstehung und Definition von Sexualität. Im Fokus steht die Frage, wie sich Homosexualität in der afrikanischen Kultur darstellt und welche Formen gleichgeschlechtlicher Praktiken in verschiedenen Gesellschaften vorkommen.
Kapitel 3 definiert den Begriff der Religion und stellt den Zusammenhang zwischen Religion und Kultur heraus.
Kapitel 4 analysiert die traditionellen afrikanischen Religionen und untersucht, wie sie mit Homosexualität umgehen. Es werden verschiedene Fallbeispiele beleuchtet, um die unterschiedlichen Praktiken und Einstellungen zu verdeutlichen.
Kapitel 5 widmet sich dem Islam in Afrika. Es werden die relevanten Texte des Islam, wie der Qur'ān und die Ahadīth, in Bezug auf Homosexualität analysiert. Des Weiteren werden die islamischen Rechtsgrundlagen und die Anwendung der Sharia in Afrika untersucht, sowie die Positionen von muslimischen Menschen mit gleichgeschlechtlicher Orientierung.
Kapitel 6 befasst sich mit dem Christentum in Afrika. Es werden verschiedene Positionen innerhalb des Christentums, sowohl in der Bibel als auch in den afrikanischen Kirchen, in Bezug auf Homosexualität beleuchtet. Die Arbeit analysiert die Debatten um Homosexualität in den afrikanischen Kirchen und die unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen von Menschen mit gleichgeschlechtlicher Orientierung im Kontext des Christentums.
Schlüsselwörter
Homosexualität, Religion, Afrika, Traditionelle Religionen, Islam, Christentum, Sharia, Bibel, Gleichgeschlechtliche Praktiken, Kultur, Gesellschaft, Identität, Diskriminierung, Toleranz, Akzeptanz.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Homosexualität im afrikanischen Kontext definiert?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Typologien: gleichgeschlechtliche Praktiken, die durch Gender (z.B. androgyne Gottheiten), Alter oder egalitäre Beziehungen strukturiert sind.
Welche Position nehmen traditionelle afrikanische Religionen ein?
In vielen traditionellen Kulturen gab es Raum für geschlechtliche Vielfalt, wie z.B. Besessenheitskulte (Bori, Ukuthwasa) oder androgyne Vermittlerfiguren (Wächter der Dagara).
Wie bewertet der Islam in Afrika das Thema Homosexualität?
Die Bewertung basiert auf dem Qur'ān, Ahadīth und der Sharia. In Ländern wie Nigeria oder Somalia führt die strikte Auslegung der Sharia oft zu rechtlicher Verfolgung.
Welche Rolle spielt die Bibel in der afrikanischen Christentum-Debatte?
Es gibt einen Konflikt zwischen konservativen Lesarten und inklusiven Ansätzen. Besonders in anglikanischen und charismatischen Kirchen Afrikas wird Homosexualität oft scharf abgelehnt.
Gibt es afrikanische Stimmen von queeren Gläubigen?
Ja, die Arbeit untersucht Stimmen aus Südafrika, Kenia und Nigeria, wo Menschen versuchen, ihren Glauben mit ihrer sexuellen Identität in Einklang zu bringen, oft in einem feindseligen Umfeld.
- Quote paper
- Sandra Miehlbradt (Author), 2010, Homosexualität und Religion in Sub-Sahara Afrika nach 1900, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166558