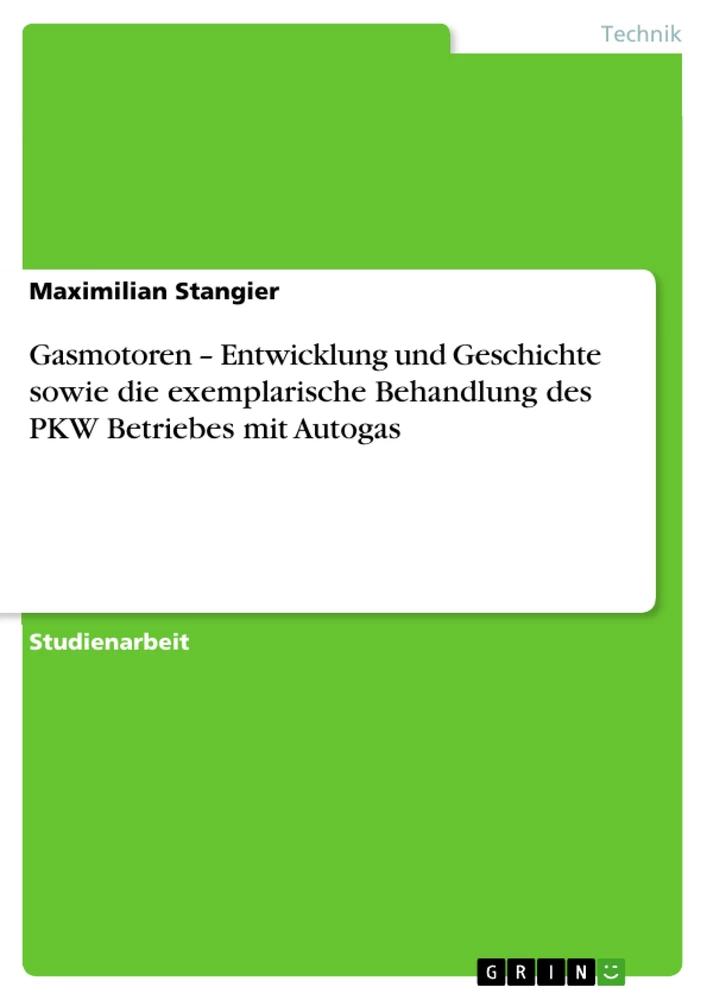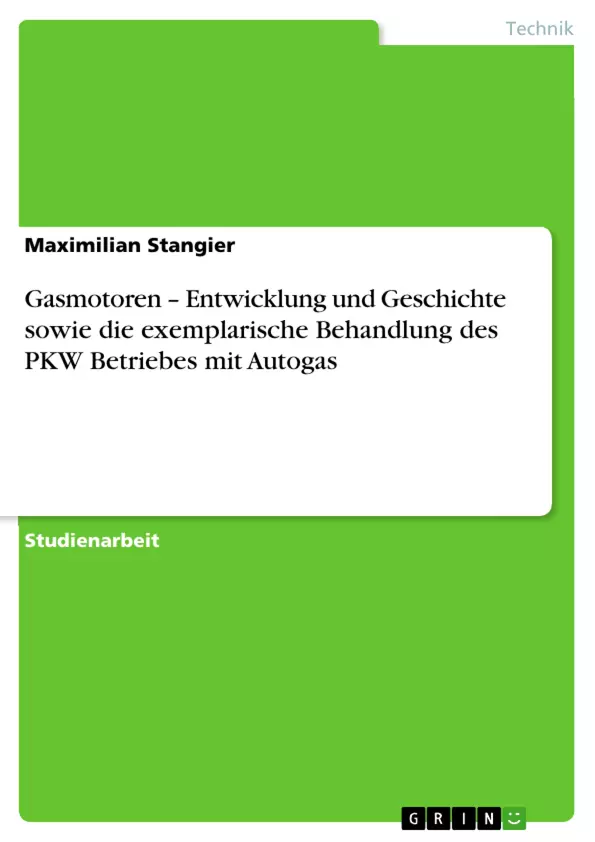„Der Gasmotor stand lange abseits, obwohl doch alle Verbrennungsmotoren ihren Anfang im Gasmotor des 19. Jahrhunderts haben“ (Zacharias 2001, S.15). Es sind steigende Energiepreise und die immer finsterer werdenden Prognosen über die Verfügbarkeit von Rohöl als Ausgangsprodukt für Primärenergielieferanten, welche die Forschung und Entwicklung von alternativen Energieträgern immer stärker begünstigen. Gasmotoren arbeiten mit diesen Energieträgern und wurden schon immer, auch in Zeiten von redundanter Verfügbarkeit von Kraftstoffen, genutzt um dann meist energetisch schwache Gase wie z.B. aus Abfällen zu verwerten um Strom und Nutzwärme zu erzeugen. Nun ist mittlerweile aber nicht mehr nur die Anlagentechnik zur Verwertung und Entsorgung von Problemgasen interessant, sondern steigende Energiepreise machen die Nutzung von Gasmotoren in sämtlichen Bereichen der Energieerzeugung generell wichtig. Gerade im Bereich der Personenkraftwagen ist durch die Umstellung auf den Betrieb mit Flüssiggas eine Einsparung sowohl von Betriebskosten als auch von Emissionen möglich. In der Debatte zur Schonung der Umwelt und Reduktion der Abgase wird die Verwendung von Gasen als Energieträger viel diskutiert. Durch der Forschung neuste Entwicklungen der letzten Jahre kennzeichnen den Gasmotor heute ein hoher Wirkungsgrad, sauberere Abgase als bei anderen vergleichbaren Brennstoffen sowie günstigere Preise und niedrigere Betriebskosten (vgl. Zacharias 2001, S.15f).
Da nun der Gasmotor eine Kolbenverbrennungskraftmaschine ist und daher dem Benzin-Ottomotor und dem Dieselmotor ähnlich ist, wobei der Gasmotor eben mit Gasen oder Gas - Treibstoffmischungen betrieben wird, betrachtet diese Arbeit zunächst die Entwicklung des Kolbenmotors....
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Anfänge und Entwicklung des Kolbenmotors
- 3. Die ersten Kolbenkraftmaschinen
- 4. Der Otto Motor
- 5. Motorkenngrößen
- 5.1 Luft – Kraftstoff- Verhältnis λ
- 5.2 Verdichtung
- 6. Der Betriebsstoff Gas im Auto
- 7. Autogas LPG
- 7.1 Was ist Flüssiggas
- 7.2 Aufbau und Funktion einer Autogasanlage
- 7.2.1 Venturitechnik
- 7.2.2 Sequenzielle Autogasanlagen
- 7.2.3 Liquid Propane Injection – Autogasanlagen
- 8. Fazit – Ökologische/Ökonomische Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Gasmotors, beginnend mit den frühen Kolbenkraftmaschinen bis hin zur modernen Anwendung im Personenkraftwagenbetrieb mit Flüssiggas (LPG). Die Zielsetzung ist es, die historische Entwicklung nachzuzeichnen und die Funktionsweise sowie die Vor- und Nachteile des Autogasbetriebs im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit zu beleuchten.
- Historische Entwicklung des Kolbenmotors und des Gasmotors
- Funktionsweise des Ottomotors und des Gasmotors
- Autogas (LPG) als Kraftstoff: Technik und Anwendung
- Ökonomische und ökologische Aspekte des Autogasbetriebs
- Vergleich verschiedener Autogasanlagen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die aktuelle Relevanz von Gasmotoren angesichts steigender Energiepreise und der Notwendigkeit alternativer Energieträger. Sie hebt die Effizienz und Umweltfreundlichkeit moderner Gasmotoren hervor und umreißt den Fokus der Arbeit auf die historische Entwicklung des Kolbenmotors, insbesondere des Ottomotors, sowie auf die Anwendung von Gas als Kraftstoff im PKW-Bereich, wobei der Schwerpunkt auf LPG-Autogasanlagen liegt.
2. Anfänge und Entwicklung des Kolbenmotors: Dieses Kapitel beschreibt die Anfänge der Kolbenverbrennungskraftmaschinen, beginnend mit Huygens' Pulvermaschine. Es analysiert die Weiterentwicklung bis zum Lenoir-Motor, der zwar einen schlechten Wirkungsgrad aufwies (3-4%), aber aufgrund seines zyklischen Funktionsprinzips wegweisend war und die Entwicklung von Brennkraftmaschinen entscheidend vorantrieb. Der Fokus liegt auf der kontinuierlichen Verbesserung der Technologie, die letztlich zur Entwicklung des Ottomotors führte.
3. Die ersten Kolbenkraftmaschinen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung des Viertaktmotors durch Nikolaus August Otto. Es beschreibt den Ottoschen Flugkolbenmotor als Vorläufer und betont die Bedeutung des Viertaktprinzips für den Erfolg des Ottomotors und seine weltweite Verbreitung im Automobilbau. Der Abschnitt hebt die Innovation des Viertaktprinzips hervor und erklärt seine Bedeutung für die Effizienzsteigerung im Vergleich zu früheren Motoren.
Schlüsselwörter
Gasmotoren, Kolbenmotor, Otto-Motor, Verbrennungskraftmaschine, Autogas, LPG, Flüssiggas, Energieeffizienz, Umweltverträglichkeit, Wirkungsgrad, Automobiltechnik, historische Entwicklung, alternative Energieträger.
FAQ: Entwicklung des Gasmotors und Autogasbetrieb
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des Gasmotors, beginnend mit den frühen Kolbenkraftmaschinen bis hin zu modernen Autogasanlagen (LPG). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung, der Funktionsweise und den Vor- und Nachteilen des Autogasbetriebs in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Kolbenmotors und des Gasmotors, die Funktionsweise des Ottomotors und des Gasmotors, Autogas (LPG) als Kraftstoff, die Technik und Anwendung von Autogasanlagen, ökonomische und ökologische Aspekte des Autogasbetriebs sowie einen Vergleich verschiedener Autogasanlagen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Entwicklung des Viertaktmotors und den verschiedenen Arten von Autogasanlagen gewidmet.
Welche Kapitel sind enthalten und worum geht es in ihnen?
Das Dokument umfasst Kapitel zu folgenden Themen: Einleitung (Einführung in die Thematik und Begründung der Relevanz von Gasmotoren); Anfänge und Entwicklung des Kolbenmotors (von Huygens' Pulvermaschine bis zum Lenoir-Motor); Die ersten Kolbenkraftmaschinen (Fokus auf den Viertaktmotor von Otto); Der Otto Motor (detaillierte Beschreibung); Motorkenngrößen (Luft-Kraftstoff-Verhältnis und Verdichtung); Der Betriebsstoff Gas im Auto; Autogas LPG (inkl. Aufbau und Funktion verschiedener Autogasanlagen); und Fazit – Ökologische/Ökonomische Betrachtung. Jedes Kapitel fasst die wichtigsten Aspekte zusammen.
Welche Arten von Autogasanlagen werden verglichen?
Der Text vergleicht verschiedene Autogasanlagen, darunter Anlagen mit Venturitechnik, sequenzielle Autogasanlagen und solche mit Liquid Propane Injection (LPI).
Was sind die Schlüsselwörter des Dokuments?
Die Schlüsselwörter umfassen: Gasmotoren, Kolbenmotor, Otto-Motor, Verbrennungskraftmaschine, Autogas, LPG, Flüssiggas, Energieeffizienz, Umweltverträglichkeit, Wirkungsgrad, Automobiltechnik, historische Entwicklung, alternative Energieträger.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit verfolgt die Zielsetzung, die historische Entwicklung des Gasmotors nachzuzeichnen und die Funktionsweise sowie die Vor- und Nachteile des Autogasbetriebs im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit zu beleuchten.
Welche Vorteile bietet der Autogasbetrieb?
Der Text hebt die Vorteile des Autogasbetriebs in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit hervor, jedoch ohne konkrete Zahlen oder detaillierte Vergleiche zu liefern. Dies wird als Thema im Fazit angesprochen.
Welche Nachteile bietet der Autogasbetrieb?
Der Text erwähnt die Nachteile des Autogasbetriebs im Vergleich zu Benzin oder Diesel nicht explizit. Eine umfassendere Bewertung dieser Aspekte findet sich im Fazit.
- Quote paper
- B.A. Maximilian Stangier (Author), 2008, Gasmotoren – Entwicklung und Geschichte sowie die exemplarische Behandlung des PKW Betriebes mit Autogas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166612