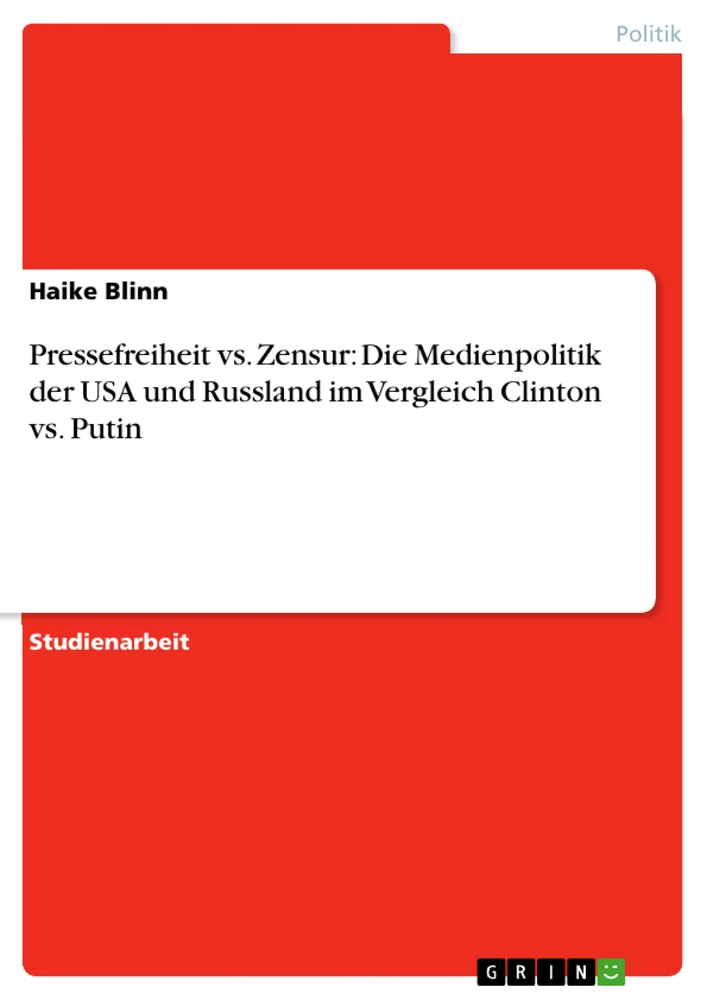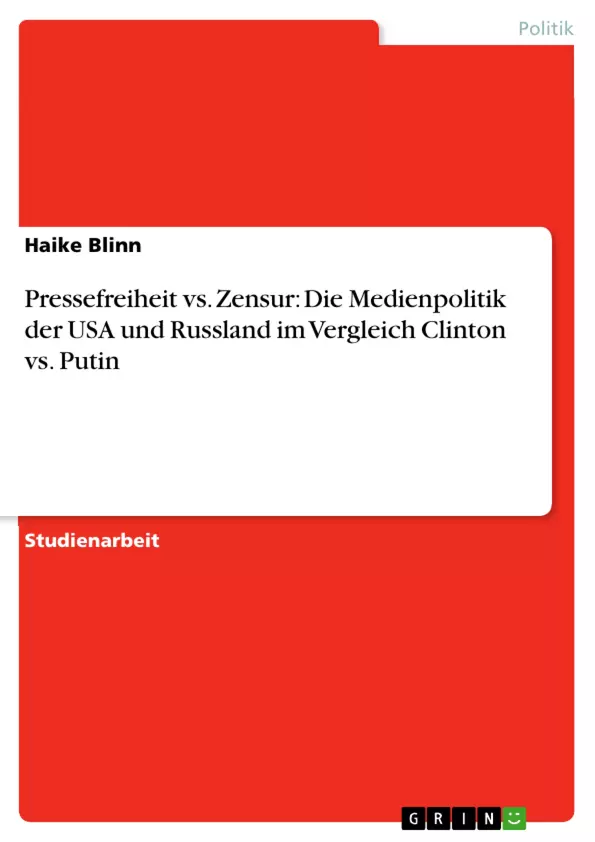1.Einleitung
Als sich Bill Clinton im Jahr 1999 wieder für die Wahl zum Präsidenten stellte, gingen die Medienberichterstattungen rund um die ganze Welt. In den USA wurden wieder mal riesengroße Wahlreden und Wahlpartys gefeiert. Alle Präsidentschaftskandidaten buhlten um die Gunst des Wählers. Neu eingeführt in den US-amerikanischen Wahlkampf hatte Clinton 1992 das „Townhall Format“, in dem sich die Kandidaten den Fragen der Wähler stellten und so die Möglichkeit hatten ihre Wähler von ihrem Programm zu überzeugen.
Dagegen lief die Wahlpropaganda 2000 in Russland ganz anders als in den USA. Putin gewann die Sympathie der Russen angesichts seiner Eingriffe in Tschetschenien, die gelenkten Medienberichte taten ein Übriges2. Alle anderen Kandidaten waren bzw. bleiben mehr oder weniger unbekannt.
Angesichts der unterschiedlichen Wahlpropaganda, kann wohl davon ausgegangen werden, dass beide Länder eine unterschiedliche Medienpolitik betrieben.
Zu Beginn werde ich Begriffe wie Medien, Pressefreiheit, Selbstzensur, Zensur und die Medienwirkungsmodelle erläutern.
Im Hauptteil gehe ich auf die verfassungsrechtlichen Grundlagen ein sowie den Umgang der Präsidenten Clinton und Putin mit den Medien. Danach vergleiche ich beide Medienpolitiken miteinander.
Das abschließende Fazit stellt eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse dar und geht kurz auf die aktuellen Präsidenten der USA und Russland ein.
2. Zum Begriff der Medien und der Medienwirkungsmodelle
„Medien sind Mittel und Vermittler, deren man sich bedient, um anderen etwas mitzuteilen“. Ist von Medien die Rede, so meint man normalerweise die Massenmedien: Radio, Fernsehen und Presse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff der Medien und der Medienwirkungsmodelle
- Pressefreiheit vs. Zensur
- Die Medienpolitik der USA: Sensationslust und Meinungsmache
- Verfassungsrechtliche Grundlagen der Medienpolitik der USA
- Clintons Medienpolitik (1993-2001)
- Die Medienpolitik Russlands: Neugier ist der Katze Tod.
- Verfassungsrechtliche Grundlagen der Medienpolitik Russlands
- Putins Medienpolitik (2000-2008)
- Vergleich der Medienpolitik der USA mit Russland
- Die Medienpolitik der USA: Sensationslust und Meinungsmache
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Medienpolitik der USA und Russlands im Vergleich und analysiert die Rolle der Pressefreiheit und Zensur in beiden Ländern. Dabei wird die politische Einflussnahme auf Medien und die unterschiedlichen Auswirkungen auf die öffentliche Meinungsbildung in beiden Ländern betrachtet.
- Verfassungsrechtliche Grundlagen der Medienpolitik in den USA und Russland
- Medienpolitik von Bill Clinton und Wladimir Putin
- Vergleichende Analyse der Medienpolitik der USA und Russlands
- Einfluss der Medien auf die öffentliche Meinung
- Rolle von Pressefreiheit und Zensur in den USA und Russland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und führt in die unterschiedlichen Wahlkampfstrategien von Bill Clinton in den USA und Wladimir Putin in Russland ein. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe Medien, Pressefreiheit, Selbstzensur und Zensur erläutert, sowie verschiedene Medienwirkungsmodelle vorgestellt.
Das dritte Kapitel analysiert die Medienpolitik der USA und Russlands. Es werden die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Medienpolitik in beiden Ländern beleuchtet und die Medienpolitik von Bill Clinton und Wladimir Putin untersucht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Pressefreiheit, Zensur, Medienpolitik, Medienwirkungsmodelle, USA, Russland, Clinton, Putin. Die Arbeit analysiert die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Medienpolitik, untersucht die Medienpolitik von Bill Clinton und Wladimir Putin und vergleicht die beiden Systeme anhand der Rolle von Pressefreiheit und Zensur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Vergleichs zwischen Clinton und Putin?
Die Arbeit vergleicht die Medienpolitik der USA unter Bill Clinton mit der Russlands unter Wladimir Putin hinsichtlich Pressefreiheit und Zensur.
Was ist das „Townhall Format“?
Ein von Clinton 1992 eingeführtes Wahlkampfformat, bei dem sich Kandidaten direkt den Fragen der Wähler stellen, um Bürgernähe zu demonstrieren.
Wie unterscheidet sich die Medienpolitik in Russland unter Putin?
Putins Politik war durch gelenkte Medienberichte und eine starke Kontrolle der Information geprägt, was politische Gegner oft im Unklaren ließ.
Was versteht man unter Selbstzensur?
Selbstzensur bezeichnet die freiwillige Einschränkung der Berichterstattung durch Journalisten oder Medienhäuser, oft aus Angst vor staatlichen Repressalien.
Welche Rolle spielen die verfassungsrechtlichen Grundlagen?
Die Arbeit analysiert, wie die Verfassungen beider Länder die Pressefreiheit theoretisch garantieren und wie diese in der politischen Praxis umgesetzt oder eingeschränkt werden.
- Citar trabajo
- Haike Blinn (Autor), 2008, Pressefreiheit vs. Zensur: Die Medienpolitik der USA und Russland im Vergleich Clinton vs. Putin, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166721