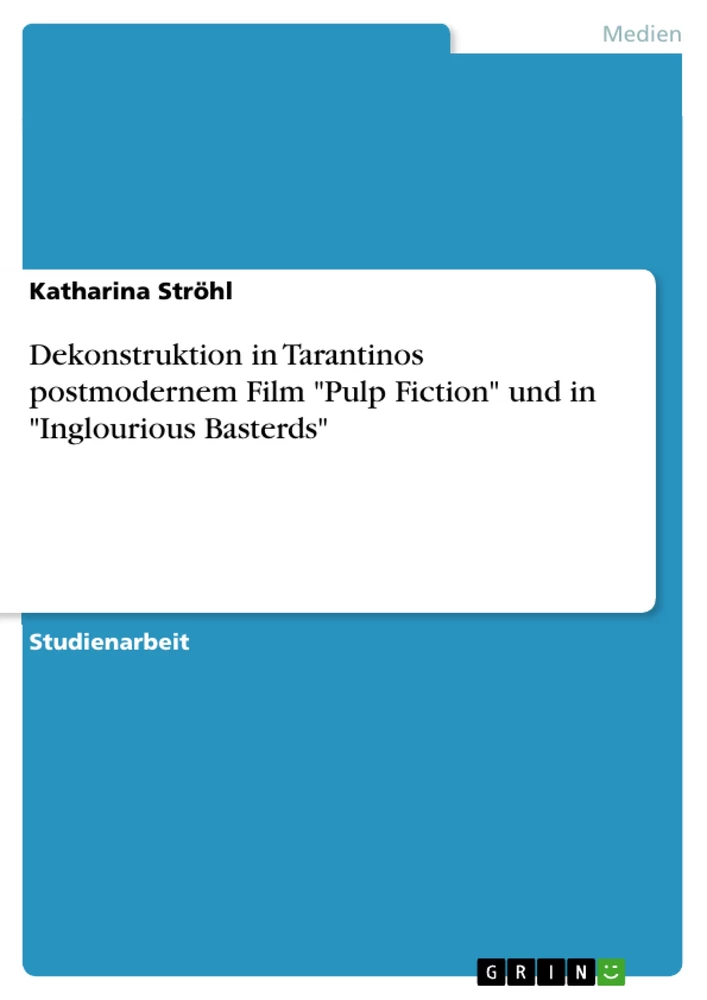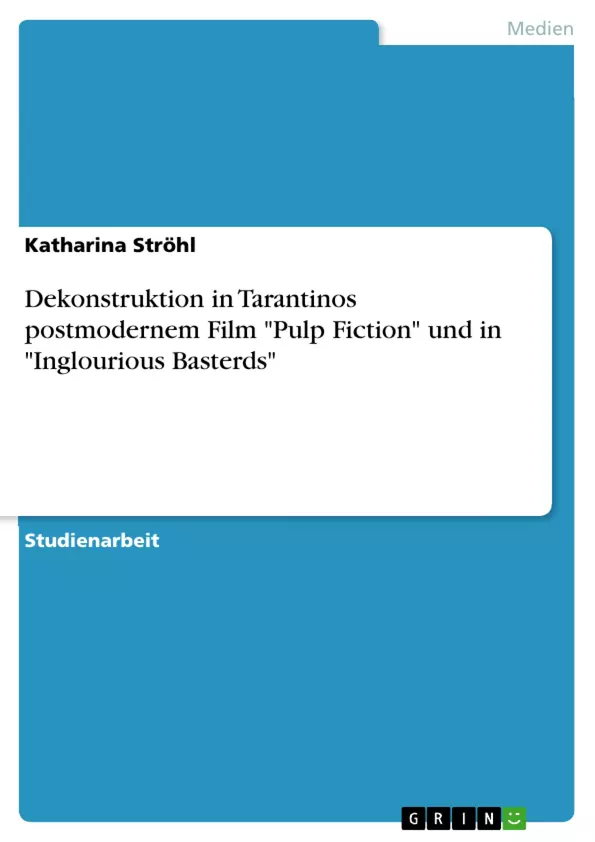Der Begriff "Postmoderne" setzt sich aus dem Präfix "post", was "nach" oder "hinter" bedeutet, und dem Wort Moderne zusammen. Die logische Konsequenz daraus lautet, dass die Postmoderne an die Moderne anknüpft bzw. eine Weiterführung dieser ist. Wird nun weiter einer linguistischen Logik gefolgt, dann sei die Moderne entweder paradoxerweise durch eine unvollendete Modernisierung gekennzeichnet oder aber die Postmoderne die Vollendung der Moderne.
"Vielleicht reden die Leute von der Postmoderne, weil sie mitten in der Moderne stecken, die ihnen zum Hals heraushängt, und vielleicht ist das Reden vom Ende der Postmoderne nichts als die ernüchternde Entdeckung, dass wir mitten in der uns zum Hals heraushängenden Moderne stecken?"
Exemplarisch für den Begriff Postmoderne ist diese Aussage von Vilém Flusser, denn das Selbstverständnis exponierter Vertreter postmodernen Denkens zeigt, ebenfalls wie beim Begriff Moderne, keine einheitliche Auffassung, von dem, was postmodern sei, lediglich ähnliche Strukturen lassen sich erkennen.
Nun ist es aber nicht Aufgabe dieser Arbeit eine begriffliche
Forschungsdiskussion darzulegen bzw. zu führen, sondern es wird sich im Folgenden auf den Theoretiker gestützt, auf den sich am meisten gestützt wird, wenn es an eine Definition der Postmoderne geht: Jens Eder. Somit wird sich auch hier von einer endgültigen Definition distanziert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Eine kurze Einführung in die Begrifflichkeiten
- 1.1. Die Postmoderne im Kino
- 1.2. Dekonstruktion nach Jacques Derrida
- 1.3. Dekonstruktion im postmodernen Kino
- 2. Dekonstruktion in Pulp Fiction (1994)
- 2.1. Dekonstruktion auf der Erzähl-, Handlungs- und Figurenebene
- 2.2. Zärtliche Zerstörungen - Dekonstruktion mithilfe der Musik
- 3. Verschiedene Überlegungen zu Inglourious Basterds (2009)
- 3.1. Dekonstruktion in Inglourious Basterds
- 4. Zusammenfassung
- 5. Literaturangaben
- 5.1. Primärquellen
- 5.2. Sekundärliteratur
- 5.3. Online-Recherche
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendung von Dekonstruktionstechniken in Quentin Tarantinos postmodernen Filmen "Pulp Fiction" und "Inglourious Basterds". Ziel ist es, die spezifischen Methoden der Dekonstruktion in diesen Filmen zu analysieren und deren Beitrag zur postmodernen Ästhetik zu beleuchten. Die Arbeit bezieht sich dabei auf die theoretischen Konzepte der Postmoderne und der Dekonstruktion nach Jacques Derrida.
- Postmoderne Filmästhetik
- Dekonstruktion als filmisches Gestaltungsmittel
- Analyse von Erzählstrukturen und -techniken
- Die Rolle der Musik in der Dekonstruktion
- Vergleichende Analyse von "Pulp Fiction" und "Inglourious Basterds"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Eine kurze Einführung in die Begrifflichkeiten: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es definiert den Begriff der Postmoderne im Kontext des Kinos und erläutert das Konzept der Dekonstruktion nach Jacques Derrida. Es wird auf die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition der Postmoderne eingegangen und die Merkmale postmodernen Kinos nach Jens Eder vorgestellt, darunter Intertextualität, Spektakularität, Selbstreferentialität und Anti-Konventionalität. Derrida's Dekonstruktion wird als Verfahren zur Analyse literarischer und filmischer Texte eingeführt, das herkömmliche Interpretationsmuster hinterfragt und die Pluralität von Bedeutungen betont. Der Bezug zu Eder's Arbeit auf postmoderne Filme wie "Pulp Fiction" wird hergestellt, um den analytischen Rahmen der Arbeit zu etablieren.
2. Dekonstruktion in Pulp Fiction (1994): Dieses Kapitel analysiert die Anwendung der Dekonstruktion in Tarantinos "Pulp Fiction". Es untersucht, wie die nicht-lineare Erzählstruktur, die komplexen Figuren und die Verschränkung verschiedener Genres zur Dekonstruktion etablierter Erzählkonventionen beitragen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle der Musik gewidmet, die als ein zentrales Element der Dekonstruktion fungiert, indem sie Stimmung und Bedeutung auf ironische und überraschende Weise verändert. Die Analyse wird die verschiedenen Ebenen der Dekonstruktion im Film beleuchten, um zu zeigen, wie Tarantino die traditionellen Strukturen der Erzählung, Handlung und Charakterisierung untergräbt.
3. Verschiedene Überlegungen zu Inglourious Basterds (2009): Dieses Kapitel befasst sich mit der Dekonstruktion in "Inglourious Basterds". Es vergleicht die Strategien der Dekonstruktion in diesem Film mit denen in "Pulp Fiction" und analysiert, wie Tarantino in diesem historischen Kontext mit Genre-Konventionen umgeht. Im Fokus steht der Umgang mit der Darstellung von Gewalt und Geschichte und wie diese Darstellung zum Verständnis des Films beiträgt. Die Analyse untersucht, wie die Dekonstruktion in diesem Film funktioniert, ohne die wichtigsten Punkte der Handlung vorwegzunehmen.
Schlüsselwörter
Postmoderne, Dekonstruktion, Quentin Tarantino, Pulp Fiction, Inglourious Basterds, Filmästhetik, Erzählstruktur, Genre, Musik, Intertextualität, Jacques Derrida, Jens Eder.
Häufig gestellte Fragen zu: Dekonstruktion in Quentin Tarantinos Filmen "Pulp Fiction" und "Inglourious Basterds"
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Anwendung von Dekonstruktionstechniken in Quentin Tarantinos postmodernen Filmen "Pulp Fiction" und "Inglourious Basterds". Im Fokus steht die Untersuchung der spezifischen Methoden der Dekonstruktion und deren Beitrag zur postmodernen Ästhetik beider Filme. Die Arbeit bezieht sich dabei auf die theoretischen Konzepte der Postmoderne und der Dekonstruktion nach Jacques Derrida.
Welche theoretischen Konzepte werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorie der Postmoderne und insbesondere auf Jacques Derridas Konzept der Dekonstruktion. Es wird auch auf die Arbeit von Jens Eder zur postmodernen Filmästhetik Bezug genommen, um die analytischen Grundlagen zu schaffen. Die Definition der Postmoderne und ihrer Merkmale im Kontext des Kinos wird explizit behandelt.
Welche Filme werden analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei Filme von Quentin Tarantino: "Pulp Fiction" (1994) und "Inglourious Basterds" (2009). Der Vergleich beider Filme ermöglicht es, die Anwendung der Dekonstruktion in unterschiedlichen Kontexten und mit verschiedenen narrativen Strategien zu untersuchen.
Wie wird die Dekonstruktion in den Filmen analysiert?
Die Analyse untersucht die Dekonstruktion auf verschiedenen Ebenen: die nicht-lineare Erzählstruktur, die komplexen Figuren, die Verschränkung verschiedener Genres, die Rolle der Musik und der Umgang mit Genre-Konventionen im historischen Kontext von "Inglourious Basterds". Die Analyse beleuchtet, wie Tarantino traditionelle Erzählstrukturen, Handlungslogiken und Charakterisierungen untergräbt.
Welche Aspekte der Filme werden besonders berücksichtigt?
Neben der Erzählstruktur und den Figuren werden die Rolle der Musik als zentrales Element der Dekonstruktion sowie der Umgang mit Gewalt und Geschichte in "Inglourious Basterds" analysiert. Der Fokus liegt darauf, wie diese Elemente zur Dekonstruktion etablierter Konventionen beitragen und die Bedeutung der Filme beeinflussen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einführung in die relevanten Begriffe (Postmoderne und Dekonstruktion), eine Analyse der Dekonstruktion in "Pulp Fiction", eine Analyse der Dekonstruktion in "Inglourious Basterds", eine Zusammenfassung der Ergebnisse und eine Liste der verwendeten Literatur.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Postmoderne, Dekonstruktion, Quentin Tarantino, Pulp Fiction, Inglourious Basterds, Filmästhetik, Erzählstruktur, Genre, Musik, Intertextualität, Jacques Derrida, Jens Eder.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für Filmtheorie, Postmoderne und Dekonstruktion interessieren, sowie an alle, die eine tiefergehende Analyse von Quentin Tarantinos Werk suchen. Sie ist insbesondere für akademische Zwecke konzipiert.
- Arbeit zitieren
- Katharina Ströhl (Autor:in), 2009, Dekonstruktion in Tarantinos postmodernem Film "Pulp Fiction" und in "Inglourious Basterds", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166742