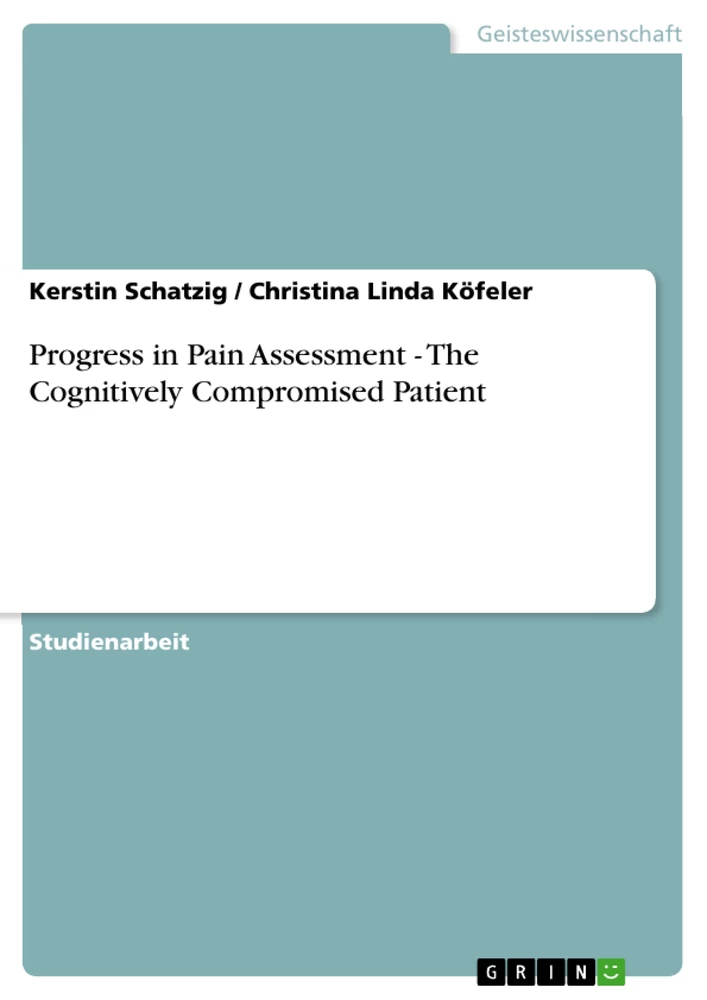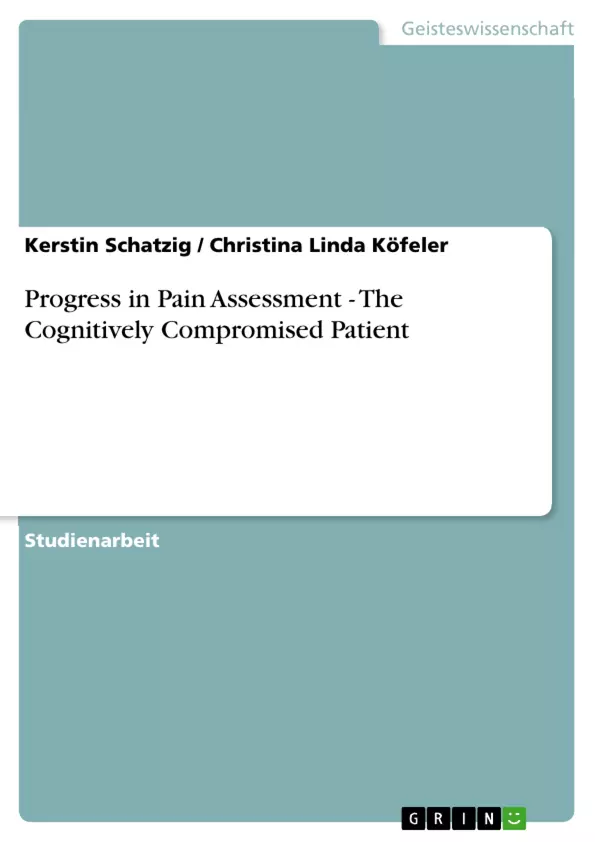Die Erfassung und Bewertung von Schmerz stellt für den klinischen Alltag und die Berufsgruppen, die ihn regelmäßig bewältigen, eine äußerst wichtige Aufgabe dar. Ethische, juristische - vor allem aber menschliche Prinzipien (Herr, Coyne, Key et al. 2006a) besagen, dass jede Patientin und jeder Patient das Recht auf eine adäquate Schmerzbehandlung hat.
Wird dieses wichtige Element in der Arbeit mit PatientInnengruppen nicht fachgerecht durchgeführt, ergeben sich häufig schwerwiegende Konsequenzen: neben der Gefahr für klinische Praktiker, neue Erkrankungen zu übersehen, verbleiben betroffene Menschen in häufig sehr leidvollen Zuständen, die wahrscheinlich verhindert hätten werden können. Vor allem also großes menschliches Leid, aber auch explodierende Kosten im Gesundheits- und Pflegesystem, zählen zu den gravierenden Folgen vernachlässigter und / oder fehlerhafter Schmerzbeurteilung (Chapman 2009).
Es muss aber auch angeführt werden, dass Schmerzerfassung häufig ein recht schwieriges Unterfangen ist, das selbst Fachleute vor sehr große Hindernisse zu stellen vermag. Dies erklärt sich aus der Eigenschaft des Schmerzes, in erster Linie ein sehr subjektives Erlebnis zu sein (Herr et. al 2006a). Aus diesem Grund ist es auch kaum oder nur sehr schwer möglich, dieses Phänomen mit Hilfe eines objektiven Tests zu erfassen. Die Methode der Wahl ist demnach wohl, den Patienten selbst zu Wort kommen zu lassen, um sein individuelles Schmerzerlebnis in eigenen Worten zu umschreiben (ebd.). Doch was, wenn der Patient dazu aus bestimmten Gründen nicht in der Lage ist? Was, wenn er oder sie wegen einer fortschreitenden dementiellen Entwicklung eine schwere kognitive Beeinträchtigung aufweist?
Bekannt ist, dass die Fähigkeit, Schmerzempfinden zu beschreiben, bei dementen Patienten eingeschränkt ist (Kunz et al. 2007). Zudem beschweren sie sich seltener über Schmerz. Ihnen werden deshalb auch weniger Schmerzmittel verabreicht. Verändert sich also bei diesen Patienten die Schmerzverarbeitung durch ihre Erkrankung (Lautenbacher et al. 2007)?
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- HERKÖMMLICHE INSTRUMENTE ZUR SCHMERZERFASSUNG
- THEORETISCHE HINTERGRÜNDE
- SCHMERZERFASSUNG BEI KOGNITIV BEEINTRÄCHTIGTEN PATIENTEN
- Die Studie von Kunz et al. (2007)
- Ähnliche Studien
- SCHLUSSFOLGERUNGEN
- LITERATUR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Herausforderung der Schmerzerfassung bei kognitiv beeinträchtigten Patienten, insbesondere im Kontext von Demenz. Die Autoren analysieren die Grenzen traditioneller Methoden der Schmerzbeurteilung und beleuchten die Bedeutung einer adäquaten Schmerzbehandlung, um menschliches Leid zu minimieren und die Gefahr von Übersehen von Erkrankungen zu vermeiden.
- Schwierigkeiten bei der objektiven Erfassung von Schmerz
- Ethische und juristische Aspekte der Schmerzbehandlung
- Grenzen von Selbsteinschätzungsfragebögen bei dementen Patienten
- Alternativen zur Schmerzerfassung, insbesondere durch die Analyse des Gesichtsausdrucks
- Biopsychosoziales Konzept und Kommunikations-Model des Schmerzes
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt das Problem der Schmerzerfassung im klinischen Alltag dar und erläutert die ethischen und praktischen Gründe für eine angemessene Schmerzbehandlung. Das Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten bei der objektiven Erfassung von Schmerz aufgrund seiner subjektiven Natur. Zudem wird die besondere Herausforderung bei der Schmerzerfassung bei dementen Patienten hervorgehoben, die oft nicht in der Lage sind, ihr Schmerzempfinden verbal zu kommunizieren.
Kapitel 2 befasst sich mit traditionellen Instrumenten der Schmerzerfassung, wie sie in der Literatur beschrieben werden. Hier werden gängige Ansätze und Empfehlungen für den Umgang mit Schmerzerfassung bei kognitiv beeinträchtigten Patienten vorgestellt, wobei der Selbstbericht des Patienten als primäre Quelle, jedoch mit Einschränkungen bei dementen Patienten, betrachtet wird. Weitere Elemente der Schmerzbeurteilung, wie die Beobachtung des Patienten, Fremdberichte und die Wirkung von Analgetika, werden ebenfalls beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich den theoretischen Grundlagen der Schmerzerfassung und führt das biopsychosoziale Konzept und das Kommunikations-Model des Schmerzes ein. Diese Modelle unterstreichen die Komplexität des Schmerzempfindens und die Einflussfaktoren, die über den reinen physiologischen Aspekt hinausgehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Schmerzerfassung, kognitive Beeinträchtigung, Demenz, Schmerzbehandlung, Selbsteinschätzungsfragebögen, Gesichtsausdruck, biopsychosoziales Konzept und Kommunikations-Model des Schmerzes.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Schmerzerfassung bei Demenz-Patienten so schwierig?
Demente Patienten können ihr Schmerzempfinden oft nicht mehr verbal kommunizieren, was herkömmliche Selbsteinschätzungs-Instrumente unbrauchbar macht.
Welche Folgen hat eine vernachlässigte Schmerzbehandlung?
Neben großem menschlichem Leid können neue Erkrankungen übersehen werden und die Kosten im Gesundheitssystem steigen unnötig an.
Wie kann Schmerz bei kognitiver Beeinträchtigung erkannt werden?
Alternative Methoden umfassen die Beobachtung des Gesichtsausdrucks, Verhaltensänderungen und Fremdberichte durch Angehörige oder Pflegekräfte.
Was besagt das biopsychosoziale Konzept des Schmerzes?
Es betrachtet Schmerz nicht nur als körperliches Signal, sondern als komplexes Zusammenspiel biologischer, psychischer und sozialer Faktoren.
Verändert sich die Schmerzverarbeitung durch Demenz?
Die Arbeit diskutiert Studien, die untersuchen, inwieweit die neurologische Erkrankung die tatsächliche Wahrnehmung und Verarbeitung von Schmerzsignalen beeinflusst.
- Quote paper
- Kerstin Schatzig (Author), Christina Linda Köfeler (Author), 2011, Progress in Pain Assessment - The Cognitively Compromised Patient, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166748