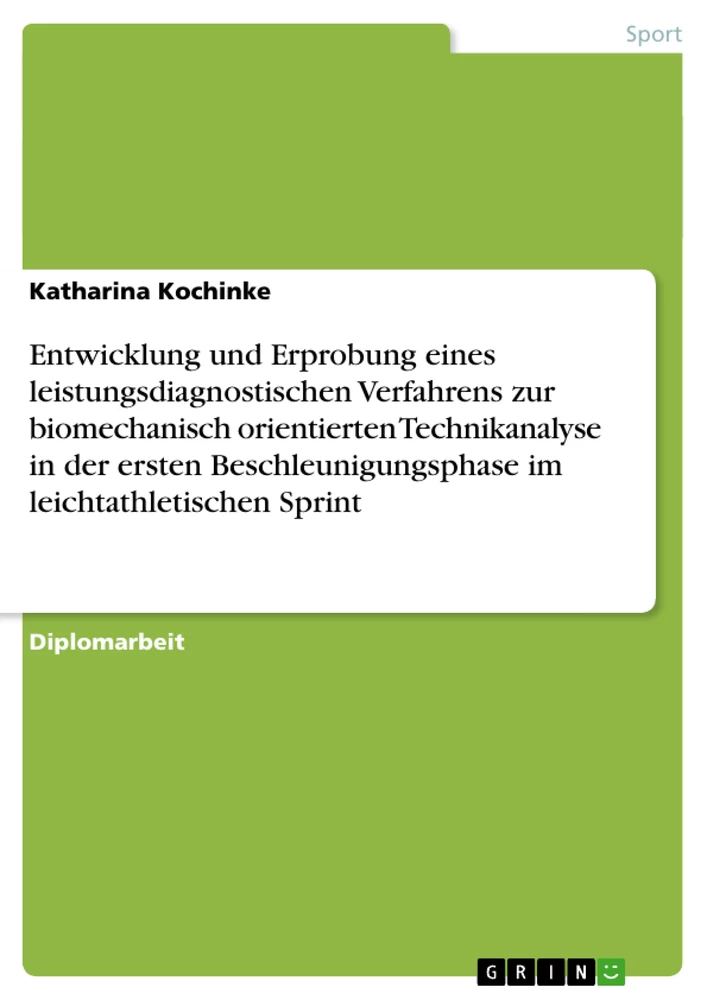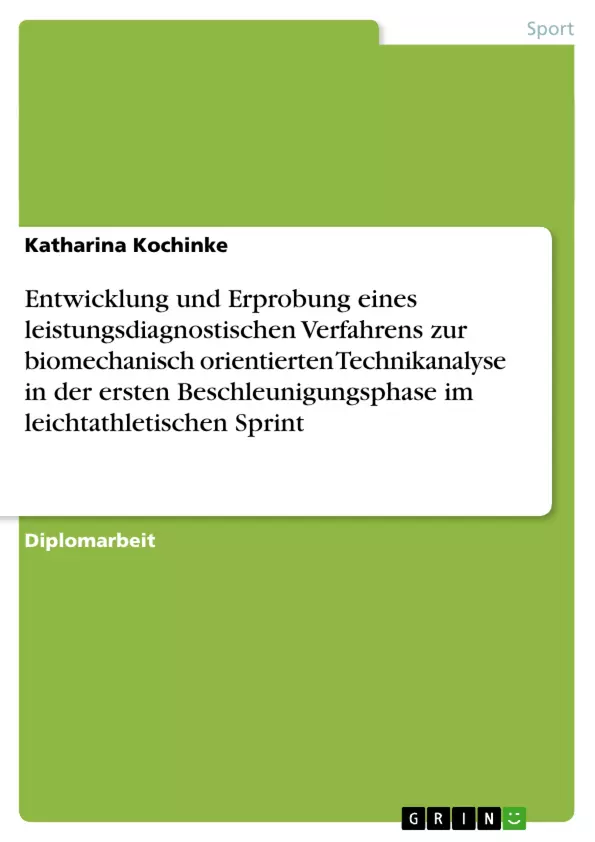Der Kurzstreckensprint ist, nach antiken Überlieferungen, unter den Laufdisziplinen der älteste Wettbewerb der Spiele von Olympia. Bereits seit 776 v. Chr. sollen sich Sportler um das Prädikat des schnellsten Sportlers bemüht haben. Auch mit der Wiedergeburt der olympischen Spiele der Neuzeit, im Jahre 1896, war die leicht-athletische Königsdisziplin wieder fester Bestandteil des Programms.
Seitdem haben sich die Zeiten über 100m ständig verbessert.[...] Neben diesen Verbesserungen wurde zudem versucht ein einheitliches Technikleitbild zu erstellen. Doch gerade im Sprint ist es nicht so einfach von einer Idealtechnik zu sprechen, da die Technik entsprechend der individuellen Merkmale variieren kann. Bei den Versuchen der Technikbeschreibung wurde sich stets an den Techniken der aktuell erfolgreichen Athleten orientiert. So galt der Stil von Armin Hary bis zum Olympiasieg von Valery Borsov 1972 als perfekter Sprint. Danach dominierte die Technik Borsovs bis Florence Griffith-Joyner Mitte der 80er Jahre mit dem ziehenden Laufen große Erfolge verbuchen konnte. Nach diesen sich verändernden Technikidealen scheint Usain Bolt gegenwärtig die Vorteile beider Techniken in sich zu vereinen und damit überaus erfolgreich zu sein.
Zu der Technik des Kurzsprints gibt es zahlreiche Untersuchungen auf der Ebene von Leistungs- und Spitzensportlern. Allerdings findet man kaum Untersuchungen aus den letzten Jahren, aktuelle detaillierte Daten sind kaum vorhanden und zudem schlecht reproduzierbar. Sieht man genauer hin, fallen außerdem große Defizite im Nachwuchsbereich auf. So fehlen vor allem Daten und Werte im Kinder- und Jugendbereich. Doch gerade hier sind Akzentsetzungen nötig um bereits im jungen Alter Talente zu schulen und zu fördern.
Daher soll in Zusammenarbeit mit der Talentförderschule 1860 München langfristig gesehen ein leistungsdiagnostisches Verfahren für den Kurzsprint entwickelt werden. Dazu wird mit dieser Diplomarbeit versucht aus verschiedenen Quellen ein Technikleitbild zu erstellen, sowie ein geeignetes Mess- und Auswerteverfahren für die Analyse des Sprints zu entwickeln.
Die vorliegende Arbeit befasst sich ausschließlich mit dem ersten Teil der Beschleunigungsphase, auch Phase der Startbeschleunigung oder Pick-Up-Phase eins genannt. Neben dieser Arbeit wurden zudem bereits im Vorjahr der Start und die Phase der maximalen Geschwindigkeit im leichtathletischen Sprint, anhand der Trainingsgruppen von 1860 München, untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Problemstellung
- 3 Theoretische Betrachtung der Thematik
- 3.1 Aktueller Forschungsstand im Sprint
- 3.1.1 Abgrenzung der einzelnen Laufabschnitte der Sprinttechnik
- 3.1.2 Die Phasenstruktur des „freien“ Sprintschrittes
- 3.2 Entwicklung eines Technikleitbildes des Sprints im Abschnitt der Startbeschleunigung
- 3.2.1 Allgemeines zur Schrittlänge und Schrittfrequenz
- 3.2.2 Stützzugphase
- 3.2.3 Ausschwungphase
- 3.2.4 Kniehubschwungphase
- 3.2.5 Schwungzugphase
- 3.2.6 Allgemeine Merkmale
- 3.2.6.1 Maximale KSP-Geschwindigkeit in Laufrichtung
- 3.2.6.2 Schrittlänge
- 3.2.6.3 Schrittfrequenz
- 3.2.6.4 Verlauf der Oberkörpervorlage
- 3.2.6.4 KSP-Schwankung
- 3.2.6.5 Zeiten über 5 und 10 m
- 3.2.7 Zusammenfassung des Technikleitbildes
- 4 Untersuchung der Bewegungskinematik in der ersten Beschleunigungsphase
- 4.1 Methodik
- 4.1.1 Untersuchungsgut
- 4.1.2 Räumliche Gegebenheiten
- 4.1.3 Materielle Gegebenheiten
- 4.1.4 Messgeräte
- 4.1.4.1 Motion Analysis
- 4.1.4.2 Cortex Software 1.1.4.368
- 4.1.4.3 SIMI Motion 7.5
- 4.1.4.4 Videokamera
- 4.1.4.5 Startblock
- 4.1.5 Untersuchungsdesign
- 4.1.6 Untersuchungsdurchführung
- 4.1.6.1 Vorbereitungen der Aufnahmen
- 4.1.6.2 Durchführung der Aufnahmen
- 4.1.7 Bearbeitung der Aufnahmen
- 4.1.7.1 Marker Zuordnung
- 4.1.7.2 Glätten
- 4.1.7.3 Schneiden
- 4.1.7.4 Bestimmung bester Lauf
- 4.1.7.5 Virtuelle Marker
- 4.1.7.6 KSP-Berechnung
- 4.1.8 Auswertung der Daten
- 4.1.8.1 Berechnung der allgemeinen Merkmale
- 4.1.8.2 Messung der Merkmale in der Stützzugphase
- 4.1.8.3 Messungen der Merkmale in der Ausschwungphase
- 4.1.8.4 Messungen der Merkmale in der Kniehubschwungphase
- 4.1.7.5 Messungen der Merkmale in der Schwungzugphase
- 4.2 Darstellung und Bewertung der Ergebnisse
- 4.2.1 Ergebnisse Proband 1
- 4.2.2 Ergebnisse Proband 2
- 4.2.3 Ergebnisse Proband 3
- 4.2.4 Ergebnisse Proband 4
- 4.2.5 Ergebnisse Proband 5
- 4.2.6 Ergebnisse Proband 6
- 4.2.7 Ergebnisse Proband 7
- 4.2.8 Ergebnisse Proband 8
- 4.2.9 Ergebnisse Proband 9
- 4.2.10 Ergebnisse Proband 10
- 4.3 Diskussion der Ergebnisse
- 4.3.1 Methodenkritik
- 4.3.1.1 Untersuchungsgut
- 4.3.1.2 Aufnahme und Messgeräte
- 4.3.1.3 Auswertung
- 4.3.2 Interpretation der Ergebnisse
- 4.3.2.1 Ergebnisse der allgemeinen Merkmale
- 4.3.2.2 Ergebnisse der Stützzugphase
- 4.3.2.3 Ergebnisse der Ausschwungphase
- 4.3.2.4 Ergebnisse der Knieschwungphase
- 4.3.2.5 Ergebnisse der Schwungzugphase
- 4.3.2.6 Exemplarischer Vergleich schneller und langsamer Proband
- 4.4 Schlussfolgerungen
- 5 Ausblick
- 6 Zusammenfassung
- 7 Literaturverzeichnis
- 8 Anhang
- Analyse der Sprinttechnik in der ersten Beschleunigungsphase
- Entwicklung eines Technikleitbildes für die Startbeschleunigung
- Erprobung eines leistungsdiagnostischen Verfahrens für die Analyse der Sprinttechnik
- Ermittlung und Interpretation von kinematischen Merkmalen der Sprinttechnik
- Vergleich der Technik von guten und weniger guten Sprintern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit zielt darauf ab, ein leistungsdiagnostisches Verfahren zur biomechanisch orientierten Technikanalyse der ersten Beschleunigungsphase im leichtathletischen Sprint zu entwickeln und zu erproben. Dabei werden aus verschiedenen Quellen Erkenntnisse zum Technikleitbild des Sprints zusammengetragen und ein geeignetes Mess- und Auswerteverfahren für die Analyse der Bewegungskinematik erstellt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Hintergrund und die Relevanz des Themas erläutert. Anschließend wird die Problemstellung dargelegt, die sich mit der Notwendigkeit eines umfassenden Technikleitbildes und eines geeigneten Messverfahrens für die Analyse der Sprinttechnik in der Beschleunigungsphase beschäftigt. Im Theorieteil werden verschiedene Ansätze zur Phasenstruktur des Sprintschrittes vorgestellt und das Technikleitbild für die Startbeschleunigung entwickelt. Im Methodenkapitel wird die Durchführung der Untersuchung mit den verwendeten Messgeräten und -verfahren detailliert beschrieben. Daraufhin werden die Ergebnisse der kinematischen Analyse von zehn jungen Leichtathleten dargestellt und bewertet. Die Diskussion der Ergebnisse umfasst eine kritische Bewertung der verwendeten Methoden und eine Interpretation der gewonnenen Daten. Abschließend werden Schlussfolgerungen gezogen, welche die Zusammenhänge der einzelnen Bewegungsparameter und die entscheidenden Merkmale für eine gute Sprinttechnik aufzeigen. Der Ausblick skizziert die Weiterentwicklung des Verfahrens und die zukünftige Anwendung in der Praxis.
Schlüsselwörter
Sprinttechnik, Startbeschleunigung, Pick-Up-Phase, Biomechanik, Kinematik, Leistungsdiagnostik, Technikleitbild, Bewegungskinematik, Motion Analysis, Cortex, SIMI Motion, 3D-Analyse, Impulsvektoren, Körperschwerpunkt, Schrittlänge, Schrittfrequenz, Fußaufsatz, Kniehub, Hüftwinkel, Hüftwinkelgeschwindigkeit, Oberkörpervorlage.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die 'Pick-Up-Phase' im Sprint?
Es ist die erste Beschleunigungsphase unmittelbar nach dem Start, in der der Athlet versucht, seine Geschwindigkeit maximal zu steigern.
Wie wird die Sprinttechnik biomechanisch analysiert?
Durch Verfahren wie 3D-Bewegungsanalyse (z.B. SIMI Motion), bei denen Marker am Körper die Kinematik des Laufs (Winkel, Geschwindigkeiten) erfassen.
Welche Rolle spielt der Körperschwerpunkt (KSP) beim Sprint?
Die horizontale Geschwindigkeit des KSP und dessen Schwankungen sind entscheidende Indikatoren für die Effizienz der Lauftechnik.
Was ist ein Technikleitbild?
Ein theoretisches Ideal der Bewegungsabläufe, das als Orientierung für Trainer und Athleten dient, um Fehler zu identifizieren und Leistungen zu optimieren.
Warum ist Leistungsdiagnostik im Nachwuchsbereich wichtig?
Um Talente frühzeitig biomechanisch korrekt zu schulen und individuelle Defizite in der Beschleunigungsphase gezielt zu trainieren.
- Quote paper
- Katharina Kochinke (Author), 2010, Entwicklung und Erprobung eines leistungsdiagnostischen Verfahrens zur biomechanisch orientierten Technikanalyse in der ersten Beschleunigungsphase im leichtathletischen Sprint, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166762