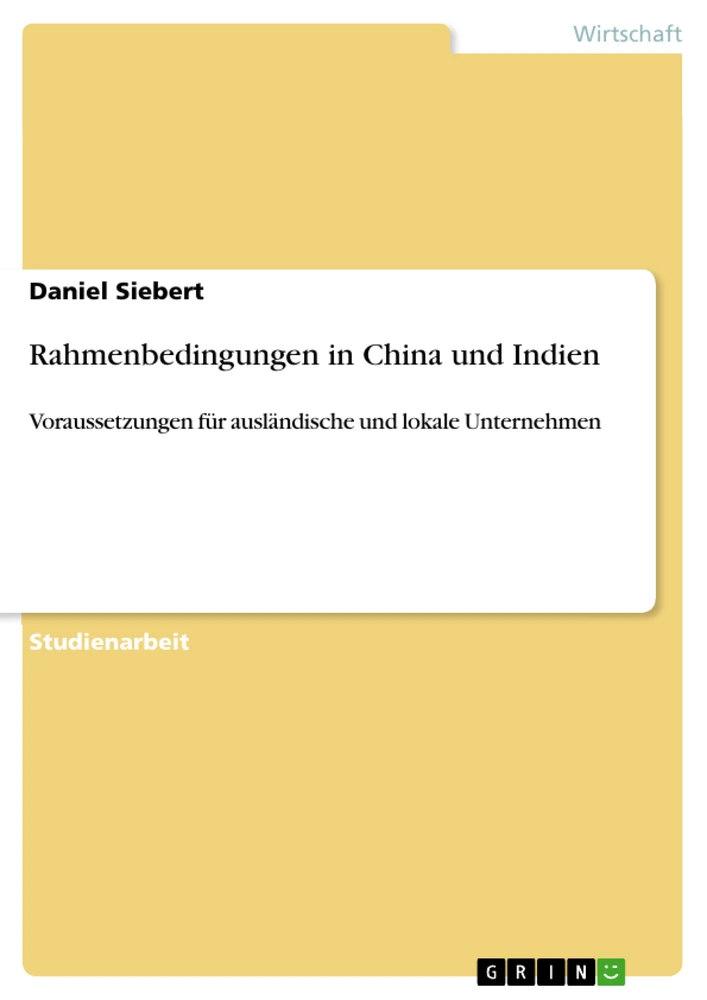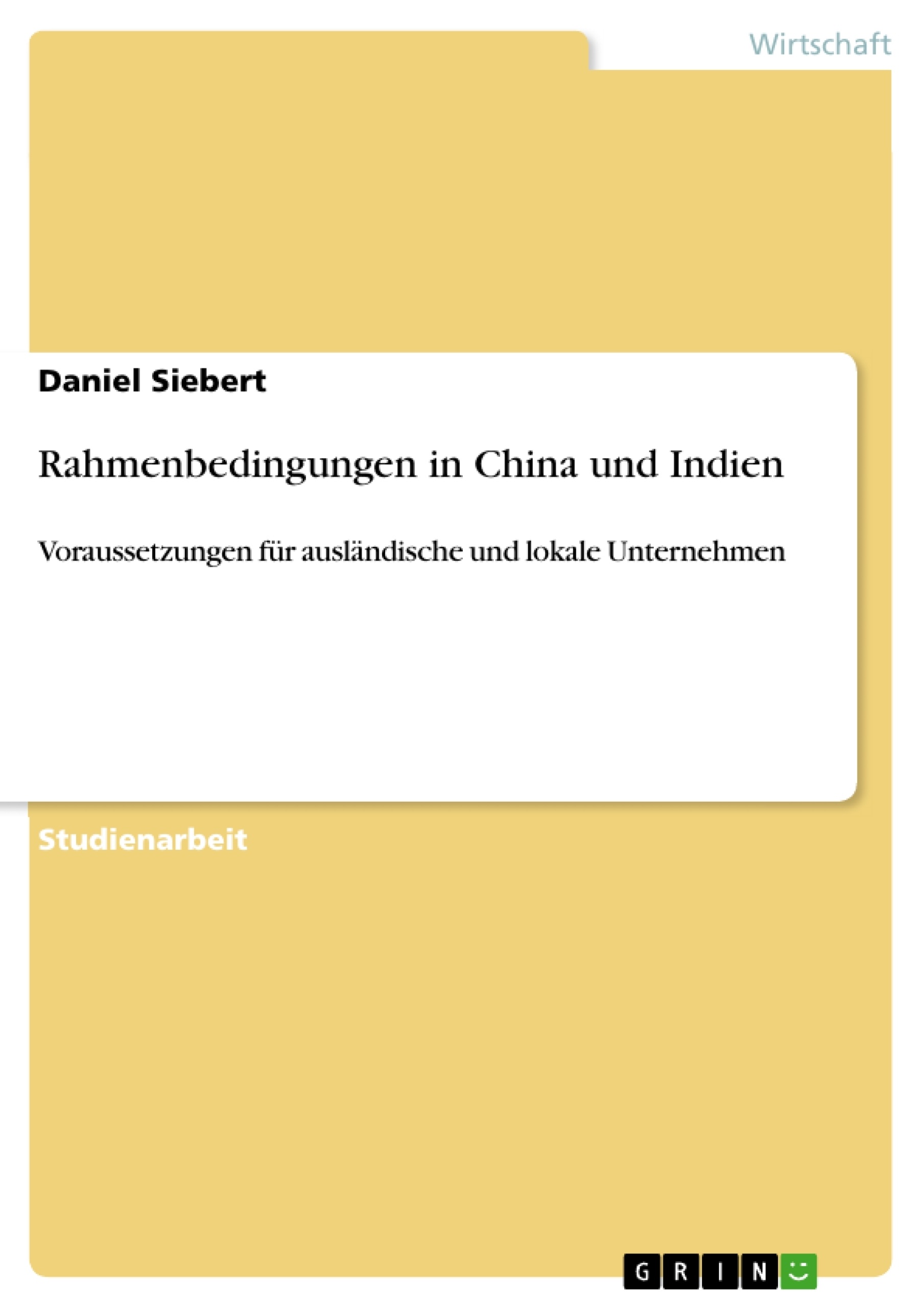Der Volksrepublik China und Indien kommt in der Zukunft eine immer größere Bedeutung zu. Eine Prognose von Wilson/Purushothaman (2006)1 hat ergeben, dass China etwa im Jahr 2040 zur weltweit größten Volkswirtschaft aufsteigen wird. Ebenso wird Indien eine sehr dynamische Entwicklung vorausgesagt: Zwischen 2030 und 2040 wird die indische Volkswirtschaft die Leistungsfähigkeit Japans übersteigen und zur drittgrößten Volkswirtschaft hinter China und den USA aufsteigen. Für das Jahr 2050 wird vermutet, dass China mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von fast 50.000 Mrd. US-Dollar mit großem Abstand die weltweit größte Wirtschaftsleistung erbringen wird. Indien hingegen folgt mit ca. 28.000 Mrd. US-Dollar auf dem dritten Rang.
Diese Zahlen veranschaulichen, dass den beiden asiatischen Staaten eine zunehmende Bedeutung in der Weltwirtschaft zugesprochen wird. Deshalb wird ein Engagement in den beiden aufstrebenden Nationen für Unternehmen immer wichtiger. In diesem Zusammenhang geht die vorliegende Arbeit der Forschungsfrage nach, unter welchen geographisch-kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen einheimische und ausländische Unternehmen in China und Indien agieren. Dabei soll analysiert werden, welche Gemeinsamkeiten und Diskrepanzen zwischen den beiden Ländern bestehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Themenhinführung und Fragestellung
- Quellenlage und Forschungsstand
- Vorgehensweise
- Rahmenbedingungen in China
- Geographische und kulturelle Rahmenbedingungen
- Politische Rahmenbedingungen
- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Indien
- Geographische und kulturelle Rahmenbedingungen
- Politische Rahmenbedingungen
- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Rahmenbedingungen für ausländische und lokale Unternehmen in China und Indien. Sie analysiert die geographisch-kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Bedingungen in beiden Ländern und untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Rahmenbedingungen in diesen beiden aufstrebenden Wirtschaftsnationen zu zeichnen, um Unternehmen eine fundierte Grundlage für ihre Entscheidungen zu bieten.
- Analyse der geographischen und kulturellen Rahmenbedingungen in China und Indien
- Untersuchung der politischen Rahmenbedingungen in beiden Ländern
- Bewertung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in China und Indien
- Bewertung der rechtlichen Rahmenbedingungen in beiden Ländern
- Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Rahmenbedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik und die Fragestellung der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Bedeutung von China und Indien als aufstrebende Wirtschaftsnationen und die zunehmende Relevanz eines Engagements für Unternehmen in diesen Ländern. Zudem wird der aktuelle Forschungsstand zu den Rahmenbedingungen in China und Indien beleuchtet.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Rahmenbedingungen in China. Es analysiert die geographischen und kulturellen, politischen, wirtschaftlichen sowie rechtlichen Bedingungen im „Reich der Mitte“. Dabei werden die Chancen und Herausforderungen für ausländische Unternehmen beleuchtet.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Rahmenbedingungen in Indien. Es untersucht die geographisch-kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Bedingungen in Indien und analysiert die jeweiligen Chancen und Herausforderungen für Unternehmen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Rahmenbedingungen für Unternehmen in China und Indien. Die Schwerpunkte liegen auf den geographischen und kulturellen Besonderheiten, den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den rechtlichen Gegebenheiten in beiden Ländern. Die Arbeit analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Rahmenbedingungen und bietet Unternehmen ein umfassendes Bild der wichtigsten Faktoren für den Markteintritt und die Geschäftstätigkeit in diesen beiden aufstrebenden Wirtschaftsnationen.
Häufig gestellte Fragen
Welche wirtschaftliche Bedeutung werden China und Indien bis 2050 haben?
Prognosen zufolge wird China bis 2040 zur weltweit größten Volkswirtschaft aufsteigen, während Indien bis 2050 zur drittgrößten Wirtschaftsmacht hinter China und den USA heranwachsen wird.
Welche Rahmenbedingungen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert geographisch-kulturelle, politische, wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen für Unternehmen in beiden Ländern.
Gibt es große Unterschiede zwischen den Rechtssystemen in China und Indien?
Ja, die Arbeit identifiziert spezifische Diskrepanzen und Gemeinsamkeiten in den rechtlichen Gegebenheiten, die für den Markteintritt ausländischer Unternehmen entscheidend sind.
Warum ist ein Engagement in diesen Märkten für Unternehmen heute wichtiger denn je?
Aufgrund der enormen Wachstumsdynamik und der prognostizierten Marktgröße bieten China und Indien unverzichtbare Chancen für die globale Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen.
Welche Rolle spielt die Kultur beim Geschäftserfolg in Asien?
Die Arbeit zeigt auf, dass kulturelle Rahmenbedingungen das unternehmerische Handeln tiefgreifend beeinflussen und ein Verständnis dieser Besonderheiten für den Erfolg essenziell ist.
- Quote paper
- Daniel Siebert (Author), 2011, Rahmenbedingungen in China und Indien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166795