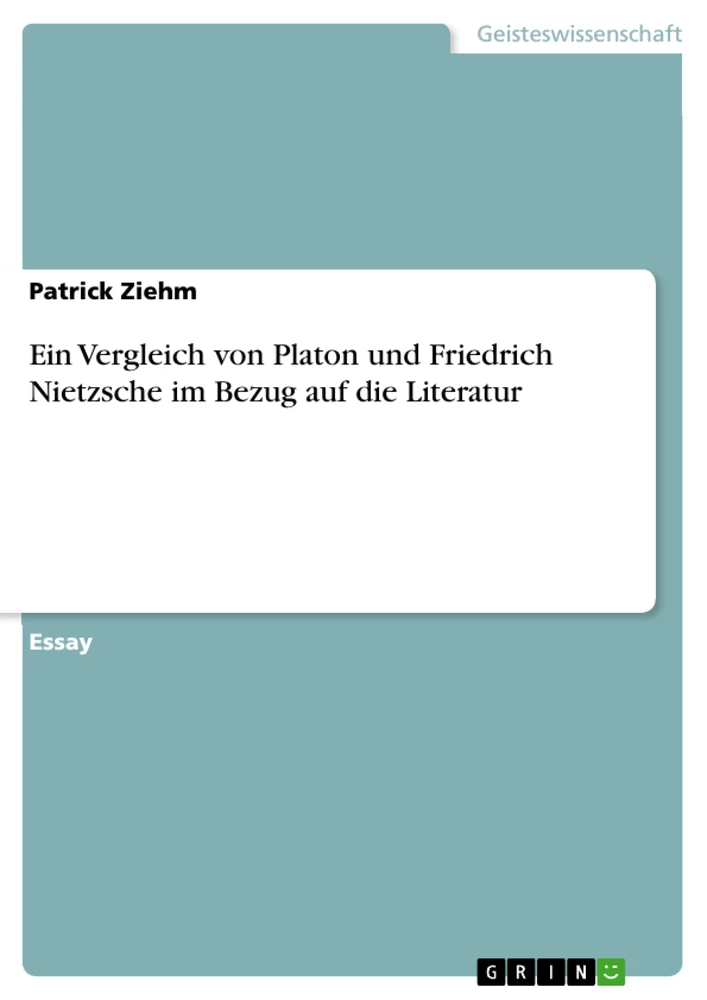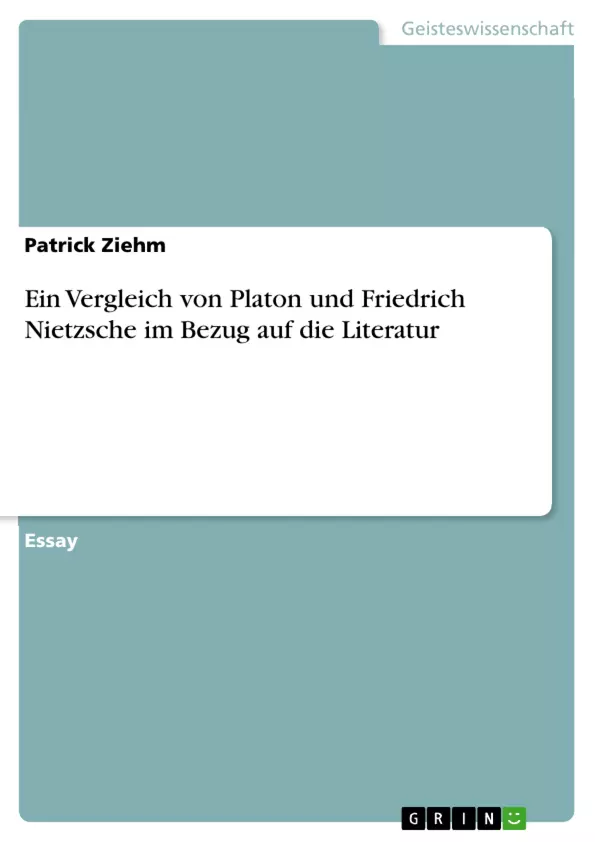Das vorliegende Essay soll einen Vergleich von Platon und Friedrich Nietzsche im Bezug auf die Literatur aufzeigen. Dabei dienen als Grundlage der Gegenüberstellung zwei bedeutende Werke der Philosophen. Zum einen das Zehnte Buch aus „Der Staat“ von Platon und zum anderen „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ von Friedrich Nietzsche.
Systematisch wird zunächst Platon und sein Werk und die Argumente im Hinblick auf seine Position zur Literatur vorgestellt. Im Anschluss daran wird das Werk von Friedrich Nietzsche betrachtet und ebenfalls seine Stellung zur Literatur hervorgehoben. Bei der Erläuterung der verschiedenen Argumente werde ich selektiv vorgehen und nur die hervorheben, die meiner Meinung nach am aussagekräftigsten sind. Abschließend werde ich mich zu einer Position bekennen und die dargebotenen Argumente der Philosophen bewerten.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Ein Vergleich von Platon und Friedrich Nietzsche im Bezug auf die Literatur
- Platon und sein Werk
- Friedrich Nietzsche und seine Sicht auf die Literatur
- Bewertung der Argumente
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay zielt darauf ab, einen Vergleich zwischen Platon und Friedrich Nietzsche im Hinblick auf ihre Positionen zur Literatur zu ziehen. Die Analyse basiert auf zwei wichtigen Werken der Philosophen: Platons "Der Staat", insbesondere das Zehnte Buch, und Friedrich Nietzsches "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik".
- Platons Kritik an der Dichtkunst als Nachahmung der Ideen
- Nietzsches Bejahung des Lebens und die Rolle der Kunst
- Die Synthese von dionysischem und apollinischem Trieb in der griechischen Tragödie
- Die Bedeutung der Literatur für die Gestaltung des Lebens
- Die Rolle der Literatur als Teil der Wirklichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Der erste Teil des Essays stellt Platons Position zur Literatur dar. Er argumentiert, dass Dichtung eine Nachahmung der Ideen ist und somit eine minderwertige Kunstform darstellt. Platon befürchtet, dass die Dichtkunst die Vernünftigen verderben kann, da sie eine schlechte Verfassung in die Seele der Menschen einführt.
- Im zweiten Teil wird Friedrich Nietzsches Sicht auf die Literatur beleuchtet. Er sieht die Kunst, insbesondere die Tragödie, als eine Kraft, die das Leben bejaht und dem Menschen Lebensenergie verleiht. Nietzsche kritisiert Platons Sichtweise als zu negativ und argumentiert, dass die Kunst nicht nur das Angenehme, sondern auch ein Teil der Wirklichkeit ist.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Begriffe dieses Essays sind: Platon, Friedrich Nietzsche, Literatur, Dichtkunst, Nachahmung, Ideenlehre, dionysischer Trieb, apollinischer Trieb, Tragödie, Kunst, Lebensbejahung, Wirklichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie bewertet Platon die Dichtkunst?
Platon sieht die Dichtung kritisch als bloße Nachahmung (Mimesis) der Sinnenwelt, die wiederum nur ein Abbild der Ideen ist. Er hält sie für potenziell schädlich für die Seele.
Was ist Nietzsches Gegenposition zur Literatur?
Nietzsche bejaht die Kunst als lebensnotwendige Kraft, die dem Menschen Energie verleiht und die Wirklichkeit nicht nur nachahmt, sondern gestaltet.
Was bedeuten 'dionysisch' und 'apollinisch'?
In Nietzsches Werk stehen sie für zwei Kunsttriebe: das Rauschhafte/Grenzenlose (Dionysos) und das Maßvolle/Strukturierte (Apollo). Ihre Synthese bildet die griechische Tragödie.
Welche Werke bilden die Grundlage des Vergleichs?
Platons „Der Staat“ (10. Buch) und Nietzsches „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“.
Warum fürchtete Platon die Dichtkunst im Staat?
Er befürchtete, dass die emotionale Wirkung der Dichtung die Vernunft der Bürger schwächen und eine schlechte Verfassung in die Seele einführen könnte.
- Citation du texte
- Patrick Ziehm (Auteur), 2008, Ein Vergleich von Platon und Friedrich Nietzsche im Bezug auf die Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166811